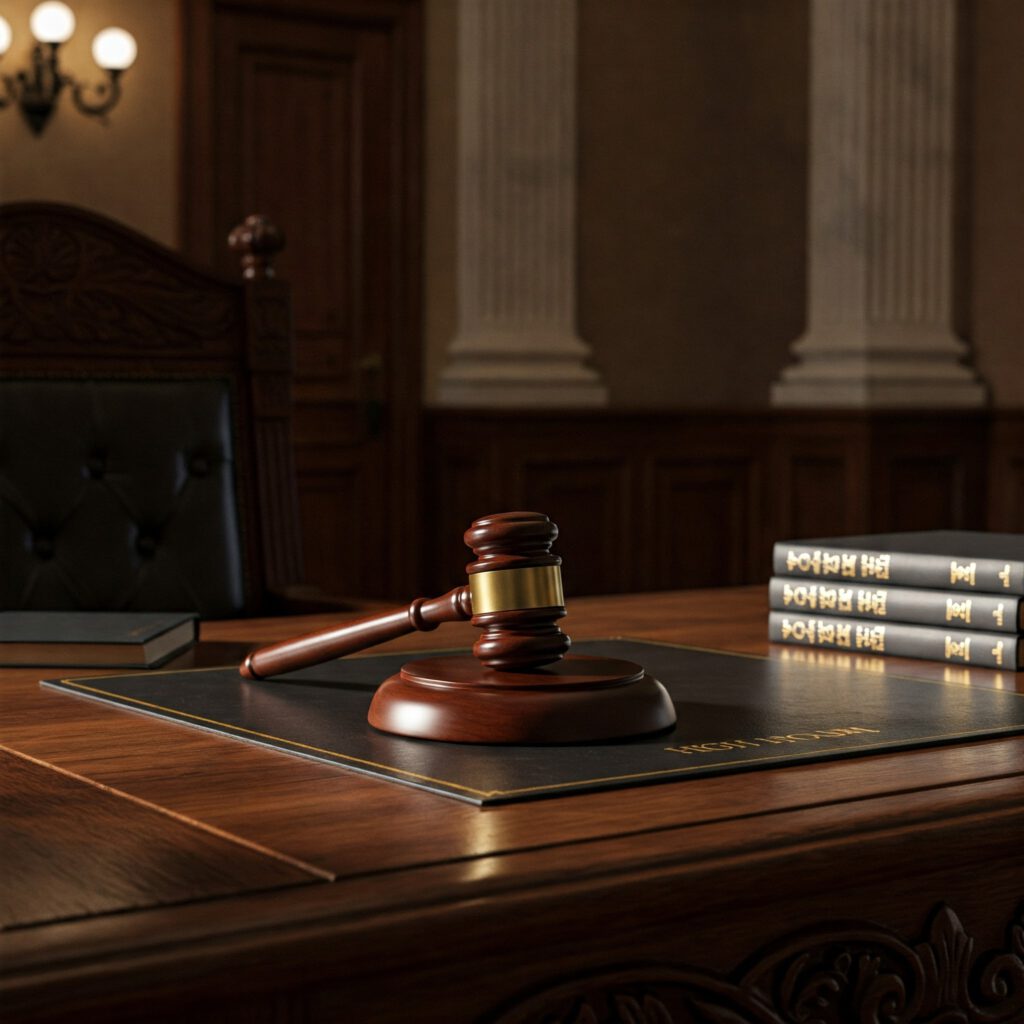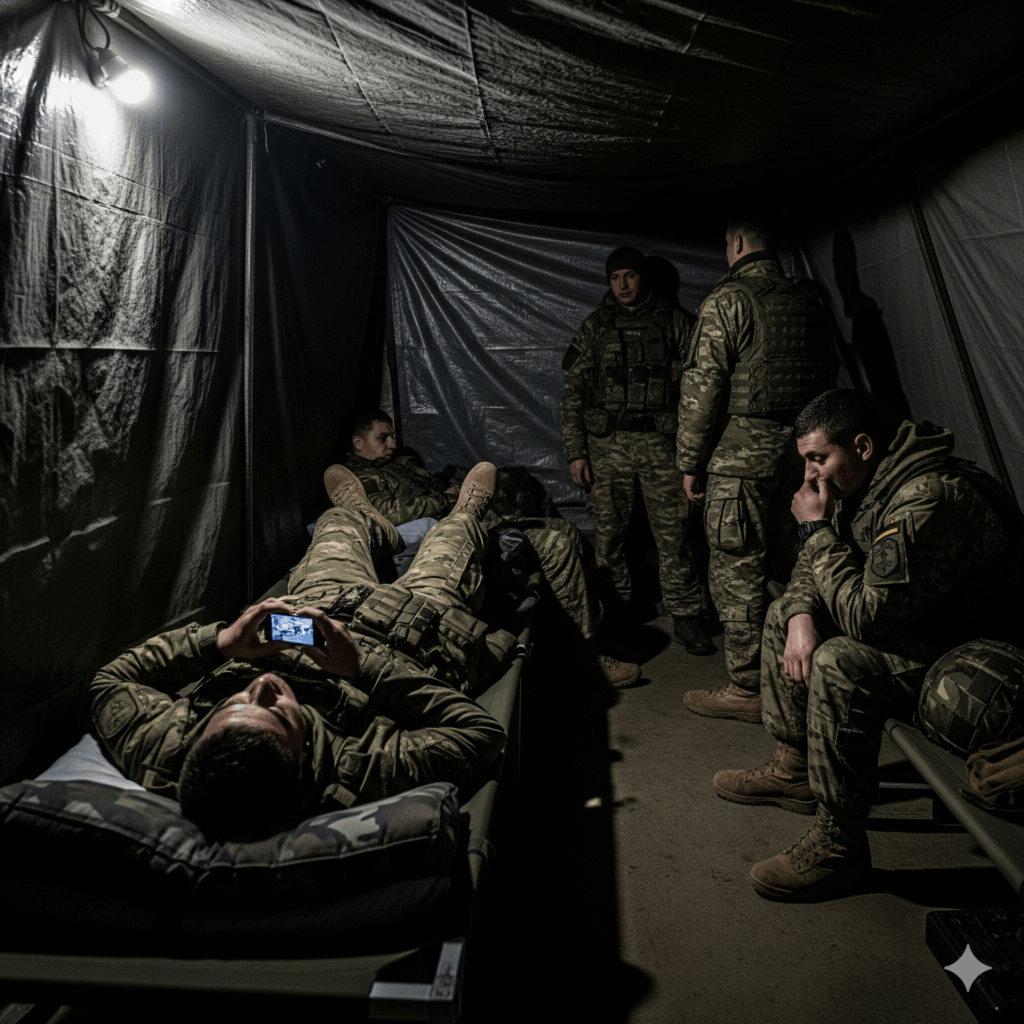Es ist ein Akt politischer Selbstinszenierung, so kalkuliert wie unumgänglich. Wenn Kamala Harris in wenigen Wochen ihre Memoiren mit dem Titel „107 Days“ veröffentlicht, ist dies weit mehr als nur der literarische Rückblick einer gescheiterten Präsidentschaftskandidatin. Es ist der Versuch, die Deutungshoheit über ein politisches Trauma zurückzugewinnen, das nicht nur ihr eigenes ist, sondern das einer ganzen Partei. Das Buch, benannt nach der fiebrigen, atemlosen Dauer ihrer Kampagne, die auf den Trümmern von Joe Bidens Kandidatur errichtet wurde, markiert den Beginn einer heiklen Gratwanderung. Harris positioniert sich für die Zukunft, indem sie die Vergangenheit neu erzählt. Doch dieser strategische Aufbruch prallt auf die tief sitzende Sehnsucht der Demokraten, ebenjene Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Harris verkörpert das Dilemma ihrer Partei wie keine Zweite: Sie ist die Protagonistin einer Geschichte, an die niemand mehr erinnert werden will, und zugleich die potenzielle Architektin einer Zukunft, für die ihr viele die Vision und die Durchschlagskraft absprechen.
Die Architektin ihrer eigenen Legende: Das Buch als Waffe
Die Ankündigung von „107 Days“ ist kein gewöhnlicher Vorgang im Literaturbetrieb; sie ist ein präzise gesetzter politischer Impuls. Die gesamte Aufmachung zielt darauf ab, die Erzählung von einer unglücklichen Verliererin in die einer tragischen Heldin zu verwandeln. Der Verlag Simon & Schuster bewirbt das Werk nicht als trockene Analyse, sondern als „fesselnden Bericht“, der sich eher wie ein „Spannungsroman“ liest. Diese Dramatisierung ist kein Zufall. Um den gewünschten erzählerischen Sog zu erzeugen, wurde mit der Pulitzer-Preisträgerin Geraldine Brooks eine anerkannte Romanautorin als Co-Autorin engagiert – eine für politische Memoiren höchst ungewöhnliche Wahl. Das Ziel ist offensichtlich: Harris‘ 107-tägiger Sprint ins Weiße Haus soll nicht als politisches Scheitern in die Geschichte eingehen, sondern als eine fast mythische Anstrengung gegen übermächtige Widerstände.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
In ihren eigenen Worten will Harris teilen, „was ich gesehen habe, was ich gelernt habe und was es braucht, um voranzukommen“. Dies ist der Kern ihres Projekts: Sie beansprucht die Rolle der weitsichtigen Akteurin, die aus der Niederlage die entscheidenden Lehren für die Zukunft gezogen hat. Das Buch wird zur Plattform, um ihre Version der Ereignisse zu zementieren – eine Version, die vermutlich die widrigen Umstände betont, unter denen sie antreten musste, nachdem Joe Biden nach einer desaströsen Debatte das Handtuch warf. Es ist ein Versuch, die Kontrolle über ein Narrativ zu erlangen, das ihr ansonsten von Kritikern und Historikern diktiert würde. Gleichzeitig dient die Veröffentlichung, flankiert von sorgfältig ausgewählten Medienauftritten wie dem Interview bei Stephen Colbert, dazu, Harris im öffentlichen Bewusstsein zu verankern – nicht als Teil des Problems von 2024, sondern als potenzielle Lösung für 2028.
Der strategische Rückzug: Mehr als nur eine Pause?
Parallel zur literarischen Offensive vollzog Harris einen weiteren, entscheidenden strategischen Schritt: die Absage an eine Kandidatur für das Gouverneursamt in Kalifornien im Jahr 2026. Auf den ersten Blick wirkt ihre Erklärung, sie wolle nach Jahrzehnten im Amt eine Pause von der Politik einlegen und als Privatbürgerin mit den Menschen ins Gespräch kommen, wie ein Ausdruck persönlicher Erschöpfung. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich ein klares politisches Kalkül. Eine Kandidatur in Kalifornien hätte sie auf eine regionale Bühne gezwungen und dem Risiko ausgesetzt, bei einer Niederlage endgültig als politisch verbrannt zu gelten. Ein Sieg hätte sie für Jahre an die komplexen und oft undankbaren Probleme des bevölkerungsreichsten Bundesstaates gebunden – von Haushaltsdefiziten bis zur Wohnungskrise – und ihre nationale Präsenz geschmälert.
Ihr Verzicht hat die politische Landschaft in Kalifornien, die monatelang wie eingefroren auf ihre Entscheidung gewartet hatte, schlagartig verändert und das Rennen für eine Vielzahl weniger bekannter Kandidaten geöffnet. Für Harris selbst aber ist der Verzicht kein Rückzug, sondern eine Neuausrichtung. Er hält ihr alle Optionen für die nationale Bühne offen. Statt sich im kalifornischen Politikbetrieb aufzureiben, plant sie, durch das Land zu reisen, eine eigene politische Organisation aufzubauen und sich im Zwischenwahlkampf 2026 für andere Demokraten zu engagieren. Sie will mit den Wählern sprechen, ohne dass es „transaktional“ sei, also ohne direkt um ihre Stimme zu bitten. Dies ist der Versuch, sich von dem Image der Apparatschikin zu lösen und eine neue, authentischere Verbindung zur Basis aufzubauen – eine Vorbereitung für einen möglichen Präsidentschaftswahlkampf, ohne bereits offiziell im Rennen zu sein.
Im Schatten des Vorgängers: Das Trauma von 2024
Jeder Versuch von Kamala Harris, ihre politische Zukunft zu gestalten, wird unweigerlich vom langen Schatten der Vergangenheit eingeholt. Die Wahl von 2024 und die Rolle von Joe Biden sind die Geister, die sie nicht loswird. Die Quellen zeichnen das Bild einer Politikerin, die in eine „nahezu unmögliche Situation“ geworfen wurde. Nachdem Bidens Kandidatur nach einer desaströsen Debatte implodierte und Fragen nach seiner geistigen und körperlichen Eignung unüberhörbar wurden, musste sie in kürzester Zeit eine landesweite Kampagne aus dem Boden stampfen.
Diese unauflösliche Verbindung zu Biden ist heute ihre größte Hypothek. Während ihrer Zeit als Vizepräsidentin und auch in ihrer eigenen kurzen Kampagne ließ sie keinerlei Distanz zu ihm erkennen. Diese Loyalität wird ihr nun als Bürde ausgelegt. Viele Demokraten sind frustriert und wollen das Kapitel 2024 schließen, doch die Hauptfiguren bleiben im Rampenlicht und zwingen die Partei zur wiederholten Auseinandersetzung mit der Niederlage. Die Sehnsucht nach „etwas Frischem“ und neuen Gesichtern ist beinahe greifbar.
Die Partei selbst tut sich schwer mit einer ehrlichen Aufarbeitung. Der offizielle Untersuchungsbericht des Democratic National Committee (DNC) zur Wahl 2024 wird bereits im Vorfeld dafür kritisiert, dass er die heikelsten Fragen ausspart: die Entscheidung Bidens, überhaupt wieder anzutreten, und die chaotische Nachfolgeregelung nach seinem Rückzug. Der DNC-Vorsitzende argumentiert, eine solche Analyse bringe nichts, da man die Zeit nicht zurückdrehen könne – eine Haltung, die viele als Schutz der Etablierten und als Weigerung, aus Fehlern zu lernen, interpretieren. Solange die Partei diese grundlegenden Fragen nicht ehrlich beantwortet, bleibt Harris als letzte Repräsentantin dieses gescheiterten Tickets mit all den ungelösten Konflikten behaftet.
Die Zukunftsfrage: Eine Kandidatin ohne Botschaft?
Trotz ihrer hohen Bekanntheit und ihres Netzwerks an Spendern ist die Vorstellung einer erneuten Kandidatur von Harris im Jahr 2028 mit erheblicher Skepsis behaftet. Das zentrale Problem, das Kritiker immer wieder benennen, ist weniger ihre Bilanz als vielmehr ein wahrgenommenes Fehlen einer klaren, überzeugenden politischen Vision. Ein Meinungsbeitrag in der Washington Post formuliert es brutal: Der Hauptgrund für ihre Niederlage sei gewesen, dass sie „nichts Interessantes zu sagen hatte“. Sie sei, so der Vorwurf, „ganz auf die Stimmung aus“ gewesen, ohne erkennbare Überzeugungen oder große Regierungsideen. Dieses Imageproblem verfolgt sie seit ihrer bereits 2020 schnell gescheiterten ersten Präsidentschaftskandidatur.
Dieses Vakuum an Inhalten macht sie für viele zu einer wenig inspirierenden Figur in einer Zeit, in der die Wähler nach Neuem und einem klaren Bruch mit der Vergangenheit suchen. Die Annahme, sie könne als ehemalige Vizepräsidentin das Feld potenzieller Konkurrenten für 2028 einschüchtern und quasi automatisch zur Favoritin werden, wird als Trugschluss angesehen. Ambitionierte Demokraten wie die Gouverneure Tim Walz, Josh Shapiro oder Gavin Newsom bereiten längst ihre eigenen Kampagnen vor und werden sich kaum hinter Harris einreihen. Im Gegenteil: Eine Kandidatur von Harris würde die Partei zwingen, sich erneut mit der Frage auseinanderzusetzen, was 2024 schiefgelaufen ist – eine Debatte, die viele fürchten.
„Das System ist kaputt“: Die Kritikerin und die Partei
In ihrem Interview mit Stephen Colbert wählte Harris eine bemerkenswerte Formulierung, als sie ihre Entscheidung gegen das Gouverneursamt begründete: Das amerikanische politische System sei „kaputt“. Sie prangerte einen Kongress an, der „auf seinen Händen sitzt“, und eine Justiz, die dem Machtmissbrauch des Präsidenten nicht ausreichend entgegentritt. Diese scharfe Systemkritik aus dem Mund einer ehemaligen Vizepräsidentin ist ein rhetorischer Schwenk. Er kann als Versuch gelesen werden, sich vom Washingtoner Establishment, das sie jahrelang repräsentierte, zu distanzieren und sich als Außenseiterin neu zu erfinden.
Diese Kritik spiegelt zwar die Frustration vieler Wähler wider, birgt für Harris aber eine erhebliche Glaubwürdigkeitslücke. Als langjährige Senatorin, Generalstaatsanwältin und Vizepräsidentin ist sie selbst ein integraler Bestandteil jenes Systems, das sie nun anprangert. Ihre Worte wirken wie ein Echo auf die Unzufriedenheit in ihrer eigenen Partei, in der viele das Gefühl haben, dass die Führung den Kontakt zur Basis verloren hat. Doch ob es ihr gelingt, sich als glaubwürdige Erneuerin dieses Systems zu positionieren, ist fraglich. Sie läuft Gefahr, als Opportunistin wahrgenommen zu werden, die die Systemkritik erst dann für sich entdeckt, als sie selbst nicht mehr an den Schalthebeln der Macht sitzt.
Letztlich steht Kamala Harris vor einer Zerreißprobe. Ihr Versuch, durch die sorgfältige Inszenierung ihrer Memoiren und einen strategischen Rückzug aus der aktiven Politik eine neue Startrampe für 2028 zu bauen, ist ein ebenso mutiges wie riskantes Unterfangen. Sie muss die Partei davon überzeugen, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, ohne die Partei in eine endlose, selbstzerstörerische Aufarbeitung ebenjener Vergangenheit zu stürzen. Sie muss eine Vision für die Zukunft anbieten, die mehr ist als nur der Verweis auf ihren historischen Lebenslauf. Derzeit ist sie eine Figur im politischen Zwischenreich: nicht mehr nur die Vizepräsidentin von gestern, aber auch noch nicht die unbestrittene Anführerin von morgen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob ihr die Neuerfindung gelingt – oder ob sie als eine der zentralen Figuren einer verlorenen Ära in die Geschichte der Demokratischen Partei eingehen wird.