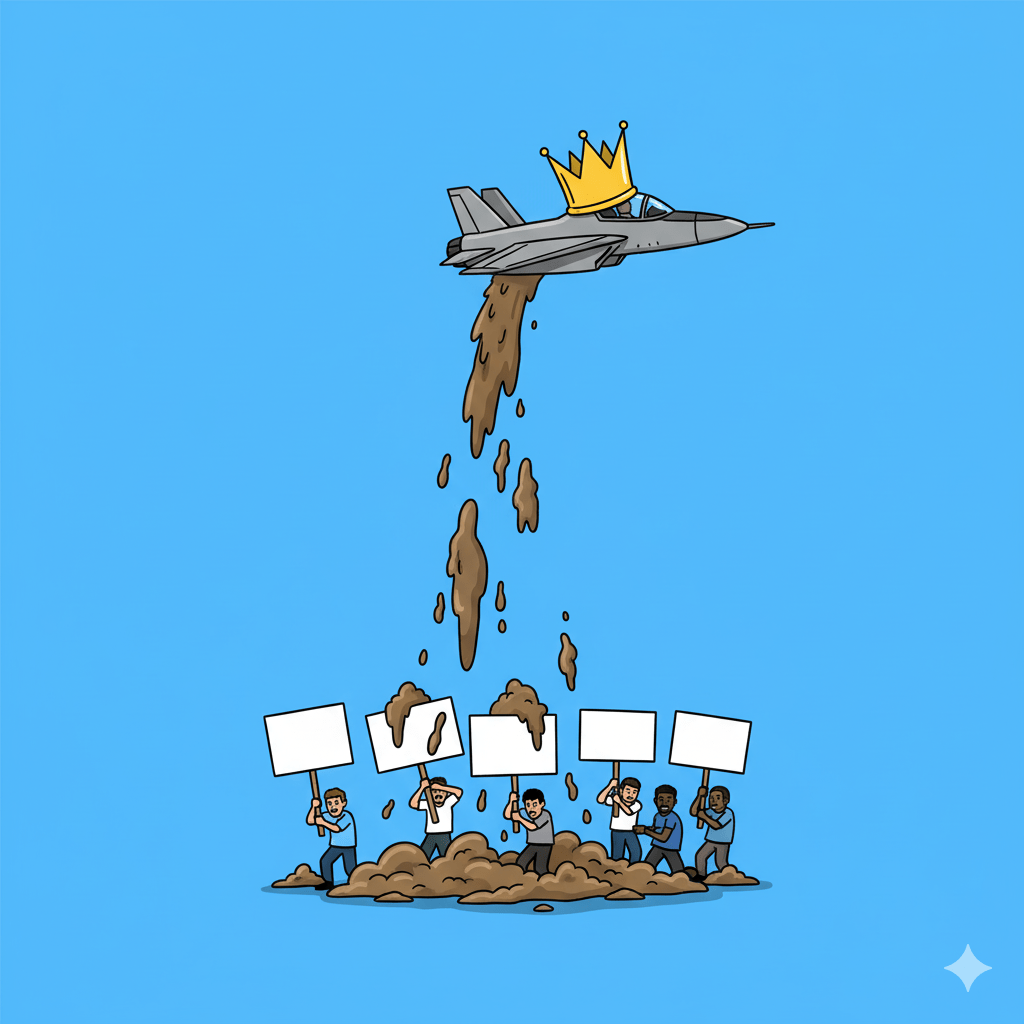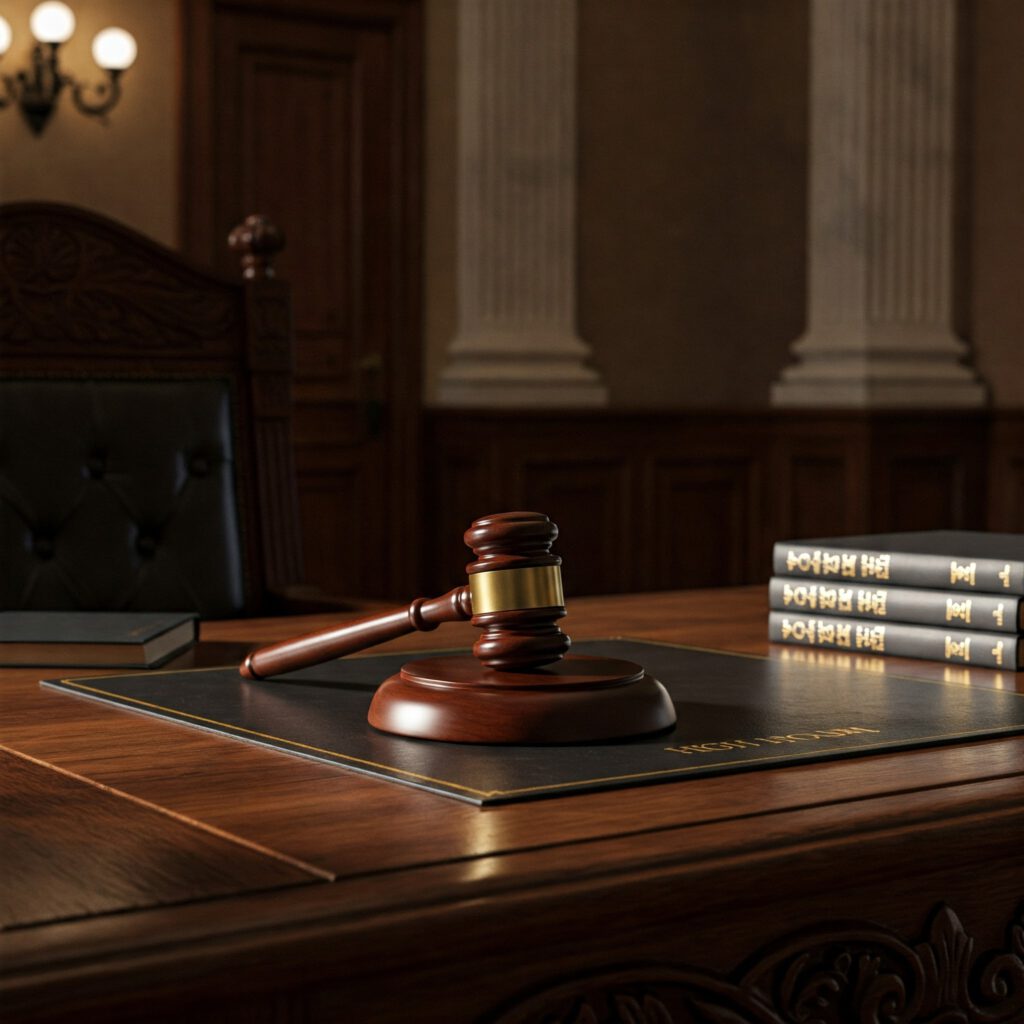Es ist ein Bild, das die amerikanische Wirtschaft im Herbst 2025 präziser beschreibt als jede Statistik der US-Notenbank: Wenige Meilen trennen in Chicago die glitzernde „Magnificent Mile“ von den Lebensmittelausgaben in ärmeren Stadtteilen. Hier die Boutiquen und Restaurants, gefüllt mit Dinern, die mühelos 20 Dollar für einen Cocktail bezahlen. Dort Menschen, die ihren Job auf dem Bau verloren haben und stundenlang anstehen für Lebensmittel, weil das Budget für ihre Familien nicht mehr reicht.
Dieser Kontrast ist mehr als die übliche soziale Ungleichheit; er ist der Schlüssel zum Verständnis einer tief gespaltenen Volkswirtschaft, die eine gefährliche, doppelte Fragilität entwickelt hat. Während die Makrodaten – das Bruttoinlandsprodukt, die Gesamtausgaben – eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit signalisieren, ist dies eine trügerische Stabilität. Sie wird fast ausschließlich vom reichsten Segment der Gesellschaft getragen. Die obersten zehn Prozent der Haushalte, beflügelt von Rekordständen an den Börsen, konsumieren so viel wie nie zuvor und zeichnen für fast die Hälfte aller Ausgaben verantwortlich.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Gleichzeitig erodiert das Fundament. Haushalte mit niedrigerem und mittlerem Einkommen, die von der persistenten Inflation und einem abkühlenden Arbeitsmarkt in die Zange genommen werden, schränken sich drastisch ein. Sie sind die unsichtbare Mehrheit in den Bilanzen, deren Realität von den glänzenden Schlagzeilen überdeckt wird.
In diesem Spannungsfeld agieren die politischen und monetären Akteure zunehmend erratisch. Die Trump-Administration versucht, die Realität durch kreative Mathematik umzudeuten, während die Federal Reserve in einem Dilemma gefangen ist, das keinen schmerzfreien Ausweg mehr kennt. Die USA erleben eine ökonomische Zweiteilung, die nicht länger nur ein soziales Ärgernis ist, sondern eine akute makroökonomische Bedrohung darstellt.
Das Dilemma der Währungshüter
Für die Führung der Federal Reserve gibt es keinen „risikofreien Pfad“ mehr. Die Zentralbank steckt in einer klassischen Zwickmühle. Seit nunmehr fünf Jahren liegt die Inflation hartnäckig über dem angestrebten Zwei-Prozent-Ziel. Die naheliegende Antwort – die Zinsen weiter hochzuhalten oder gar zu erhöhen, um den Preisdruck endgültig zu brechen – birgt das immense Risiko, den bereits ins Stottern geratenen Arbeitsmarkt vollends abzuwürgen. Doch der alternative Weg ist nicht minder gefährlich: Senkt die Fed die Zinsen, um den Arbeitsmarkt zu stützen, riskiert sie, daß sich die Inflation dauerhaft auf einem erhöhten Niveau festsetzt.
Die Fed-Führung scheint sich für das kleinere Übel entschieden zu haben. Angesichts eines deutlichen Einbruchs bei den Neueinstellungen im Sommer neigt sie offenbar dazu, die Risiken am Arbeitsmarkt höher zu gewichten als die der Inflation. Alles deutet darauf hin, daß die Fed Ende Oktober die Zinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr senken wird.
Es ist ein riskantes Spiel. Ökonomen warnen, daß diese Politik die Inflation auf einem Niveau „meilenweit“ über dem Ziel verankern könnte. Einige Inflationsmessgrößen, die volatile Posten wie Energie und Lebensmittel herausrechnen, zeigen sogar eine Beschleunigung auf 3,5 oder gar 3,9 Prozent. Die Fed bewegt sich auf dünnem Eis, und ihre wichtigste Währung – die Glaubwürdigkeit – steht auf dem Spiel.
Die 2,3-Prozent-Illusion: Wie das Weiße Haus die Inflation schönrechnet
Während die Fed mit der Realität ringt, hat sich die Trump-Administration für eine alternative Deutung entschieden. Präsident Trump verkündet, die Inflation sei „besiegt“. Das Weiße Haus verbreitet die Zahl einer „kühlen“ Inflationsrate von 2,3 Prozent – eine Zahl, die in krassem Widerspruch zu fast allen gängigen Messmethoden steht.
Wie kommt diese Zahl zustande? Sie ist das Ergebnis einer statistischen Methode, die man wohlwollend als unkonventionell bezeichnen muß. Statt des üblichen Vergleichs mit dem Vorjahresmonat – der Methode, die die Fed nutzt und die derzeit eine Rate von 2,9 Prozent ausweist (CPI) – nutzt die Regierung die sogenannte „Annualisierung“.
Konkret bedeutet dies: Man nimmt die Preisveränderungen der letzten sieben Monate (Januar bis August 2025) und rechnet diese auf ein ganzes Jahr hoch. Dieser Ansatz ist ökonomisch höchst unseriös. Sieben Monate sind ein viel zu kurzer Zeitraum, um eine valide Trendaussage zu treffen; kurzfristige Schwankungen, etwa durch Ölpreisschocks oder Lieferkettenprobleme, verzerren das Bild massiv.
Ein Blick zurück entlarvt die Willkürlichkeit dieser Methode: Hätte man im Oktober 2024 denselben Trick angewandt, hätte die annualisierte Rate bei 4,2 Prozent gelegen. Die tatsächliche 12-Monats-Inflation betrug damals jedoch lediglich 2,6 Prozent. Die 2,3-Prozent-Rate ist eine politische Zahl, geschaffen, um eine Erfolgsbotschaft zu transportieren, die der Realität nicht standhält.
Diese politische Nebelkerze wird verstärkt durch einen handfesten Mangel an Daten. Aufgrund eines „Government Shutdown“ verzögert sich die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, etwa die Arbeitsmarktzahlen für September oder die Inflationsdaten vom 15. Oktober. Die Fed, Ökonomen und Märkte müssen Entscheidungen treffen, während sie quasi im Nebel fliegen.
Zölle als Brandbeschleuniger? Der Streit um Trumps Wirtschaftsdogma
Der zweite Pfeiler der Wirtschaftspolitik des Weißen Hauses sind die umfassenden Zölle. Auch hier klafft eine tiefe Lücke zwischen der Einschätzung der Politik und der ökonomischen Analyse. Die Federal Reserve zeigt sich bislang relativ gelassen. Sie stuft die Zölle als einen „Einmaleffekt“ ein, der die Preise zwar kurzfristig anhebt, aber keine dauerhafte Inflationsspirale auslöst. Bisher, so die Analyse der Fed, seien die Auswirkungen der Zölle auf die Verbraucherpreise „gedämpfter“ ausgefallen als ursprünglich befürchtet.
Ökonomen widersprechen dieser Sichtweise vehement, allerdings auf einer anderen Ebene. Es geht ihnen weniger um den kurzfristigen Inflationsschub als um die langfristigen Wachstumskosten. Die Zölle, so der Konsens vieler Wirtschaftsexperten, zwingen die Wirtschaft, Ressourcen von produktiven Sektoren in weniger produktive umzuleiten. Sie wirken wie ein schleichendes Gift für die Produktivität. Konservative Schätzungen gehen davon aus, daß die Zölle das jährliche US-Wirtschaftswachstum um 0,4 bis 1,0 Prozentpunkte reduzieren. Das klingt nicht nach einer Katastrophe, aber über ein Jahrzehnt summiert sich der Wohlstandsverlust auf Tausende Dollar pro Kopf.
Und die Rechnung für die Konsumenten ist noch nicht vollständig beglichen. Bisher haben viele Unternehmen die Kosten absorbiert oder verzögert weitergegeben. Aktuellen Schätzungen zufolge tragen US-Konsumenten etwa 55 Prozent der Zollkosten. Dieser Anteil könnte jedoch bis Ende nächsten Jahres auf 70 Prozent ansteigen. Der wahre Preisschock durch die Zölle könnte also erst noch bevorstehen.
„Reversal of Fortune“: Das Auseinanderbrechen der Lohnentwicklung
Die Verwerfungen durch Inflation und Zölle treffen auf eine Bevölkerung, deren wirtschaftliche Realität fundamental gespalten ist. Das kurze Zeitfenster nach der Pandemie, in dem die Löhne für Geringverdiener dank des akuten Arbeitskräftemangels am schnellsten stiegen, ist definitiv geschlossen. Wir erleben ein „Reversal of Fortune“ – eine Umkehrung der Verhältnisse. Wie Daten der Atlanta Fed zeigen, verzeichnen nun die Geringverdiener das langsamste Lohnwachstum aller Gruppen. Diese Verlangsamung trifft auf persistente Inflation und einen Arbeitsmarkt, der seine Dynamik verloren hat.
Für Millionen Haushalte bedeutet dies eine brutale Realität: Sie müssen ihre Rechnungen zunehmend mit Schulden bezahlen. Die Nutzung von Kreditkarten und Autokrediten steigt. Zuerst werden „diskretionäre“ Ausgaben gestrichen. Doch Marktbeobachter warnen: „Wenn bereits alles Fett abgeschnitten ist, bleibt als Nächstes nur noch, die Essentials zu kürzen.“
Gleichzeitig heizt die Oberschicht die Wirtschaft weiter an. Gestützt durch Börsengewinne, füllen sie Business-Class-Flüge und kaufen Luxusgüter. Selbst führende Fast-Food-Konzerne stellen fest, daß die Besuche von Geringverdienern zweistellig eingebrochen sind, während das Geschäft in teuren Restaurants boomt.
Die Politik der Trump-Administration verschärft die Lage für die Schwächsten zusätzlich. Die Zölle treffen Farmer hart, und die rigide Einwanderungspolitik hat in bestimmten Stadtvierteln zu einer spürbaren Verlangsamung der lokalen Wirtschaft geführt. Berichten zufolge trauen sich Familien dort aus Angst vor Razzien kaum noch aus dem Haus, um selbst notwendige Besorgungen zu erledigen.
Die doppelte Fragilität: Amerikas Wirtschaft auf dünnem Eis
Diese extreme Zweiteilung der Wirtschaft ist nicht nur ein soziales Problem, sie ist ein akutes Stabilitätsrisiko. Beobachter, unter anderem von der Boston Fed, warnen vor einer „doppelten Fragilität“. Die erste Fragilität: Die gesamte US-Wirtschaft hängt am seidenen Faden des Konsums der Oberschicht. Sollte ein externer Schock – etwa ein Einbruch an den Aktienmärkten – diese Gruppe zum Sparen zwingen, würde die gesamte Nachfrage wie ein Kartenhaus zusammenfallen.
Die zweite Fragilität: Die Haushalte mit geringem Einkommen sind bereits am Limit. Sie haben keine Puffer mehr. Eine weitere Verschlechterung am Arbeitsmarkt, die durch eine zu aggressive Zinspolitik der Fed ausgelöst werden könnte, würde direkt zu Massenausfällen bei Krediten und einem sozialen Notstand führen.
Die menschlichen Kosten dieser Entwicklung sind bereits sichtbar. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist auf den höchsten Stand seit der Pandemie geklettert. Für viele, die ihren Job vor Monaten oder gar Jahren verloren haben, ist der Traum von einer schnellen Rückkehr geplatzt. Da sind etwa Akademiker mit Erfahrung im Finanzsektor, die trotz Umschulungen und Zertifikaten keinen neuen Job finden und sich nun als Uber-Fahrer durchschlagen, „gerade so über die Runden zu kommen“, unfähig zu sparen oder Schulden zu tilgen. Die makroökonomische Frage, ob die Wirtschaft „gut“ sei, beantwortet sich aus dieser Perspektive mit einer bitteren Gegenfrage: „Gut für wen?“.
Wenn das Vertrauen schwindet: Die Fed in der Glaubwürdigkeitsfalle
In diesem explosiven Gemisch ist das größte Kapital der Federal Reserve ihr Vertrauen. Und dieses Kapital schwindet. Die Fed hat bereits erheblich an Glaubwürdigkeit verloren, nachdem sie die Inflation zunächst als „vorübergehend“ abtat und das Zwei-Prozent-Ziel nun seit fünf Jahren verfehlt.
Warum ist dieses Vertrauen so entscheidend? Es ist eine klassische Sorge von Währungshütern: Wenn die Öffentlichkeit nicht mehr glaubt, daß die Zentralbank die Inflation auf zwei Prozent zurückbringen wird, ändert sie ihr Verhalten. Arbeitnehmer fordern höhere Löhne, um den erwarteten Kaufkraftverlust auszugleichen; Unternehmen setzen ihre Preise präventiv herauf. Dieser Wandel der Erwartungen kann eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in Gang setzen, die es für die Fed „viel schwerer macht, die Inflation zu senken.“
Selbst innerhalb der Fed wächst die Nervosität. Es mehren sich die Stimmen, die warnen, daß zwei weitere Jahre bis zur Zielerreichung „eine lange Zeit“ wären. Zunehmender Widerstand gegen einen zu lockeren Kurs wird signalisiert.
Das Ende der „Wunderjahre“: Warum Trumps alte Tricks nicht mehr funktionieren
Was wir derzeit erleben, ist mehr als ein zyklischer Abschwung. Es ist die schmerzhafte Rückkehr in eine ökonomische Normalität, die wir über ein Jahrzehnt lang vergessen hatten. Die Periode zwischen der Finanzkrise 2008 und der Pandemie 2020 war, historisch betrachtet, „seltsam“. Es war eine Zeit, in der die Gesetze der ökonomischen Schwerkraft außer Kraft gesetzt schienen: Die Regierung konnte massive Defizite anhäufen, die Geldpolitik war extrem locker, und trotzdem blieben Inflation und Zinsen wundersam niedrig.
Diese Ära ist vorbei. Das „alte Normal“ ist zurückgekehrt, und mit ihm die harten Zielkonflikte: zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, zwischen Schuldenmachen heute und höheren Zinsen morgen. Das ist die neue, bittere Realität, auf die die zweite Amtszeit von Donald Trump trifft. In seiner ersten Amtszeit (2017-2021) konnte er eine „fiskalisch unverantwortliche“ Politik fahren – massive Steuersenkungen, hohe Defizite –, ohne daß die Märkte ihn dafür bestraften. Die Zinsen blieben niedrig.
Dieser Trick funktioniert nicht mehr. Die enormen Ausgaben während der Pandemie, sowohl unter Trump als auch unter Biden, haben das System an seine Grenzen gebracht. Die Zinsen für Staatsanleihen und Hypotheken sind explodiert. Die Schuldenquote liegt bei rund 100 Prozent des BIP, und die Zinskosten für diese Schulden haben sich seit 2020 fast verdreifacht. Wenn das Weiße Haus nun von neuen Steuersenkungen im Volumen von fast 8 Billionen Dollar spricht, trifft dieser Plan auf eine Realität, die dafür keinen Spielraum mehr lässt. Die Ära, in der man sich aus Problemen einfach hinausdrucken oder -leihen konnte, ist an ihr Ende gekommen.
Die US-Wirtschaft balanciert im Herbst 2025 auf einem Hochseil, bei dem beide Enden des Seils ausfransen. Auf der einen Seite die Geringverdiener, deren finanzielle Belastbarkeit erschöpft ist. Auf der anderen Seite die Wohlhabenden, deren Konsum die Inflation antreibt und die Stabilität nur vorgaukelt. Die Frage ist nicht mehr ob etwas bricht, sondern was zuerst: das Vertrauen in die Geldpolitik, die Geduld der Armen oder die sorglose Konsumlaune der Reichen.