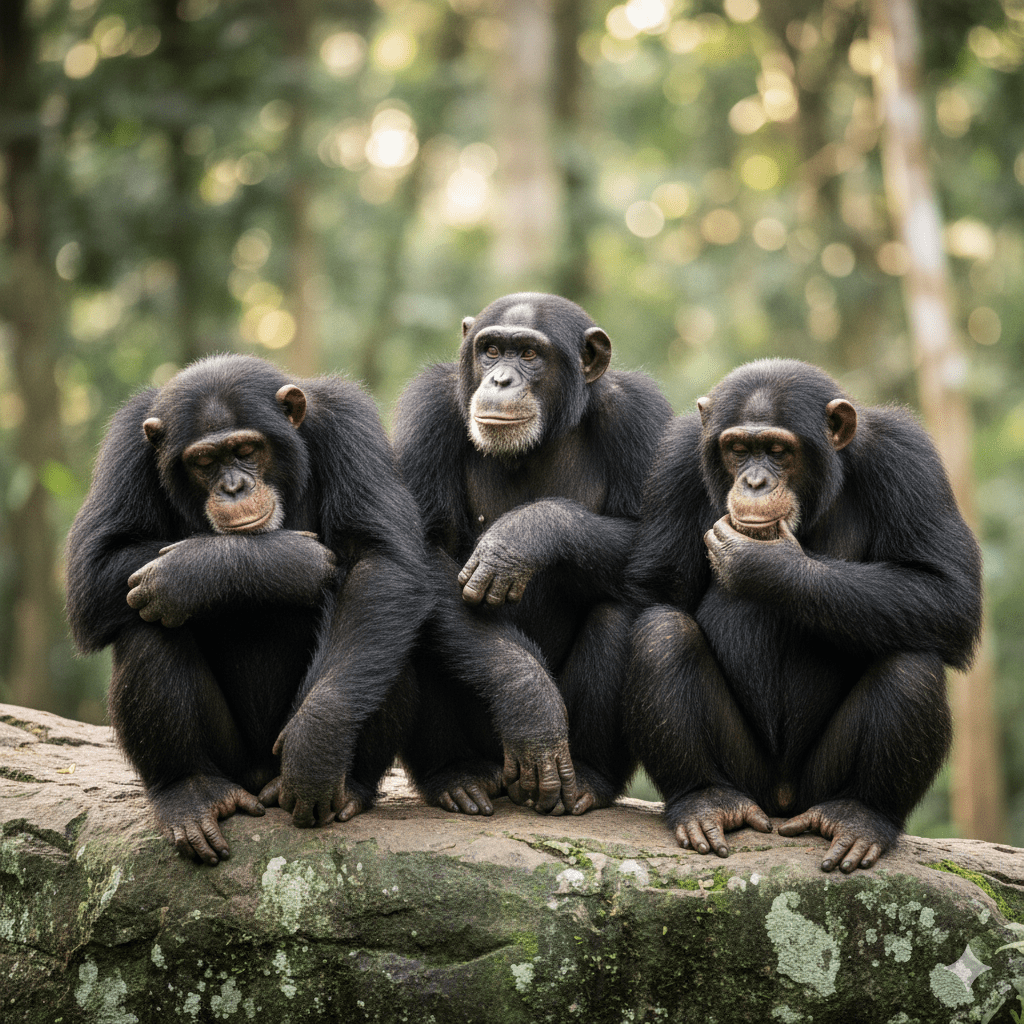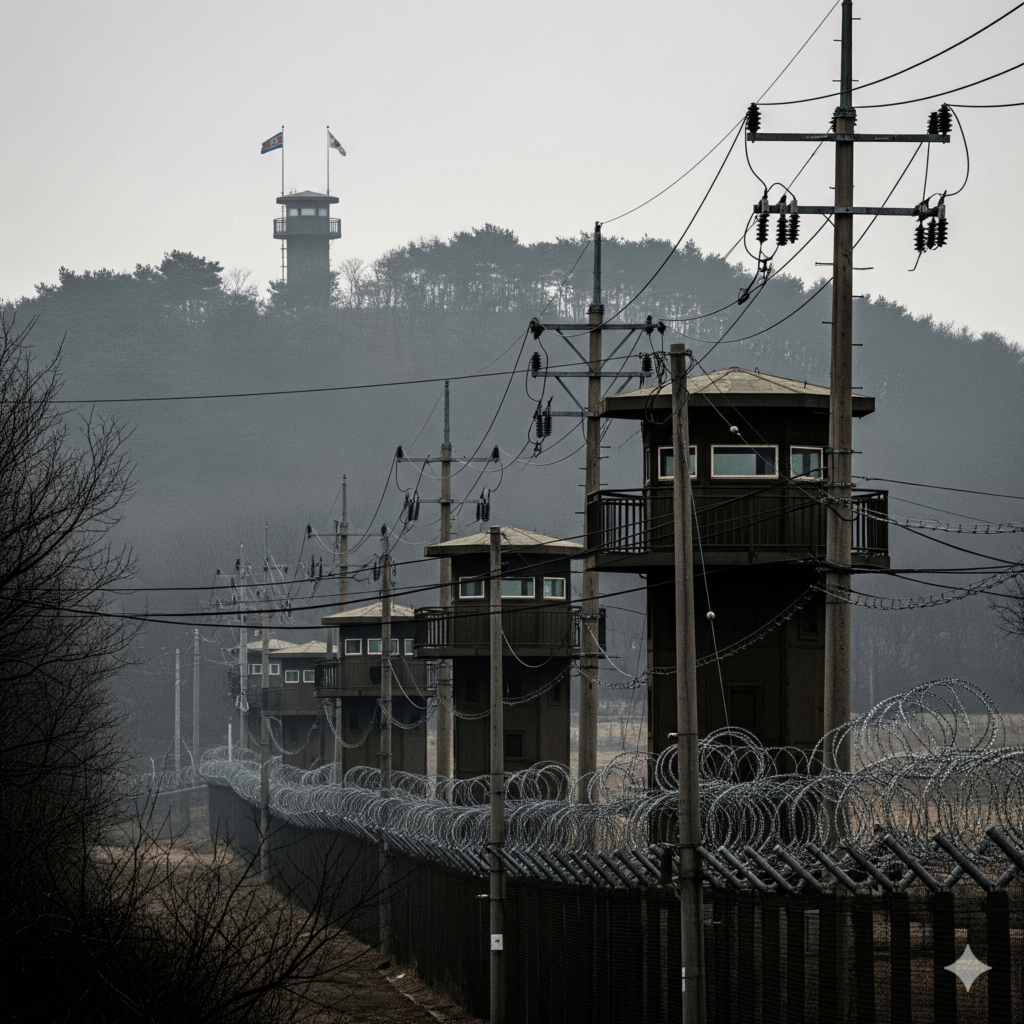Ein Interview ist ein Kampf um die Erzählung. Ein Ringen um die Deutungshoheit, ausgestrahlt zur besten Sendezeit. Doch was geschieht, wenn der Ringrichter selbst Teil des Kampfes ist? Donald Trumps jüngster Auftritt bei „60 Minutes“ war weniger ein Interview als eine vielschichtige Demonstration. Er enthüllte eine Präsidentschaft, die auf Transaktion statt Transparenz basiert – von der Begnadigung eines Krypto-Milliardärs mit direkten Geschäftsbanden zur Familie bis hin zur außenpolitischen Drohgebärde.
Die vielleicht größte Enthüllung des Abends kam jedoch nicht von Trump selbst, sondern vom Sender CBS. Durch das bewusste Herausschneiden brisanter Passagen – insbesondere jener, in denen Trump mit einem millionenschweren Vergleich gegen die Muttergesellschaft des Senders prahlte – entlarvte der Sender vor allem die eigene Verstrickung und eine journalistische Kapitulation im Umgang mit der Macht.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Schnitt: Wie CBS die Geschichte über sich selbst zensierte
Der eigentliche Skandal des „60 Minutes“-Auftritts lag in der Stille; in dem, was die Zuschauer nicht sehen durften. CBS strahlte nur 27 Minuten eines fast 73-minütigen Gesprächs aus. Ausgespart wurde nicht nur ein hitziger Wortwechsel über die Begnadigung des Binance-Gründers Changpeng Zhao. Es fehlte vor allem jene Passage, in der Trump sich brüstete, die ehemalige CBS-Muttergesellschaft Paramount zu einer Vergleichszahlung von 16 Millionen Dollar gezwungen zu haben.
Diese redaktionelle Entscheidung ist weit mehr als eine kosmetische Kürzung zur Straffung der Sendezeit. Sie ist ein medienethisches Desaster. Der zeitliche Kontext ist hierbei entscheidend: Der Vergleich wurde im Juli geschlossen, just als Paramount die Genehmigung der Trump-Administration für eine strategisch entscheidende Fusion mit Skydance anstrebte – einem Unternehmen, das von einem Trump-Verbündeten geführt wird.
Wirft dieser 16-Millionen-Dollar-Vergleich im Schatten einer angestrebten Fusion Fragen zur journalistischen Unabhängigkeit von „60 Minutes“ auf? Er tut mehr als das; er schreit sie heraus. Wenn ein Sender, der den Präsidenten zu Amtsverfehlungen befragen soll, selbst in einem derart massiven finanziellen und regulatorischen Abhängigkeitsverhältnis zu ebendiesem Präsidenten stand, ist die Integrität der Berichterstattung fundamental kompromittiert.
Das Weglassen dieser Information ist keine Lappalie. Es ist der Versuch, die eigene Verwundbarkeit, die eigene Verstrickung aus der öffentlichen Wahrnehmung zu tilgen. Indem CBS auch Trumps Lob für die neue Chefredakteurin Bari Weiss entfernte – eine Personalie, die nach der Skydance-Übernahme und dem Vergleich erfolgte –, zementierte der Sender den Eindruck, er wolle jede Debatte über seine eigene, potenziell gekaufte Neutralität im Keim ersticken. Für die öffentliche Wahrnehmung ist dies verheerend: Wie soll ein Sender die Verflechtungen des Präsidenten glaubwürdig aufdecken, wenn er die eigenen derart offensiv verschleiert?
„Pay-for-Play“? Die trüben Gewässer der Zhao-Begnadigung
Das Schweigen des Senders trifft auf die Vernebelung des Präsidenten. Im Zentrum des Interviews stand die Kontroverse um die Begnadigung von Changpeng Zhao, dem milliardenschweren Gründer der Krypto-Börse Binance. Zhao hatte sich 2023 schuldig bekannt, massive Geldwäsche ermöglicht zu haben. Finanzministerin Janet Yellen sprach von „vorsätzlichem Versagen“, das es Terroristen, Cyberkriminellen und Kinderschändern erlaubt habe, Geld über die Plattform zu bewegen.
Auf die Frage nach dem „Anschein von Korruption“ angesichts dieser Begnadigung reagierte Trump mit einer Behauptung, die an der Realität zerschellt: „Ich weiß nicht, wer er ist.“ Diese Unwissenheit ist angesichts der Faktenlage kaum glaubwürdig. Erst im Mai kündigte Trumps eigenes Krypto-Familienunternehmen, World Liberty Financial, einen milliardenschweren Deal an, bei dem Binance als Partner fungiert. Parallel dazu heuerte Zhao für sein Begnadigungsgesuch gezielt Lobbyisten mit besten Verbindungen zur Trump-Administration an. Die parallele Nutzung von politischem Lobbying und direkten Geschäftsabschlüssen mit der Trump-Familie zeichnet das Bild eines klassischen Zielkonflikts. Es ist der Inbegriff des „Pay-for-Play“-Vorwurfs: Ein Gefallen des Präsidenten (die Begnadigung) scheint auf eine Gegenleistung (der Deal) zu treffen.
Trumps Verteidigungsstrategie ist dabei ebenso entlarvend wie durchschaubar. Er bezeichnete Zhaos Strafverfolgung als „Biden-Hexenjagd“ und zog eine direkte Parallele zu seiner eigenen Verurteilung in New York. Dies ist eine politische Judo-Technik: Trump versucht, die Schwere von Zhaos Verbrechen – immerhin die Duldung von Terrorfinanzierung – zu relativieren, indem er sie mit seinen eigenen rechtlichen Problemen gleichsetzt und beide als politisch motivierte Verfolgung durch seine Gegner darstellt. Er stilisiert sich und den Krypto-Milliardär zu Opfern desselben Systems.
Gleichzeitig offenbart Trump einen kalkulierten Spagat in seiner Haltung zur Krypto-Industrie. Einerseits behauptet er: „Ich weiß sehr wenig darüber“, und distanziert sich persönlich. Andererseits warnt er, die Branche könne nach China abwandern, und unterzeichnete mit dem „Genius Act“ das erste große Regulierungsgesetz, um Krypto in den USA zu verankern. Diese Diskrepanz ist keine Verwirrung, sie ist eine Strategie: persönliche Distanzierung zur Vermeidung von Haftung, bei gleichzeitiger politischer Umarmung einer finanzstarken Industrie.
Die Heimat als Kampfzone: Shutdown und „liberale Richter“
Von den schattigen Korridoren der Finanzwelt bewegte sich das Gespräch zur harten Realität der amerikanischen Innenpolitik – und zu einem Präsidenten, der den „Government Shutdown“ als Druckmittel instrumentalisiert. Trump wies jede Verantwortung für den Stillstand, der Hunderttausende Bundesangestellte ohne Gehalt zurücklässt, von sich und machte ausschließlich die Demokraten verantwortlich.
Seine Strategie zur Beendigung der Blockade? Die Drohung, den „Filibuster“ im Senat abzuschaffen – jene Regel, die für die meisten Gesetze eine 60-Stimmen-Mehrheit erfordert. Wie realistisch dieser Plan ist, steht auf einem anderen Blatt. Es ist ein politisches Druckmittel, das primär ins Leere läuft, da führende Republikaner im Kongress diese „nukleare Option“ strikt ablehnen. Sie fürchten, die Regel selbst zu benötigen, sobald sie wieder in der Minderheit sind. Trumps Drohung ist somit weniger ein Plan als eine Machtdemonstration gegenüber der eigenen Partei.
Noch härter fiel seine Rhetorik in der Migrationspolitik aus. Konfrontiert mit Berichten über aggressive Taktiken der ICE-Behörden – Tränengas in Wohngebieten, eingeschlagene Autoscheiben –, verteidigte Trump das Vorgehen und erklärte, die Razzien seien „nicht weit genug gegangen“. Die Schuld für jede Zurückhaltung wies er „liberalen Richtern“ zu, die von seinen Vorgängern eingesetzt wurden.
Diese Argumentation ist mehr als nur eine Verteidigung harter Law-and-Order-Politik; sie ist ein Angriff auf die Gewaltenteilung. Indem Trump die Justiz als parteiischen, liberalen Block darstellt, der die legitime Arbeit der Exekutive blockiert, untergräbt er das rechtsstaatliche Verfahren bei Abschiebungen und signalisiert seinen Behörden, dass richterliche Kontrolle ein Ärgernis sei, das es zu umgehen gilt.
Hierbei offenbart sich der tiefste Widerspruch seiner Politik. Während er eine kompromisslose Abschiebungspolitik fordert, die explizit auch Menschen ohne kriminellen Hintergrund einschließt, merkte er im selben Interviewkontext an, dass er Arbeitskräfte brauche, „Landschaftsgärtner und Farmer mehr als jeder andere“. Es ist eine Politik, die den Ast absägt, auf dem ein Teil der US-Wirtschaft sitzt: die Dämonisierung und Ausweisung genau jener Arbeitskräfte, deren Fehlen er an anderer Stelle beklagt.
Globale Drohgebärden: Von Venezuela bis zu Atomtests
Die innenpolitische Härte spiegelt sich in einer globalen Rhetorik der Stärke, die gezielt mit der Unberechenbarkeit spielt. Auf die Frage nach einem möglichen Krieg oder Landangriff auf Venezuela antwortete Trump ausweichend: „Ich bezweifle es“, um kurz darauf zu bestätigen, dass die Tage des venezolanischen Präsidenten Maduro „gezählt“ seien. Es ist ein Vabanquespiel aus Drohung und Dementi, untermauert von einer massiven Militärpräsenz vor der Küste des Landes. Besonders brisant ist die rechtliche Position seiner Administration. Ein Anwalt des Justizministeriums erklärte, dass die für Militäraktionen geltende 60-Tage-Frist zur Einholung der Kongresszustimmung nicht für Schläge gegen mutmaßliche Drogenkartelle gelte. Dies ist eine rechtliche Grauzone, die der Exekutive quasi einen Freifahrtschein ausstellt, militärisch in Ländern wie Venezuela zu operieren, ohne die Legislative einzubinden, und die Tür für unabsehbare Eskalationen öffnet.
Den außenpolitischen Paukenschlag des Interviews bildete jedoch Trumps Ankündigung, die USA würden nach über 30 Jahren die Atomtests wieder aufnehmen. Selbst als sein Energieminister versuchte, dies als nicht-explosive Waffentests zu relativieren, blieb Trump bei seiner Wortwahl der „Detonation“. Als Begründung führte er die unbelegte Behauptung an, Russland und China würden verdeckt ebenfalls Atomwaffen testen. Dies widerspricht allen vorliegenden Erkenntnissen: China hat seit 1996, Russland seit 1990 keine bestätigten Tests durchgeführt. Trump zerreißt hier ein jahrzehntealtes Tabu der globalen Rüstungskontrolle, basierend auf einem Trugbild. Die Auswirkungen auf die globale Stabilität, insbesondere im Verhältnis zu Nordkorea und den etablierten Atommächten, sind kaum zu ermessen. Er riskiert ein neues Wettrüsten, begründet mit alternativen Fakten.
Am Ende des Abends bleibt ein tiefes Gefühl der Unschärfe. Das „60 Minutes“-Interview war kein journalistischer Fehlschlag; es war ein Erfolg darin, den wahren Zustand der Politik und der Medien im Jahr 2025 zu illustrieren. Es enthüllte einen Präsidenten, für den Politik und persönlicher Profit untrennbar sind, der Begnadigungen als Verhandlungsmasse und die Justiz als politischen Gegner sieht. Und es enthüllte ein Mediensystem, repräsentiert durch CBS, das in seinem Ringen um Zugang und angesichts eigener wirtschaftlicher Verflechtungen so sehr Teil des Systems geworden ist, dass es seine eigene Kontrollfunktion opfert. Die lauteste Botschaft des Abends waren nicht Trumps Worte, sondern die Stille des Senders über den 16-Millionen-Dollar-Vergleich.