
Fünfzig Jahre nach dem Skandal, der Amerika erschütterte, zeichnet sich ein noch düstereres Bild ab. Donald Trumps Präsidentschaft ist nicht nur eine Wiederholung der Geschichte, sondern ihre radikale Eskalation – mit dem Unterschied, dass die Schutzmechanismen der Demokratie heute versagen.
Es gibt Momente in der Geschichte einer Nation, die sich wie tiefe Narben in das kollektive Gedächtnis einbrennen. Watergate war ein solcher Moment. Der Einbruch in das Hauptquartier der Demokratischen Partei am 17. Juni 1972 war weit mehr als nur ein „drittklassiger Einbruch“, wie ihn das Weiße Haus damals abzutun versuchte. Er war der Anfang vom Ende einer Präsidentschaft und der Beginn einer Ära des Misstrauens, die bis heute nachwirkt. Watergate wurde zum Synonym für Machtmissbrauch, politische Paranoia und den systematischen Versuch, die Grundpfeiler der amerikanischen Demokratie zu untergraben.
Fünfzig Jahre später steht Amerika erneut vor einem Abgrund, der vielen tiefer erscheint als der damalige. Die Präsidentschaft von Donald Trump wird in zahlreichen Analysen nicht nur als Echo der Nixon-Jahre gesehen, sondern als deren gefährliche Überbietung. Die Parallelen sind frappierend: zwei Präsidenten, getrieben von einem tiefen Misstrauen gegenüber ihren Gegnern, einer Obsession mit der Presse als „Feind“ und der Überzeugung, dass der Zweck die Mittel heiligt. Beide, Nixon wie Trump, waren Außenseiter, die sich an einem liberalen Establishment rieben und ihre Macht mit einer Mischung aus Rachsucht und dem ständigen Gefühl, belagert zu werden, ausübten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch wo Nixon im Verborgenen agierte, seine Verbrechen in nächtlichen Einbrüchen und geheimen Tonbandaufnahmen versteckte, zelebriert Trump den Tabubruch im grellen Licht der Öffentlichkeit. Seine Angriffe auf die Justiz, die Medien und den Wahlprozess sind keine heimlichen Operationen, sondern fester Bestandteil seiner politischen Inszenierung. Und genau hier liegt der entscheidende und beunruhigende Unterschied: Nixon scheiterte an funktionierenden Institutionen. Ein überparteilicher Kongress, eine mutige Presse und eine unabhängige Justiz zogen eine rote Linie und zwangen einen Präsidenten zum ersten Mal in der Geschichte der USA zum Rücktritt. Heute scheinen diese Schutzwälle erodiert, porös geworden durch eine extreme politische Polarisierung, die es einem Präsidenten ermöglicht, Handlungen zu begehen, die Nixons Vergehen in den Schatten stellen, ohne vergleichbare Konsequenzen fürchten zu müssen.
Die zentrale These, die sich aus der Betrachtung dieser beiden Präsidentschaften aufdrängt, ist daher alarmierend: Die Gefahr für die amerikanische Demokratie geht heute weniger von der Wiederholung der Watergate-Methoden aus, sondern von der Tatsache, dass die nach Watergate geschaffenen Lehren und Sicherungen ihre Wirksamkeit verloren haben. Trump agiert in einem politischen Umfeld, in dem die Grenzen des Sag- und Machbaren so weit verschoben wurden, dass selbst die dreistesten Angriffe auf den Rechtsstaat von weiten Teilen seiner Partei und seiner Anhängerschaft nicht nur toleriert, sondern gefeiert werden. Watergate war eine Verfassungskrise, die das System am Ende überlebte und gestärkt daraus hervorging. Die aktuelle Krise, so die Sorge vieler Beobachter, könnte das System selbst an den Rand des Zusammenbruchs führen, weil der parteiübergreifende Konsens darüber, was eine Demokratie ausmacht und was sie bedroht, zerbrochen ist.
Die Anatomie des Machtmissbrauchs: Von verdeckter Sabotage zu offener Aufwiegelung
Um die Eskalation zu verstehen, muss man die Werkzeuge des Machtmissbrauchs beider Präsidenten vergleichen. Richard Nixon führte einen verdeckten Krieg gegen seine politischen Gegner. Sein Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten (CRP) finanzierte eine Schattenarmee von Spionen und Saboteuren. Die Methoden waren kriminell, aber konventionell: Abhöraktionen, Einbrüche, Desinformationskampagnen. Das Ziel war es, die Opposition zu schwächen und die Wiederwahl 1972 zu sichern, indem man den als am gefährlichsten eingeschätzten demokratischen Kandidaten, Edmund Muskie, gezielt demontierte. All das geschah im Geheimen. Die Aufdeckung war der Skandal.
Donald Trump hingegen hat die Taktik geändert. Seine Angriffe benötigen keine „Klempner“-Einheit, die im Dunkeln agiert. Sein mächtigstes Werkzeug ist die öffentliche Bühne: Twitter-Feeds, Wahlkampfveranstaltungen und die Pressekonferenzen im Weißen Haus. Anstatt heimlich das Justizministerium zu beeinflussen, wie Nixon es mit der CIA versuchte, um die FBI-Ermittlungen zu behindern, fordert Trump seine Generalstaatsanwältin öffentlich zur Strafverfolgung seiner politischen Feinde auf. Er bezeichnet die freie Presse nicht in internen Memos, sondern vor laufenden Kameras als „Feind des Volkes“. Der größte Unterschied aber manifestierte sich im Umgang mit dem Wahlprozess. Während Nixon die Wahl 1972 durch verdeckte Sabotage zu seinen Gunsten manipulierte, versuchte Trump, das Ergebnis der Wahl 2020, die er verloren hatte, nachträglich und offen zu kippen. Sein Druck auf Wahlbeamte in den Bundesstaaten, die Anstiftung zur Gewalt am 6. Januar 2021 und der Versuch, seinen Vizepräsidenten dazu zu bringen, die Bestätigung des Wahlergebnisses zu blockieren, stellen einen direkten Angriff auf den Kern der Demokratie dar – die friedliche Machtübergabe. Woodward und Bernstein, die Reporter, die den Watergate-Skandal aufdeckten, kommen zu dem Schluss, dass Trump damit der erste „aufrührerische Präsident“ in der Geschichte der USA ist – eine Grenzüberschreitung, die selbst Nixon nicht gewagt hatte.
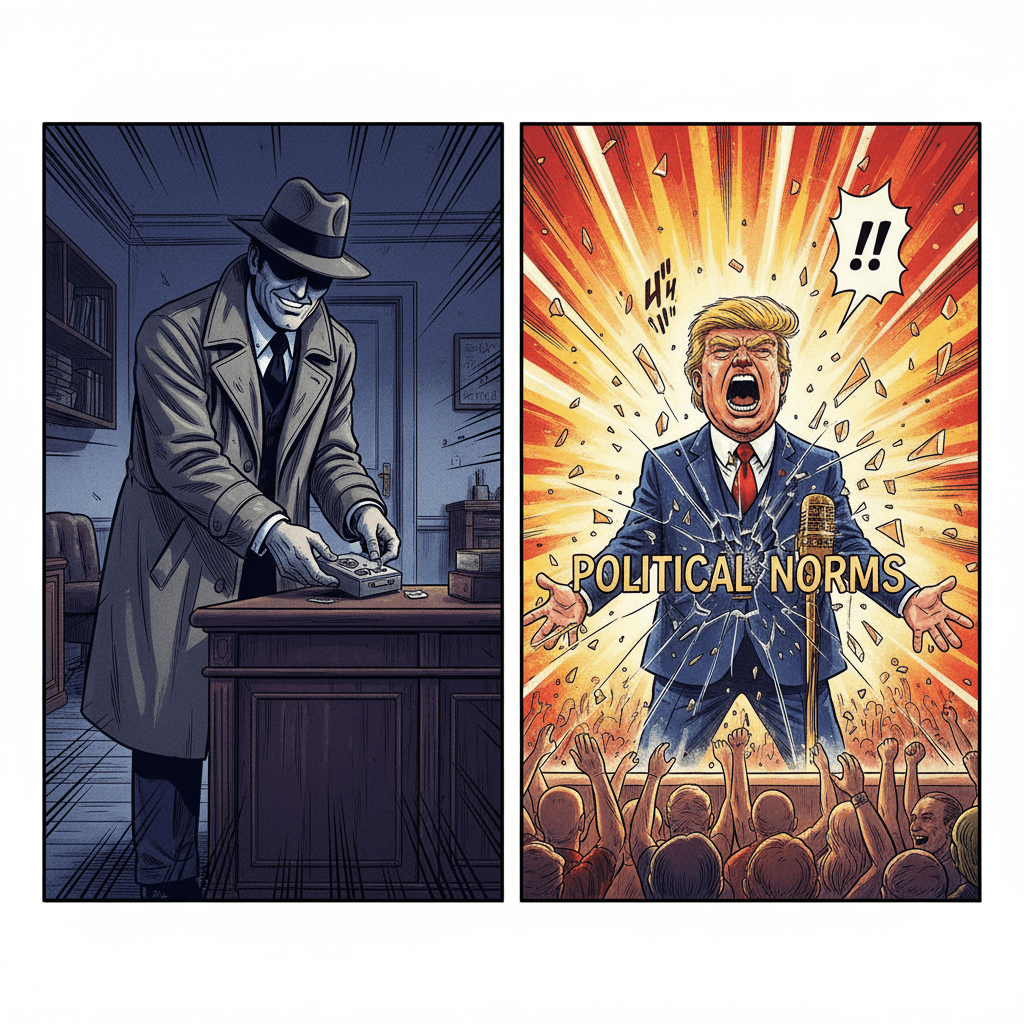
Die erodierten Schutzwälle: Warum die Lehren aus Watergate verhallen
Nach Nixons Rücktritt erlebte Amerika eine beispiellose Phase der Reformen, in der der Kongress eine ganze Reihe von Gesetzen verabschiedete, die eine Wiederholung von Watergate verhindern sollten. So schuf der Ethics in Government Act von 1978 neue Transparenzpflichten für Regierungsbeamte und etablierte das System der unabhängigen Sonderermittler. Um zu verhindern, dass ein Präsident unliebsame Programme durch das Einfrieren bewilligter Gelder aushungern konnte – eine Taktik, die Nixon exzessiv genutzt hatte –, wurde der Impoundment Control Act von 1974 erlassen. Gleichzeitig sollten neue Gesetze zur Wahlkampffinanzierung den Einfluss von verdeckten und illegalen Spenden eindämmen. Um den Missbrauch der Geheimdienste für innenpolitische Zwecke zu unterbinden, richtete der Kongress zudem ständige Geheimdienstausschüsse zur Überwachung von CIA und FBI ein. Schließlich wurden unabhängige Generalinspekteure in den Ministerien installiert, die Korruption und Machtmissbrauch von innen heraus bekämpfen sollten.
Diese Reformen bildeten für fast 50 Jahre das ethische und rechtliche Rückgrat der amerikanischen Regierung. Unter Donald Trump jedoch wurde dieses System systematisch ausgehöhlt. Er hat zahlreiche Generalinspekteure entlassen, die ihm zu kritisch erschienen. Er hat den Impoundment Control Act missachtet, indem er Gelder für von ihm abgelehnte Programme blockierte. Die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung wurden bereits vor ihm durch Gerichtsentscheidungen wie Citizens United aufgeweicht, aber unter ihm hat die Vermischung von privaten Geschäftsinteressen und öffentlichem Amt eine neue Dimension erreicht.
Warum aber erweisen sich diese Schutzmechanismen als so fragil? Die Antwort liegt in der veränderten politischen Landschaft. Die Reformen der 1970er Jahre basierten auf der Annahme, dass es einen parteiübergreifenden Konsens über die Unantastbarkeit demokratischer Normen gibt. Damals waren es führende Republikaner wie Senator Barry Goldwater, die Nixon ins Gewissen redeten und ihm klarmachten, dass er im Senat keine Unterstützung mehr hatte, was letztlich seinen Rücktritt besiegelte.
Heute ist ein solches Szenario kaum vorstellbar. Die Republikanische Partei hat sich von einer Partei, die einen ihrer eigenen Präsidenten zum Rücktritt zwang, zu einer Partei gewandelt, die ihrem Präsidenten selbst bei den schwersten Vorwürfen die Treue hält. Die Angst vor der eigenen Wählerbasis und vor einem Vergeltungsschlag des Präsidenten ist größer als die Sorge um die Verfassung. Ein republikanischer Senator formulierte es treffend: „Wir haben alle Angst“. Diese bedingungslose Loyalität lähmt den Kongress als Kontrollinstanz und macht viele der Post-Watergate-Gesetze zahnlos. Wenn der politische Wille fehlt, Gesetze durchzusetzen, werden selbst die besten Regeln zu totem Buchstaben.
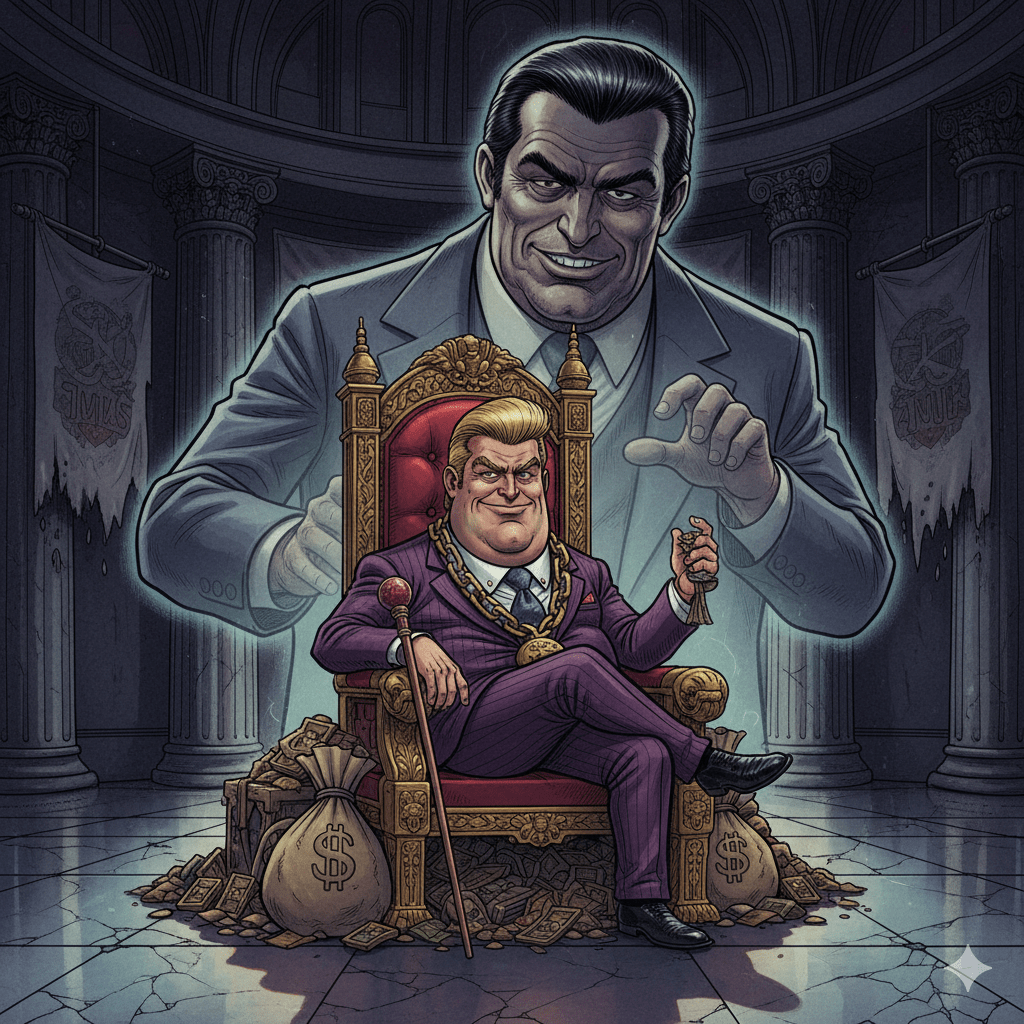
Psychogramme der Macht: Die Gemeinsamkeiten von Nixon und Trump
Hinter dem politischen Handeln stehen oft persönliche Antriebe. Sowohl Nixon als auch Trump teilen eine Persönlichkeitsstruktur, die sie für Machtmissbrauch prädestiniert. Beide nährten ein tiefes Gefühl, von einem feindseligen Establishment verachtet zu werden. Nixon sah sich von den liberalen Eliten der Ostküste und den von ihnen kontrollierten Medien bekämpft. Trump inszeniert sich als Kämpfer gegen den „tiefen Staat“, die „Fake News Medien“ und eine globalistische Elite. Diese Weltsicht, die alles in Freunde und Feinde einteilt, schafft ein Klima der permanenten Belagerung im Weißen Haus und rechtfertigt außergewöhnliche Maßnahmen.
Nixon dokumentierte seine Paranoia auf den berüchtigten Tonbändern, auf denen er über die Zerstörung seiner Gegner fantasierte und die Presse als „Feind“ bezeichnete. Trump tut dies täglich und öffentlich. Seine ständige Tirade über „Hass“, den er bei seinen politischen Gegnern zu erkennen glaubt, wirkt wie eine Projektion seiner eigenen Emotionen und treibt seine Anhänger an. Ein zentraler Satz Nixons, der sein politisches Überleben beschrieb, lautete: „Ein Mann ist nicht erledigt, wenn er besiegt ist. Er ist erledigt, wenn er aufgibt.“ Es ist ein Mantra, das Trump perfektioniert hat. Seine Weigerung, die Wahlniederlage 2020 einzugestehen, ist der ultimative Ausdruck dieses Willens, niemals aufzugeben, selbst wenn es die Zerstörung demokratischer Normen bedeutet.
Die entscheidende Triebfeder für beide scheint die Angst vor dem Verlieren zu sein, die Angst, als „Verlierer“ dazustehen. Diese Angst rechtfertigt in ihren Augen fast jedes Mittel. Nixon ließ eine Wahl manipulieren, um eine demütigende Niederlage zu vermeiden. Trump versuchte, eine vollzogene Niederlage ungeschehen zu machen. In beiden Fällen stand die persönliche Macht über dem nationalen Interesse. Nixons berühmtes Zitat aus einem Interview mit David Frost – „Wenn der Präsident es tut, bedeutet das, dass es nicht illegal ist“ – fasst diese Haltung perfekt zusammen. Es ist eine Logik, die Trump nicht nur teilt, sondern zur Grundlage seiner gesamten Präsidentschaft gemacht hat.
Die veränderte Rolle der Institutionen: Justiz, Medien und die Öffentlichkeit
Der Ausgang des Watergate-Skandals war ein Triumph der Institutionen. Die Washington Post mit Bob Woodward und Carl Bernstein grub unermüdlich Fakten aus, oft gestützt durch ihre geheimnisvolle Quelle „Deep Throat“, den späteren FBI-Vizedirektor Mark Felt. Richter John Sirica setzte die Angeklagten unter Druck, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sonderermittler Archibald Cox forderte unnachgiebig die Herausgabe der Tonbänder, was zu seiner Entlassung in der „Saturday Night Massacre“ führte – ein Ereignis, das die öffentliche Empörung weiter anheizte und das Ende von Nixons Präsidentschaft beschleunigte. Und schließlich fällte der Supreme Court eine einstimmige Entscheidung gegen den Präsidenten.
Heute ist die Lage eine andere. Die Medien sind zwar investigativer als je zuvor, aber ihre Wirkung ist durch die extreme Fragmentierung und Politisierung der Öffentlichkeit geschwächt. Was in der New York Times oder der Washington Post als Skandal enthüllt wird, wird bei Fox News und in der rechten Blogosphäre als parteiische Hexenjagd abgetan. Es gibt keine gemeinsame Faktenbasis mehr, auf die sich die Gesellschaft einigen kann.
Auch die Justiz agiert in einem veränderten Klima. Der von Trump geprägte Supreme Court hat in jüngsten Entscheidungen die Macht der Exekutive gestärkt und die Möglichkeiten richterlicher Kontrolle eingeschränkt. Die Vorstellung, dass das höchste Gericht einstimmig gegen einen Präsidenten der eigenen Partei entscheidet, erscheint heute vielen als unwahrscheinlich.
Die größte Veränderung aber hat die öffentliche Wahrnehmung erfahren. Der Schock über die Verfehlungen Nixons war echt und tiefgreifend. Heute herrscht eine gewisse Abstumpfung gegenüber Skandalen. Die ständige Flut von Vorwürfen und Enthüllungen während der Trump-Jahre hat zu einer Ermüdung geführt. Was früher einen Aufschrei ausgelöst hätte, wird heute oft nur noch mit einem Schulterzucken quittiert. Dieser Wandel in der politischen Kultur ist vielleicht die gefährlichste Entwicklung von allen. Er schafft ein Umfeld, in dem ein Präsident wie Nixon heute wahrscheinlich im Amt bleiben würde, weil die Empörung nicht mehr ausreichen würde, um die Mauern der parteipolitischen Loyalität zu durchbrechen.
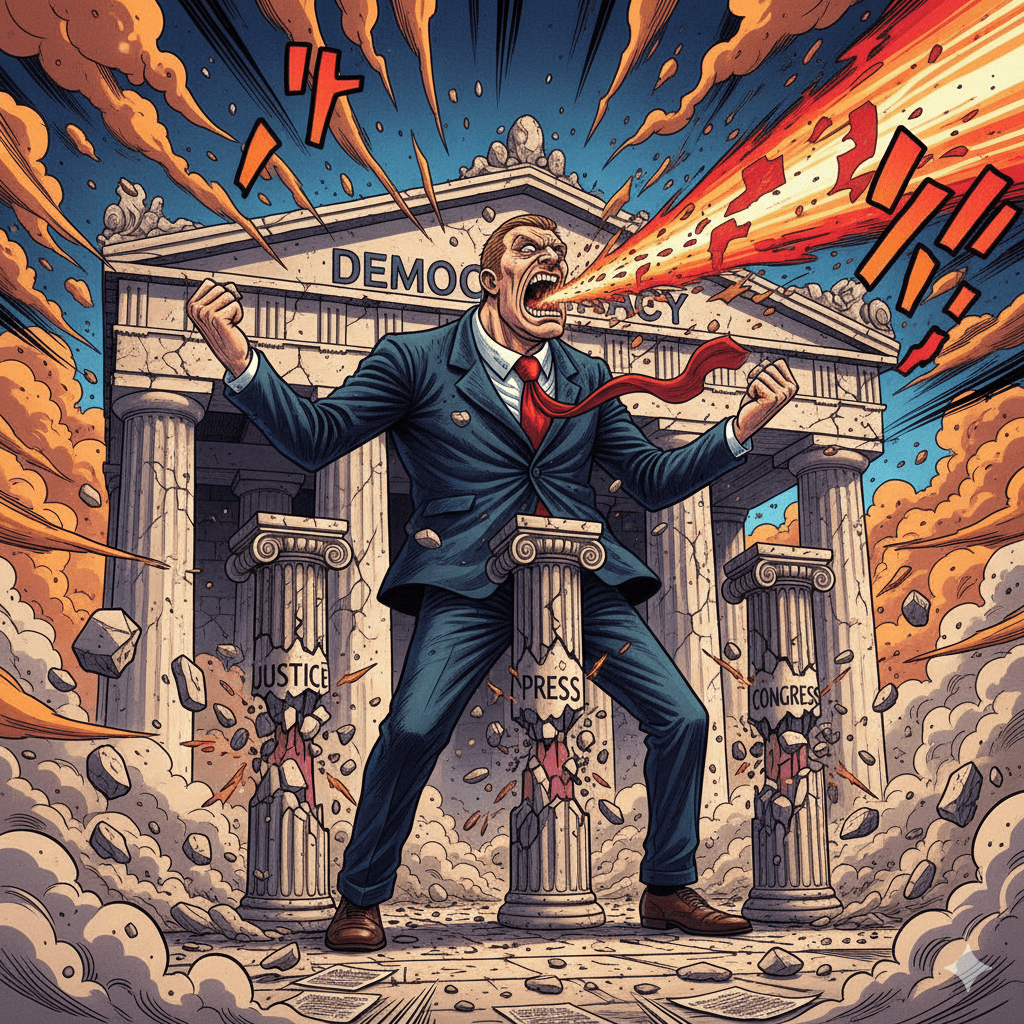
Ausblick: Eine Demokratie am Scheideweg
Die Lehre aus dem Vergleich von Watergate und der Trump-Präsidentschaft ist ernüchternd. Die amerikanischen Institutionen sind keine unüberwindbaren Festungen, sondern auf den guten Willen und den normativen Konsens der Akteure angewiesen. Wenn dieser Konsens zerbricht, werden Gesetze und Verfassungsartikel zu leeren Hülsen.
Die USA stehen vor der fundamentalen Frage, wie eine Demokratie sich selbst schützen kann, wenn eine der beiden großen Parteien die ungeschriebenen Regeln des Spiels nicht mehr akzeptiert. Die Post-Watergate-Ära war geprägt von dem Versuch, die Demokratie widerstandsfähiger zu machen. Die aktuelle Ära könnte als die Zeit in die Geschichte eingehen, in der diese Widerstandsfähigkeit an ihre Grenzen stieß.
Die langfristigen Folgen sind noch nicht abzusehen. Der Vertrauensverlust in die Regierung, der mit Vietnam und Watergate begann, hat sich in den letzten Jahren dramatisch vertieft. Eine Rückkehr zu einem Zustand, in dem die Mehrheit der Bürger ihren Institutionen vertraut, scheint in weiter Ferne.
George Washington warnte in seiner Abschiedsrede vor „gerissenen, ehrgeizigen und prinzipienlosen Männern“, die die Macht des Volkes an sich reißen könnten. Fünfzig Jahre nach Watergate ist diese Warnung aktueller denn je. Der Skandal um Richard Nixon hat gezeigt, dass die amerikanische Demokratie verwundbar ist. Die Präsidentschaft von Donald Trump hat gezeigt, dass die Wunden von damals nicht verheilt sind – und dass neue, vielleicht noch tiefere, hinzugekommen sind.
Die Zukunft der amerikanischen Demokratie wird davon abhängen, ob es gelingt, einen neuen, parteiübergreifenden Konsens über die grundlegenden Spielregeln zu finden. Ohne diesen droht das, was Nixon am Ende selbst erkannte: „Diejenigen, die dich hassen, gewinnen nicht, es sei denn, du hasst sie zurück, und dann zerstörst du dich selbst.“ Eine Lektion, die für einen Präsidenten gilt, aber auch für eine ganze Nation.


