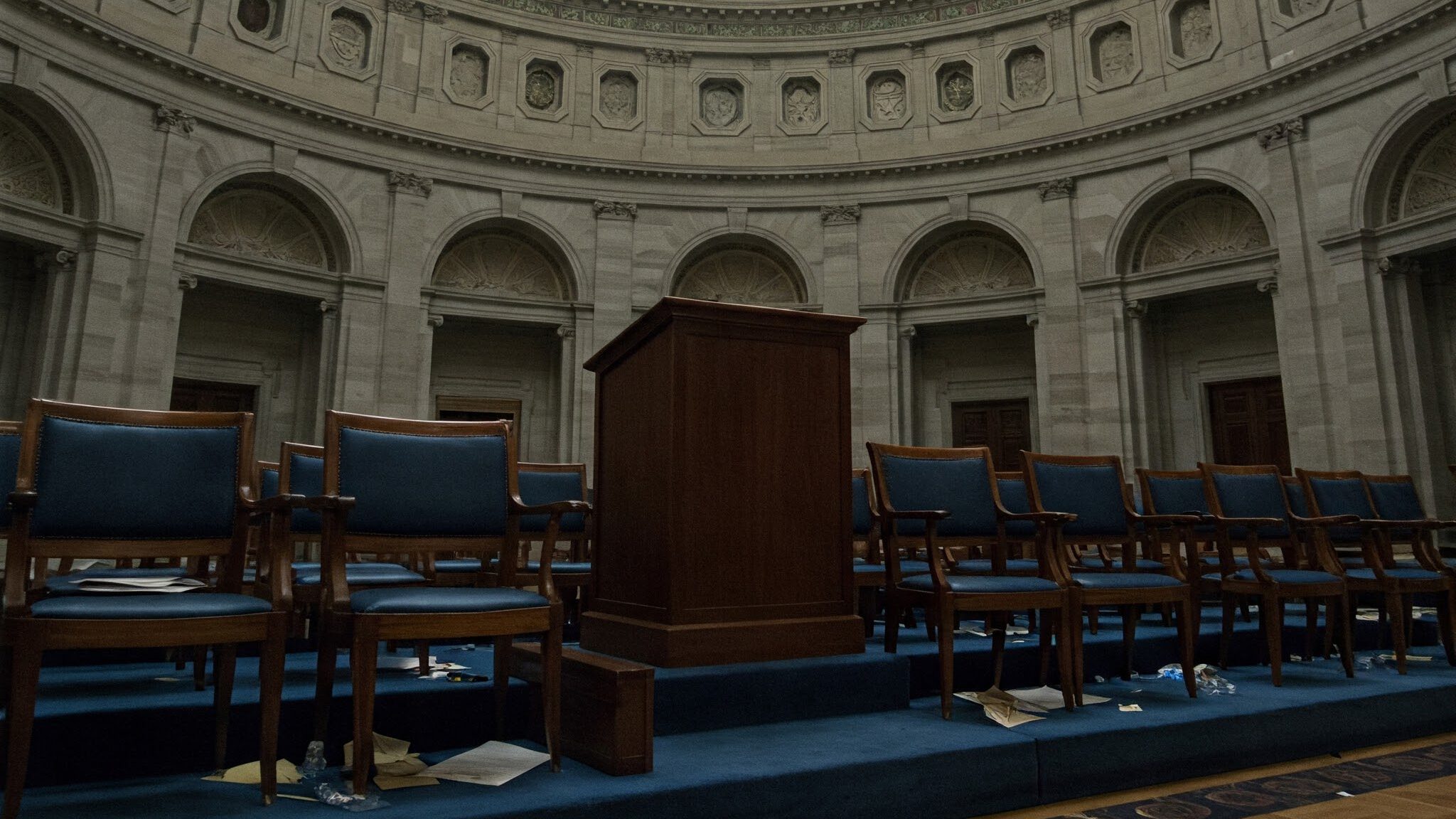
Die Inauguration Donald Trumps markierte nicht nur seine Rückkehr ins Weiße Haus, sondern auch die Zementierung einer neuen Ära in Washington: Eine Ära, in der die Grenzen zwischen unermesslichem Reichtum und politischer Macht verschwimmen wie nie zuvor. Die Bilder von Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg in den VIP-Reihen waren mehr als nur ein Schaulaufen der Superreichen – sie waren ein Symbol für eine tiefgreifende Transformation, die Fragen nach der Zukunft der amerikanischen Demokratie aufwirft und den Verdacht einer aufziehenden Oligarchie nährt.
Die zweite Amtszeit Donald Trumps hat eine beispiellose Konzentration von Milliardären und Multimillionären in die amerikanische Hauptstadt gespült. Mindestens ein Dutzend dieser Ultrareichen besetzen laut Berichten Kabinettsposten oder Schlüsselpositionen in der Administration – angeführt vom reichsten Mann der Welt, Elon Musk, mit einem geschätzten Vermögen von über 400 Milliarden Dollar, und dem Präsidenten selbst, dessen Wert auf knapp 7 Milliarden Dollar taxiert wird. Dieser Zuzug manifestiert sich nicht nur in politischen Ämtern, sondern auch physisch: Der Luxusimmobilienmarkt in Washington explodiert, da die Neuankömmlinge bereit sind, Rekordsummen für prestigeträchtige Adressen zu zahlen – wie die 25 Millionen Dollar für das Anwesen des Fox-Moderators Bret Baier, erworben von Trumps Handelsminister-Kandidaten Howard Lutnick. Die Nachfrage nach „Trophäenhäusern“ ist so groß, dass Makler aktiv Eigentümer ansprechen, ob sie nicht an die finanzstarke Klientel verkaufen möchten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Washingtons neuer Geldadel: Milliardäre erobern die Machtzentrale
Diese Entwicklung verleiht der von Ex-Präsident Biden in seiner Abschiedsrede geäußerten Warnung vor einer entstehenden Oligarchie in Amerika eine beunruhigende Aktualität. In Washington, so scheint es, sind die Oligarchen bereits angekommen. Die Verflechtung von Geld und Macht erreicht eine neue Dimension, die selbst das „Gilded Age“ in den Schatten stellt. Damals, so merkt Michael Waldman vom Brennan Center for Justice an, zog ein John D. Rockefeller nicht ins Weiße Haus ein oder leitete die Kampagne des Präsidenten. Heute hingegen wird erwartet, dass Elon Musk, der über 250 Millionen Dollar für Trumps Wahlsieg aufgewendet haben soll, ein eigenes Büro im White House Complex erhält, um als Co-Leiter des „Department of Government Efficiency“ (U.S. DOGE Service) zu fungieren – ein Symbol für den direkten Zugriff der Superreichen auf die Regierungsgeschäfte. Dieser direkte Einzug ins Machtzentrum, oft in Positionen, die genau jene Industrien überwachen, aus denen die Vermögen stammen, unterscheidet die aktuelle Situation fundamental von früheren Perioden großer Vermögenskonzentration. Die Frage, ob dies bereits eine oligarchische Gesellschaftsform darstellt, wie von Senator Bernie Sanders in der Anhörung des Finanzminister-Kandidaten Scott Bessent aufgeworfen, drängt sich auf. Bessents ausweichende Antwort, die auf soziale Mobilität verwies, wirkt angesichts der manifesten Machtkonzentration wie ein Echo aus einer vergangenen Zeit.
Tanz um den Thron: Zwischen strategischer Einflussnahme und demütiger Unterwerfung
Die Motivationen und Strategien der Milliardäre im Umgang mit Trump sind dabei keineswegs einheitlich. Elon Musk agiert als selbsterklärter „First Buddy“ des Präsidenten, ein früher und massiver finanzieller Unterstützer, der nun mit direktem Zugang und einem einflussreichen Posten belohnt wird. Sein Einfluss reicht so weit, dass er an Treffen und Telefonaten Trumps mit anderen Staats- und Regierungschefs teilnimmt und als inoffizieller Co-Präsident agiert. Sein Engagement scheint auf einer ideologischen Nähe und der Erwartung zu beruhen, maßgeblichen Einfluss auf die Regierungspolitik nehmen zu können.
Ganz anders stellt sich die Situation für Jeff Bezos (Amazon) und Mark Zuckerberg (Meta) dar. Beide hatten in Trumps erster Amtszeit ein angespanntes Verhältnis zum Präsidenten, geprägt von dessen öffentlichen Attacken, insbesondere gegen Bezos wegen der Berichterstattung der ihm gehörenden Washington Post. Nun suchen sie aktiv die Nähe und scheinen eine Strategie der Beschwichtigung zu verfolgen. Millionenschwere Spenden an das Inaugurationskomitee, Besuche in Mar-a-Lago und signifikante Zugeständnisse prägen ihr Vorgehen. Amazon zahlte Berichten zufolge eine hohe Summe für die Rechte an einer Dokumentation über Melania Trump und entfernte Verweise auf Diversitätsprogramme von seiner Website. Meta legte eine Klage Trumps wegen dessen Sperrung auf Facebook und Instagram gegen eine Zahlung von 25 Millionen Dollar bei, obwohl die Erfolgsaussichten für Meta als gut galten, und demontierte sein Fact-Checking-Programm sowie DEI-Initiativen.
Diese Annäherung, insbesondere das schnelle Einknicken von Bezos, als Trump Amazons Pläne zur Offenlegung von Zollanteilen an Produktpreisen als „feindseligen Akt“ kritisierte, lässt Beobachter wie den FAZ-Kommentator Roland Lindner fragen, ob diese Nähe nicht eher ein Zeichen von Ohnmacht als von Macht ist. Die Milliardäre akzeptieren demütigende Bedingungen und fordern offenbar hundertprozentige Unterwerfung, ohne eine Garantie auf Gegenleistung zu erhalten. Sie wirken, so die Interpretation, weniger wie mächtige Wirtschaftsbosse denn als „armselige Komparsen“ einer politischen Inszenierung. Sie navigieren ein gefährliches Spannungsfeld: Sie brauchen Zugang zur Regierung, um ihre massiven Geschäftsinteressen – von staatlichen Cloud-Aufträgen (Amazon Web Services) über Weltraum-Missionen (Blue Origin vs. SpaceX) bis hin zu Kartellverfahren (Meta, Google) – zu schützen, riskieren dabei aber, öffentlich als Opportunisten dazustehen und ihre Glaubwürdigkeit zu verspielen.
Millionen für den Präsidenten: Wie Spenden Türen öffnen und Politik käuflich wird
Die exorbitanten Summen, die für Trumps Inaugurationsfeierlichkeiten gesammelt wurden – mit 239 Millionen Dollar mehr als doppelt so viel wie der bisherige Rekord von 2017 –, werfen ein Schlaglicht auf die transaktionale Natur der Beziehungen. Die Liste der Top-Spender liest sich wie ein Who’s Who der Wirtschaftselite und der Nominierten für Regierungsposten. Mehr als ein Dutzend von Trump nominierte Personen, darunter Kandidaten für Botschafterposten und Kabinettsmitglieder, sowie deren Ehepartner steuerten Millionen bei. Allein die Top drei Einzelspender – Warren Stephens (nominiert als Botschafter in UK), Jared Isaacman (NASA-Chef) und Melissa Argyros (Botschafterin in Lettland) – gaben zusammen 8 Millionen Dollar.
Diese Großzügigkeit scheint sich auszuzahlen. Studien, sowohl zur Obama- als auch zur ersten Trump-Administration, belegen einen Zusammenhang zwischen Wahlkampfspenden bzw. Lobbying-Ausgaben und dem Zugang zum Weißen Haus sowie konkreten politischen Vorteilen. So profitierten Unternehmen unter Obama nachweislich an der Börse nach Treffen mit dem Präsidenten oder seinen Beratern. Unter Trump konnten Firmen, die ihn im Wahlkampf unterstützt hatten, eher Ausnahmegenehmigungen von den China-Zöllen erwirken, während Unterstützer der Gegenkandidatin Clinton benachteiligt wurden. Dieses undurchsichtige System der Zoll-Ausnahmen wurde von Kritikern als „Black Box“ bezeichnet.
Auch in Trumps zweiter Amtszeit deuten sich solche Muster an. Apple-Chef Tim Cook, der ebenfalls eine Million Dollar für die Inauguration gespendet haben soll und schon in der ersten Amtszeit ein gutes Verhältnis zu Trump pflegte, erhielt kürzlich Ausnahmen von den neuen Zöllen für Smartphones. Diverse Kryptowährungsfirmen (Ripple Labs, Robinhood, Coinbase etc.), die ebenfalls Millionen spendeten, sahen sich kurz darauf mit der Einstellung oder Aussetzung von Ermittlungen durch die Börsenaufsicht SEC konfrontiert. Die Motivation der Spender ist klar: Sie erhoffen sich wirtschaftsfreundliche Politik – weniger Regulierung, niedrigere Steuern, Unterstützung bei Auslandsinvestitionen, wohlwollende Entscheidungen in Kartellfragen oder bei der Vergabe von Staatsaufträgen. Dass Trump, im Gegensatz zu Obama und Biden, die Besucherlisten des Weißen Hauses geheim hält, erschwert die Nachverfolgung dieser Einflusspfade und verstärkt den Eindruck einer intransparenten, käuflichen Politik.
Kollateralschäden: Glaubwürdigkeit, Klimaschutz und die Spaltung der Gesellschaft
Diese enge Verbandelung zwischen Wirtschaftselite und Regierung bleibt nicht ohne Folgen. Die Glaubwürdigkeit der beteiligten Unternehmen und ihrer Führungspersönlichkeiten steht auf dem Spiel. Wenn Bezos entscheidet, dass die Washington Post keine Wahlempfehlungen mehr ausspricht, nachdem er jahrelang von Trump attackiert wurde, oder wenn Zuckerberg und andere Tech-CEOs interne Richtlinien zu Diversität oder gegen Hassrede aufweichen, nährt dies den Verdacht, dass Prinzipien den Geschäftsinteressen geopfert werden. Die Kommentare unter den entsprechenden Artikeln zeigen eine massive Kritik und Enttäuschung der Leserschaft, die von Opportunismus, Feigheit und dem Ausverkauf von Werten spricht.
Besonders augenfällig ist das Schweigen vieler selbsternannter Klima-Vorkämpfer aus der Tech-Elite. Während Milliardäre wie Bezos, Bill Gates oder Laurene Powell Jobs in den letzten Jahren Milliarden für den Klimaschutz zusagten und 2017 Trumps Austritt aus dem Pariser Abkommen noch lautstark kritisierten, bleiben sie nun weitgehend stumm, während Trump Umweltauflagen schleift, fossile Energien fördert und Klimaschutzinitiativen demontiert. Diese Zurückhaltung, gepaart mit Millionenspenden an Trumps Inaugurationskomitee, wird als strategisches Kalkül interpretiert, um nicht ins Visier des Präsidenten zu geraten – eine Taktik, die viele Wirtschaftsführer angesichts von Trumps Unberechenbarkeit und seiner Neigung zu öffentlichen Attacken gegen Kritiker wählen. Die Angst, den Zugang zu verlieren oder zum Ziel zu werden, scheint größer als das Bekenntnis zu früheren Überzeugungen.
Die Kommentare von Trump und seinen milliardenschweren Beratern, die oft die Lebensrealität der Durchschnittsamerikaner zu ignorieren scheinen – sei es bei Aktientipps inmitten fallender 401(k)s oder bei Bemerkungen zur Bedeutung von Sozialversicherungschecks –, verstärken den Eindruck einer abgehobenen Elite. Psychologen erklären dies mit der Tendenz, dass mit wachsendem Reichtum oft Empathie und das Verständnis für die Sorgen weniger Privilegierter abnehmen.
Letztlich formt die Allianz zwischen Trump und den Milliardären nicht nur die Politik, sondern auch das soziale Gefüge Washingtons und potenziell die amerikanische Gesellschaft insgesamt. Sie wirft fundamentale Fragen auf: Wie viel Ungleichheit verträgt eine Demokratie? Wann kippt der legitime Einfluss von Interessengruppen in eine oligarchische Herrschaft? Und welchen Preis zahlen Gesellschaft und Unternehmen, wenn wirtschaftliche Macht und politische Entscheidungen derart eng und intransparent miteinander verwoben sind? Die Antworten darauf werden die kommenden Jahre prägen – und könnten darüber entscheiden, ob Amerikas „goldenes Zeitalter“, wie von Trump proklamiert, tatsächlich anbricht oder ob sich das Land weiter in Richtung einer gespaltenen Gesellschaft bewegt, in der eine kleine Elite die Geschicke lenkt.


