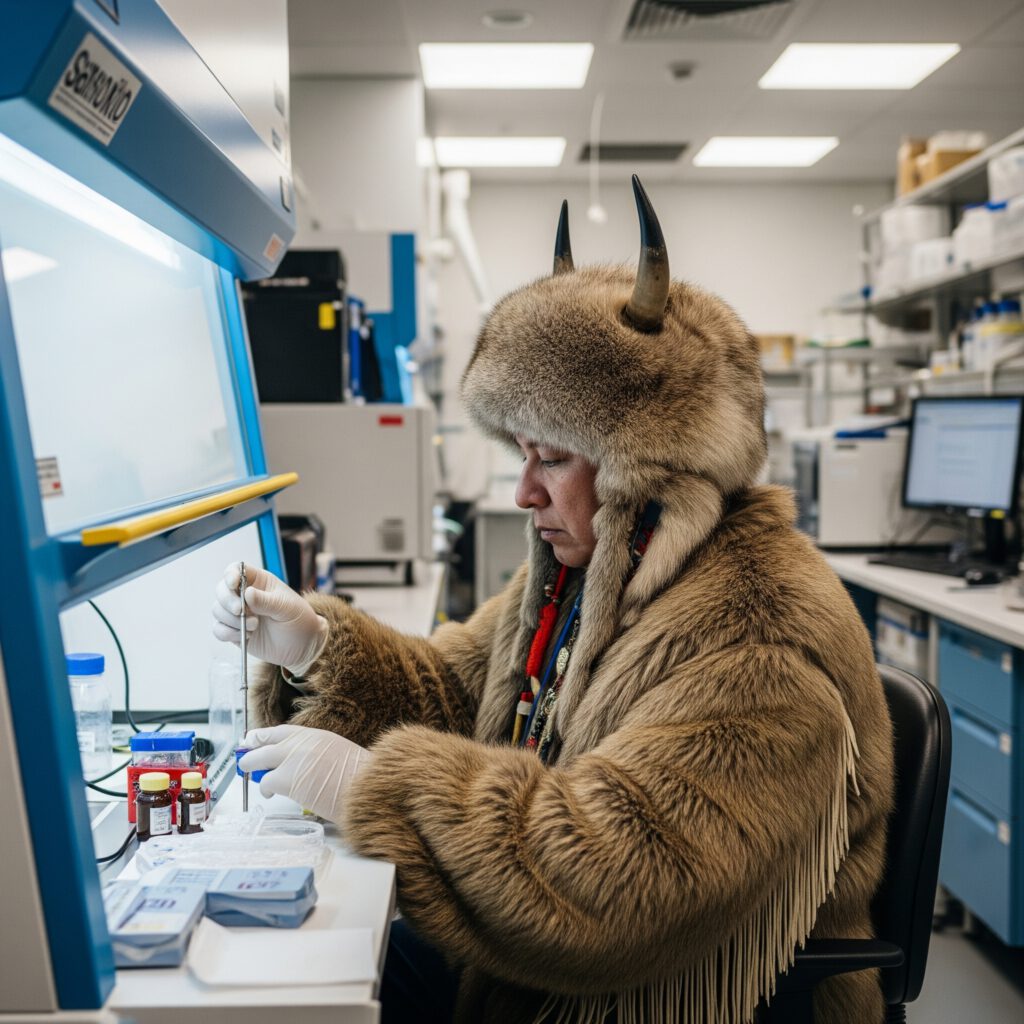Ein Aufschub von 90 Tagen. In der Welt der globalen Supermachtpolitik ist das kaum mehr als ein Wimpernschlag. Und doch hält die Nachricht, dass Washington und Peking ihre angedrohten Strafzölle erneut für drei Monate aussetzen, die Welt in Atem. Man könnte es für ein Zeichen der Entspannung halten, ein zaghaftes Friedensangebot im erbitterten Handelskrieg. Doch dieser Anschein trügt. Wer genauer hinsieht, erkennt in dieser Pause keinen Beginn der Deeskalation, sondern die unheilvolle Stille vor dem nächsten Sturm. Es ist die Zeit, in der beide Kontrahenten ihre Waffen neu justieren, ihre Strategien verfeinern und sich für die nächste, wohl noch entscheidendere Phase ihres Ringens um die globale Vorherrschaft wappnen. Denn der Konflikt, der im Frühjahr mit Zöllen von bis zu 145 Prozent beinahe den Welthandel stranguliert hätte, hat sich längst von einer reinen Auseinandersetzung über Handelsbilanzen zu einem existenziellen Kampf um technologische Souveränität und geopolitischen Einfluss entwickelt. Die aktuelle Ruhe ist daher kein Frieden, sondern lediglich die Verlegung des Schlachtfelds.
Die Anatomie einer Eskalation: Als der Handel zur Waffe wurde
Um die jetzige Situation zu verstehen, muss man sich das Beben vergegenwärtigen, das noch vor wenigen Monaten durch die Weltwirtschaft ging. Der von Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit mit neuer Wucht entfesselte Handelskonflikt erreichte eine Eskalationsstufe, die selbst erfahrene Beobachter schockierte. Die USA überzogen chinesische Waren mit Zöllen von bis zu 145 Prozent, eine Maßnahme, die in ihrer Drastik an eine Wirtschaftsblockade grenzt. Peking, anders als viele andere Handelspartner der USA, duckte sich nicht weg. Es schlug mit voller Härte zurück und belegte amerikanische Produkte mit Abgaben von bis zu 125 Prozent.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Das Resultat war ein beinahe vollständiger Stillstand des direkten Handels zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Der bilaterale Warenaustausch brach laut amerikanischen Zolldaten um bis zu 40 Prozent ein. Dieser wirtschaftliche Würgegriff war mehr als nur ein politisches Signal; er war eine Demonstration der gegenseitigen Verletzbarkeit. Die Einigung von Genf im Mai, die Zölle auf ein erträgliches Maß zu senken und einen Teil für 90 Tage auszusetzen, war daher keinem plötzlichen Sinneswandel geschuldet, sondern der nackten Notwendigkeit, einen totalen Kollaps zu verhindern. Doch die unter der Oberfläche liegenden Spannungen blieben nicht nur bestehen, sie veränderten auch ihren Charakter. Der Konflikt verlagerte sich von reinen Zollfragen hin zu einem strategischen Kampf um die Kontrolle über die entscheidenden Ressourcen des 21. Jahrhunderts.
Chinas neue Trumpfkarte: Die Entdeckung der Seltenen Erden als Waffe
Lange Zeit schien China im Handelsstreit primär zu reagieren, fast spiegelbildlich auf die Aktionen Washingtons zu antworten. Doch diese Dynamik hat sich fundamental verschoben. Peking hat seine eigene Achillesferse in der amerikanischen Wirtschaft identifiziert und gelernt, sie als mächtigen Hebel einzusetzen: die Abhängigkeit der USA von Seltenen Erden. Diese Mineralien sind das unsichtbare Lebenselixier der modernen Technologie. Ohne sie keine Smartphones, keine Bildschirme, keine Halbleiter – und auch keine Kampfjets oder Windturbinen.
Als Peking im April den Export dieser strategisch wichtigen Rohstoffe drosselte, spürten amerikanische Industrien von der Automobilbranche bis zur Rüstungsproduktion die Auswirkungen unmittelbar. Die Drohung, den Hahn ganz zuzudrehen, entpuppte sich als Chinas „Wunderwaffe“. Sie zwang die sonst so aggressive Trump-Administration in die Defensive. Plötzlich war nicht mehr von der Unterwerfung des geopolitischen Rivalen die Rede, sondern von der dringenden Notwendigkeit, die Lieferketten für Magnete wiederherzustellen. China hat damit bewiesen, dass es nicht nur ein Opfer von Zöllen ist, sondern ein Akteur, der die Regeln des Spiels aktiv mitgestalten kann. Diese neue Selbstsicherheit verändert die Verhandlungsdynamik grundlegend. Peking ist, wie ein indischer Ökonom treffend bemerkte, wohl „zu groß, um von Trump gemobbt zu werden“.
Trumps Systembruch: Wenn der Staat Schutzgeld von seinen eigenen Firmen verlangt
Konfrontiert mit Chinas neuem Druckmittel, griff die Trump-Regierung zu einer Maßnahme, die in ihrer Unorthodoxie selbst für ihre Verhältnisse beispiellos ist und die Grundfesten der amerikanischen Wirtschaftsphilosophie erschüttert. Um den Verkauf von Hochleistungschips für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen der US-Konzerne Nvidia und AMD nach China wieder zu ermöglichen, verlangt Washington von den eigenen Unternehmen eine Abgabe von 15 Prozent auf die entsprechenden Umsätze. Trump selbst brüstete sich damit, ursprünglich sogar 20 Prozent gefordert zu haben.
Dieser Deal ist ein radikaler Bruch mit bisherigen Prinzipien. Es ist keine Import- oder Exportsteuer im klassischen Sinne, sondern eine Art staatlich sanktionierte Provision, die Kritiker als eine Form von Bestechung oder Erpressung bezeichnen. Die Regierung tauscht nationale Sicherheitsinteressen – denn genau darum ging es bei den ursprünglichen Exportkontrollen für KI-Chips – gegen direkte Einnahmen. Dies sendet ein verheerendes Signal an die Welt und insbesondere an Amerikas Verbündete. Es nährt den Verdacht, dass für die USA am Ende alles verhandelbar ist, wenn nur der Preis stimmt. Die Glaubwürdigkeit Washingtons als prinzipienfester Akteur steht auf dem Spiel. Zudem verwischt diese Praxis die Grenze zwischen unabhängigen Unternehmen und dem Staat. Werden Konzerne wie Nvidia, Apple oder Tesla in Zukunft nicht mehr als eigenständige Wirtschaftsakteure, sondern als verlängerter Arm der US-Regierung wahrgenommen? Es ist eine Frage, die die Definition des amerikanischen Kapitalismus selbst infrage stellt.
Der Kampf hinter dem Kampf: Ringen um die technologische Zukunft
Die Auseinandersetzung um Zölle auf Sojabohnen und der Streit um Handelsdefizite sind nur die sichtbare Oberfläche eines viel tiefer liegenden Konflikts. Im Kern geht es um die Frage, wer die technologischen und wirtschaftlichen Regeln des 21. Jahrhunderts schreiben wird. Der Fokus auf Halbleiter und Künstliche Intelligenz macht dies überdeutlich. Washingtons Versuch, Chinas Aufstieg zur KI-Macht durch Exportkontrollen zu bremsen, ist ein Eingeständnis, dass es hier um mehr als nur um wirtschaftliche Fairness geht. Es ist ein geopolitisches Ringen um die Vorherrschaft in den Schlüsseltechnologien der Zukunft.
China wiederum hat verstanden, dass technologische Autarkie die Voraussetzung für wahre Souveränität ist. Die massive Förderung heimischer Chiphersteller und die Kampagnen gegen den Kauf von Nvidia-Produkten sind Teil einer langfristigen Strategie, die Abhängigkeit vom Westen zu überwinden. Jeder Schritt in diesem Konflikt, von Zöllen über Exportstopps bis hin zu erzwungenen Abgaben, ist somit ein Zug in einem globalen Schachspiel um die technologische Führung. Die 90-tägige Pause wird von beiden Seiten genutzt, um die eigene Position in diesem entscheidenden Kampf zu stärken, nicht um ihn zu beenden.
Innenpolitik als Brandbeschleuniger: Trumps Taktik des kalkulierten Chaos
Man kann den Handelskrieg nicht verstehen, ohne die innenpolitische Dimension in den USA zu berücksichtigen. Für Präsident Trump ist die Konfrontation mit China nicht nur Außenpolitik, sondern auch ein zentrales Instrument zur Mobilisierung seiner Basis und zur Steuerung der öffentlichen Aufmerksamkeit. Seine Strategie, die als „Flood the zone“ bekannt ist, zielt darauf ab, durch eine Flut von Dekreten, Ankündigungen und Provokationen politische Gegner zu überfordern und von unliebsamen Themen abzulenken.
Die erratischen Entscheidungen, die ständigen Kehrtwenden und die persönliche Inszenierung des Präsidenten als alleiniger Dealmaker dienen diesem Zweck. Ob es um die medienwirksame Entsendung der Nationalgarde nach Washington oder die plötzliche Fokussierung auf die Epstein-Affäre geht – die harte Haltung gegenüber China ist ein verlässlicher roter Faden, der die eigene Anhängerschaft bei Laune hält. Gleichzeitig schafft die ständige Unsicherheit ein Klima, in dem rationale, langfristige Politik kaum möglich ist. Der Handelskrieg wird so auch zur Geisel innenpolitischer Taktiken, was eine nachhaltige Lösung zusätzlich erschwert. Die Kompromissbereitschaft wird nicht nur von wirtschaftlichen Notwendigkeiten bestimmt, sondern auch von der Frage, welche Erzählung sich am besten an die eigene Wählerschaft verkaufen lässt.
Ein brüchiger Frieden: Warum die nächste Konfrontation unausweichlich scheint
Was bedeutet die Verlängerung des Waffenstillstands also für die kommenden Monate? Die Aussichten sind düster. Die fundamentalen Konfliktlinien haben sich nicht aufgelöst, sondern verschärft. Der Streit hat sich von einem reinen Handelsdisput zu einem systemischen Wettbewerb entwickelt, der Technologie, nationale Sicherheit und innenpolitische Machtspiele umfasst. Beide Seiten haben neue, schmerzhafte Druckmittel entdeckt und ihre Bereitschaft demonstriert, diese auch einzusetzen.
Die von Trump parallel und oft widersprüchlich geführten Handelskonflikte mit traditionellen Verbündeten wie der EU, Japan oder Indien haben das Vertrauen in die USA als verlässlichen Partner erodiert und ein Machtvakuum geschaffen, das China geschickt zu nutzen weiß. Washingtons Strategie, Sicherheitsbedenken gegen Geld einzutauschen, befremdet selbst wohlwollende Beobachter und lässt die amerikanische Politik willkürlich und rein transaktional erscheinen.
Unter diesen Umständen ist die 90-Tage-Frist weniger ein Weg zu einer dauerhaften Einigung als vielmehr ein Countdown zur nächsten Konfrontation. Eine echte Lösung würde ein Maß an Vertrauen und strategischer Weitsicht erfordern, das auf beiden Seiten derzeit nicht erkennbar ist. Stattdessen ist zu befürchten, dass die Pause für eine weitere Aufrüstung im Wirtschafts- und Technologiekrieg genutzt wird. Die Welt schaut zu, wie bei einem gigantischen Gefährt die Bremsen gelöst wurden. Die aktuelle Pause ist nur ein kurzes, flaches Stück auf einer Strecke, die unweigerlich weiter bergab führt. Die Frage ist nicht, ob die nächste Kollision kommt, sondern nur, wie heftig sie ausfallen wird.