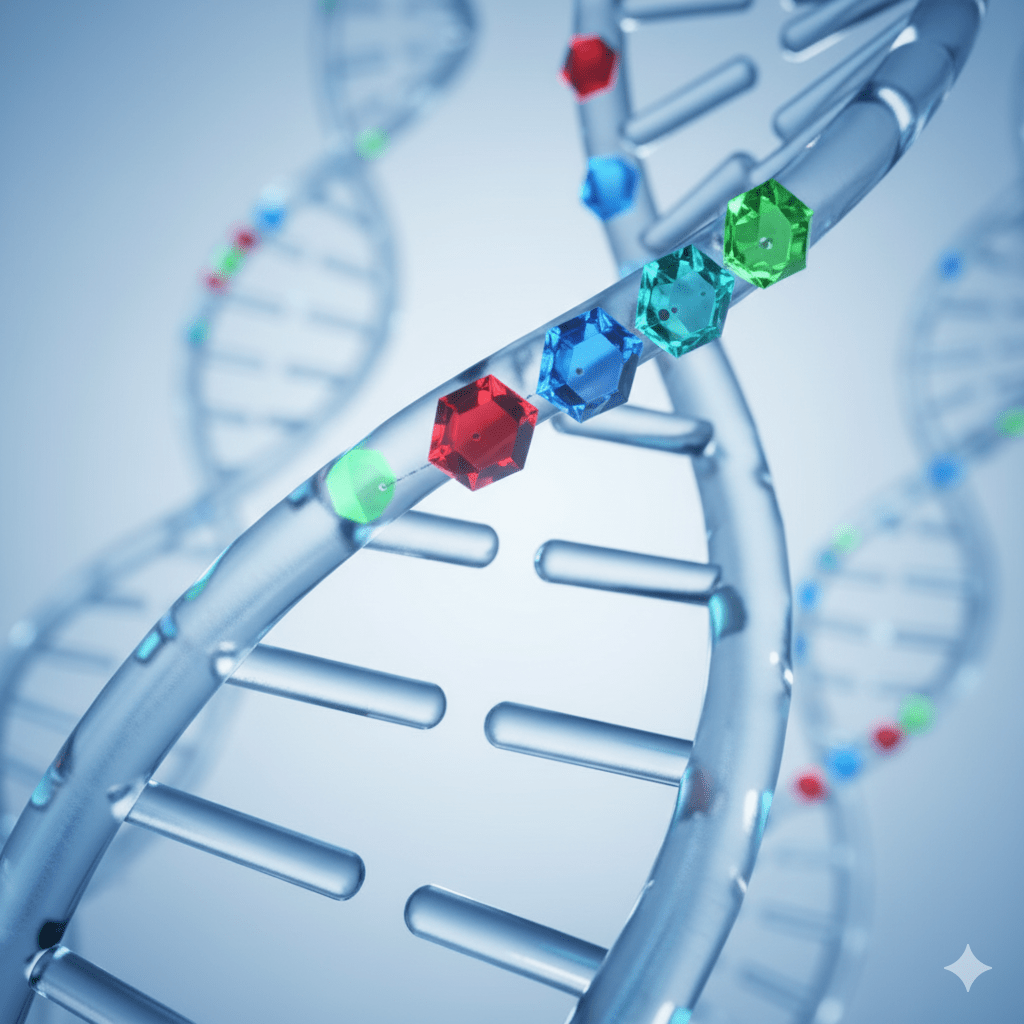Ein Wort, so schwer und scharf wie eine Klinge, durchschneidet die politische Landschaft Amerikas: Verrat. Ausgesprochen vom amtierenden Präsidenten Donald Trump im Oval Office, richtet es sich gegen niemanden Geringeren als seinen Vorgänger, Barack Obama. Dies ist nicht nur eine weitere Eskalation in der ohnehin schon angespannten Beziehung zwischen den beiden Männern; es ist ein gezielter Angriff auf das Fundament der amerikanischen Demokratie – die gemeinsame Faktenbasis. Trump zündet ein politisches Störfeuer, das von seinen eigenen Problemen ablenken soll, doch die Flammen drohen, die Archive der jüngsten Geschichte zu verzehren. Die zentrale These dieses Manövers ist ebenso simpel wie brisant: Die Ermittlungen zur russischen Einmischung in die Wahl 2016 waren kein Akt der nationalen Sicherheit, sondern eine von Obama inszenierte Verschwörung. Ein Narrativ, das so kraftvoll ist, dass es droht, die sorgfältig dokumentierte Realität zu überschreiben.
Die Munition für diesen Frontalangriff liefert ein Bericht, der von der nationalen Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard veröffentlicht wurde. Ihr Team hat Dokumente deklassifiziert, die belegen sollen, dass die Obama-Administration gezielt Geheimdiensterkenntnisse „fabriziert und politisiert“ habe, um einen „jahrelangen Putsch“ gegen Trump vorzubereiten. Trump greift diese Vorwürfe begierig auf und spricht von einer „verräterischen Verschwörung“, deren Drahtzieher direkt im Büro seines Vorgängers zu finden seien. Er fordert nicht weniger als strafrechtliche Konsequenzen und sieht Obama und dessen Team, darunter Joe Biden und frühere Geheimdienstchefs, bereits als überführt an: „Er ist schuldig“. Es ist der Versuch, die Geschichte radikal umzuschreiben – aus den untersuchten Objekten russischer Einflussnahme sollen die eigentlichen Täter amerikanischer Machenschaften werden.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Anatomie eines umstrittenen Berichts
Doch diesem neu geschaffenen Narrativ stellt sich eine Wand aus Fakten entgegen, die von Obamas Lager umgehend mobilisiert wird. Dessen Sprecher, Patrick Rodenbush, bezeichnet die Vorwürfe in einer seltenen öffentlichen Stellungnahme als „lächerlich“, „bizarr“ und als „schwachen Ablenkungsversuch“. Die Reaktion aus Obamas Büro ist bewusst scharf, denn sie verteidigt nicht nur den ehemaligen Präsidenten, sondern auch eine breit akzeptierte Wahrheit. Rodenbush verweist auf den Kern der Sache: Nichts in Gabbards neuem Dokument widerlegt die zentrale Schlussfolgerung, dass Russland massiv versuchte, die Wahl 2016 zu beeinflussen. Diese Erkenntnis ist kein politisches Hirngespinst, sondern das Ergebnis mehrerer tiefgreifender Untersuchungen, darunter eine jahrelange, parteiübergreifende Studie des Geheimdienstausschusses des Senats. Pikanterweise wurde dieser Bericht damals von jedem republikanischen Mitglied unterzeichnet, einschließlich Marco Rubio, Trumps heutigem Außenminister.
Hier liegt der fundamentale Widerspruch, der Gabbards Bericht als politisches Instrument entlarvt. Während frühere Untersuchungen, wie auch die von Sonderermittler Robert S. Mueller III., sich auf die russischen Social-Media-Kampagnen und das Hacken von E-Mails der Demokraten konzentrierten, stützt sich Gabbards Team auf einen anderen Aspekt. Es hebt Dokumente hervor, die besagen, dass eine direkte Cyber-Manipulation von Wahlmaschinen durch ausländische Mächte unwahrscheinlich sei. Dies ist eine gezielte Vermischung zweier unterschiedlicher Sachverhalte. Es ist, als würde man die Unwahrscheinlichkeit eines Einbruchs durch die Vordertür betonen, während die Täter längst durch das offene Fenster im Hinterzimmer eingestiegen sind. Die Washington Post stuft die Beweislage von Gabbards Bericht folgerichtig als „hauchdünn“ ein.
Mehr als nur ein persönlicher Feldzug
Die Frage, die sich aufdrängt, ist: Warum wird dieses Manöver gerade jetzt gefahren? Die Quellen deuten stark darauf hin, dass Trumps Vorstoß eine klassische Ablenkungsstrategie ist. Er stand unter erheblichem Druck wegen des Umgangs seiner Regierung mit den Akten rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und nutzte die Verratsvorwürfe gezielt, um die Fragen der Reporter in eine andere Richtung zu lenken. Die Anschuldigungen sind Teil eines Musters, das von Angriffen auf den Bau von Obamas Präsidentenbibliothek bis hin zu bizarren, KI-generierten Videos reicht, die Obamas Verhaftung zeigen. Der Feldzug gegen Obama ist persönlich, aber sein Zweck ist strategisch. Die Rolle von Tulsi Gabbard ist dabei entscheidend. In einer Position, die traditionell überparteilich agieren soll, agiert sie als politische Akteurin, die ihre Thesen sogar in einem Interview mit der Schwiegertochter des Präsidenten bei Fox News verteidigt. Die selektive Deklassifizierung von Dokumenten dient hier nicht der Aufklärung, sondern der Schaffung einer alternativen Realität, die als politische Waffe im hier und jetzt eingesetzt wird.
Was bleibt, ist mehr als nur der Lärm einer weiteren politischen Fehde. Es ist die Erosion einer fundamentalen Norm: des Respekts vor dem Amt des Vorgängers und der Akzeptanz von Fakten, die von unparteiischen Institutionen ermittelt wurden. Wenn ein Präsident seinen Vorgänger des Verrats bezichtigt und die Geheimdienste als Verschwörer darstellt, rüttelt er an den Grundfesten des Staates. Die Reaktionen in der Öffentlichkeit, die laut Quellenlage die Aktionen Trumps überwiegend mit Verachtung strafen, zeigen, dass viele diesen Angriff auf die demokratische Kultur erkennen. Doch der Schaden ist bereits angerichtet. Die Anschuldigung des „Verrats“ vergiftet den politischen Diskurs und verschiebt die Grenzen des Sagbaren. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, das die fragile Balance zwischen politischem Wettbewerb und der Zerstörung des gegenseitigen Vertrauens aufs Spiel setzt. Am Ende könnte die Frage nicht mehr lauten, wer die Wahl 2016 beeinflusst hat, sondern ob es überhaupt noch eine gemeinsame Wahrheit gibt, auf die sich eine Nation einigen kann.