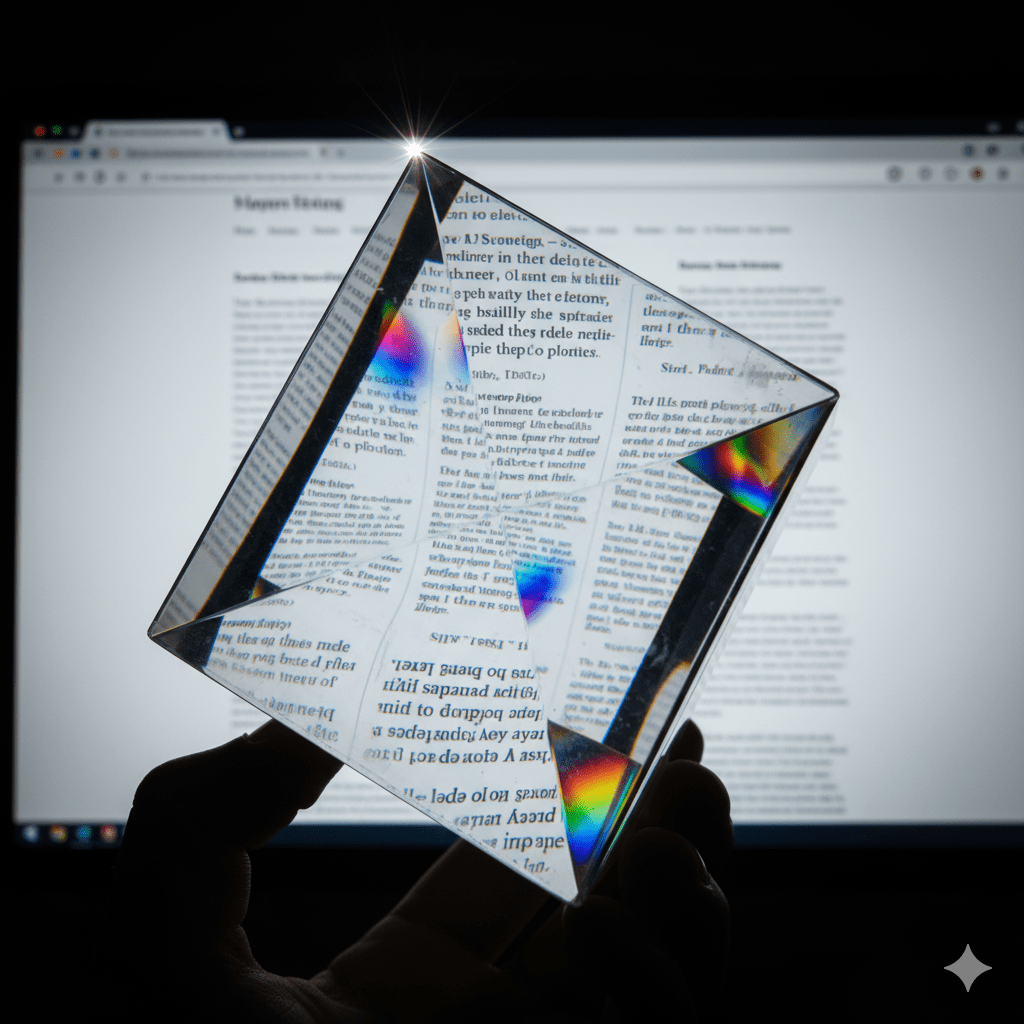Die Handelspolitik Donald Trumps, ein Markenzeichen seiner Präsidentschaft, verspricht Stärke und den Schutz amerikanischer Interessen. Doch ein genauerer Blick auf die Auswirkungen seiner Zollstrategie, insbesondere im Clinch mit China, enthüllt ein komplexes und oft widersprüchliches Bild. Statt eines wirtschaftlichen Befreiungsschlages drohen leere Regale, steigende Preise und eine tiefgreifende Verunsicherung – ein Spiel, bei dem die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen die Zeche zahlen könnten, während der Präsident unbeirrt an seiner Rhetorik festhält.
Die Schaufenster der amerikanischen Konsumwelt, allen voran die des Einzelhandelsgiganten Walmart, stehen im grellen Licht der handelspolitischen Bühne. Präsident Trump, bekannt für seine direkte und oft konfrontative Art, fordert von Unternehmen wie Walmart unmissverständlich, die Last seiner Importzölle selbst zu schultern – sie sollen die Abgaben quasi „schlucken“, statt sie an die Kundschaft weiterzugeben. Eine Forderung, die angesichts milliardenschwerer Unternehmensgewinne populistisch klingen mag, doch die ökonomische Realität zeichnet ein anderes Bild.
Walmart im Zangengriff: Zwischen politischem Druck und ökonomischen Realitäten
Die Führungsetagen von Walmart und anderen großen Einzelhändlern sehen sich einem enormen Kostendruck ausgesetzt. Trotz solider Verkaufszahlen und eines boomenden E-Commerce-Geschäfts, das Walmart erstmals schwarze Zahlen bescherte, ist die Botschaft eindeutig: Die Zölle, selbst nach temporären Reduktionen, werden unweigerlich zu höheren Preisen führen. Walmart-Finanzchef John David Rainey deutete bereits an, dass erste Preissteigerungen schon im Mai für die Verbraucher spürbar werden könnten. Auch wenn das Unternehmen beteuert, die Preise so lange wie möglich niedrig halten zu wollen und einen Teil der Mehrkosten abzufedern, sind die Margen im Einzelhandel bekanntermaßen schmal. Die Hoffnung, dass Zulieferer die zusätzlichen Kosten komplett absorbieren, erweist sich als trügerisch.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Auswirkungen sind dabei keineswegs auf Luxusgüter beschränkt. Von Elektronik und Kleidung, die zu einem erheblichen Teil direkt oder indirekt aus China stammen, über Spielzeug und Haushaltswaren bis hin zu Schuhen, deren Preise sich durch Zölle mehr als verdreifachen könnten, reicht die Palette. Selbst Lebensmittel, bei denen Walmart aufgrund eines hohen Anteils an heimischer Produktion als relativ gut abgeschirmt gilt, sind nicht völlig ausgenommen. Zölle auf Importe aus Ländern wie Costa Rica, Peru oder Kolumbien verteuern bereits Bananen, Avocados und Kaffee. Die Warnungen aus der Chefetage von Walmart sind somit mehr als nur vorsichtige Prognosen; sie sind ein Indikator für eine bevorstehende Belastungsprobe für die amerikanischen Geldbeutel. Die Drohung Trumps, genau hinzuschauen, ändert wenig an den ökonomischen Zwängen. Die Diskrepanz zwischen der präsidialen Rhetorik, wonach ausländische Hersteller die Kosten tragen würden, und der Realität der Preisweitergabe an die Endverbraucher wird immer offensichtlicher.
Globale Lieferketten im Stresstest: Der Handelskrieg als Bumerang
Die von Präsident Trump initiierten Zölle wirken weit über die Ladenkassen hinaus. Sie entfalten eine destabilisierende Kraft auf die fein austarierten globalen Lieferketten, die das Fundament des modernen Welthandels bilden. Die Welthandelsorganisation (WTO) rechnet mit einem dramatischen Einbruch des Warenhandels zwischen den USA und China um bis zu 80 Prozent, sollten die prohibitiven Zölle von zeitweise 145 Prozent Bestand haben. Solche Raten kommen faktisch einem Handelsembargo gleich, eine Entwicklung, die Trump mitunter ungerührt oder gar positiv kommentiert.
Die Folgen sind bereits jetzt spürbar: Der chinesische Onlineriese Temu, bekannt für seine Billigangebote, hat Direktlieferungen aus China gestoppt, nachdem die Zollbefreiung für Sendungen unter 800 Dollar gestrichen wurde und nun Abgaben von 145 Prozent fällig würden. Das Angebot verknappt sich, Käufer klagen über nicht mehr verfügbare Wunschartikel. Beobachter wie der Apollo-Chefvolkswirt Torsten Slok warnten bereits im April vor einem Kollaps des Handels zwischen China und den USA, mit der Konsequenz leerer Regale und Lieferengpässen, die an die Covid-Pandemie erinnern. Im April wurden Berichten zufolge 80 Containerschifffahrten von China in die USA storniert, deutlich mehr als während der Pandemie. Die Häfen, wie der in Los Angeles, bereiten sich auf sinkenden Verkehr vor.
Diese „Trump-Schockstarre“ lähmt die Einkäufer. Viele haben zwar im Vorfeld der Zölle ihre Lager gefüllt, doch diese Bestände schwinden. Der Spielzeugherstellerverband warnt eindringlich: Geht die Produktion nicht bald los, fehlt es an Weihnachten an Spielzeug. Kunsttannen, Weihnachtskugeln – Produkte, die überwiegend in China gefertigt werden. Die Importabhängigkeit der USA ist enorm und betrifft eine breite Produktpalette, von Kinderwagen über Regenschirme bis hin zum Feuerwerk für den Nationalfeiertag. Die Vorstellung, China als „Werkbank der Welt“ durch Zölle schnell in die Knie zwingen zu können, erweist sich als gefährlicher Trugschluss. Denn die Waffe der Zölle ist ein Bumerang: Nicht nur China leidet unter dem Nachfrageausfall, sondern ebenso zahlen amerikanische Konsumenten und Unternehmen den Preis für diesen Handelskrieg. Langfristig drohen nicht nur höhere Kosten, sondern auch der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit und eine Verlagerung von Handelsströmen, deren Auswirkungen schwer absehbar sind. Selbst wenn Unternehmen versuchen, ihre Produktion in andere Länder zu verlagern, ist dies ein langwieriger und kostspieliger Prozess.
Innenpolitische Sprengkraft: Wenn Zölle die eigene Wählerschaft treffen
Die Zollpolitik entfaltet nicht nur international, sondern auch innenpolitisch eine erhebliche Sprengkraft. Präsident Trumps Kernversprechen, Amerika wieder bezahlbar zu machen und die Inflation zu beenden, steht in krassem Widerspruch zu den nun drohenden Preissteigerungen. Besonders seine eigene Stammwählerschaft, die oft preissensibel ist, könnte die Auswirkungen empfindlich zu spüren bekommen. Haushalte mit geringem Einkommen, die ohnehin kaum finanzielle Polster für unerwartete Ausgaben haben, werden überproportional belastet. Ein T-Shirt für 25 statt 10 Dollar oder Schuhe für 160 statt 50 Dollar sind für viele keine Option.
Diese Entwicklung ist der Trump-Administration nicht verborgen geblieben. Berichten zufolge senkte das Weiße Haus die Zölle gegen China, nachdem Berater und sogar Finanzminister Scott Bessent und Stabschefin Susie Wiles vor den negativen Auswirkungen auf zentrale Wählergruppen wie Hafenarbeiter und Lkw-Fahrer gewarnt hatten. Die Erkenntnis, dass die eigene Zollpolitik „das Wasser bis zum Hals stehen“ lässt, scheint zumindest temporär zu einem Umdenken geführt zu haben. Doch die grundsätzliche Bereitschaft, Zölle als politisches Druckmittel einzusetzen, bleibt bestehen.
Die Reaktionen der Wirtschaftsakteure sind überwiegend kritisch. Industrievertreter warnen seit Wochen vor Preissprüngen und Lieferengpässen. Ökonomen erwarten, dass die Zollerhöhungen die Inflation zumindest kurzfristig antreiben werden. Der Chef von Basic Fun, einem Spielzeugunternehmen, fürchtet um die eigene Existenz und die der ganzen Branche. Logistikunternehmer prognostizieren das Ende vieler kleinerer Unternehmen – ein „Asteroideneinschlag“ für gesunde Betriebe. Selbst die US-Notenbank Federal Reserve, die unter anderem wegen Trumps Ziel, Stellen in Regierungsbehörden zu streichen, selbst Personalabbau plant, beobachtet die inflationären Tendenzen mit Sorge.
Rhetorik vs. Realität: Die Mär vom selbstzahlenden Zoll
Ein zentrales Narrativ Präsident Trumps ist, dass die Handelspartner, insbesondere China, die Kosten der Zölle tragen würden. Die Realität, wie sie von Unternehmen und Ökonomen beschrieben wird, ist jedoch eine andere: Zölle sind Abgaben, die Importe verteuern. Diese Kosten werden in der Regel entlang der Lieferkette weitergegeben – vom Importeur über den Groß- und Einzelhandel bis hin zum Endverbraucher. Die Vorstellung, Unternehmen wie Walmart könnten oder würden diese Zusatzkosten vollständig absorbieren, ignoriert die betriebswirtschaftlichen Grundlagen, insbesondere in Branchen mit geringen Gewinnmargen.
Trumps barsche Aufforderung an Walmart, die Zölle zu „fressen“, ist somit mehr politische Inszenierung als ökonomische Handlungsanweisung. Es ist ein Versuch, die Verantwortung für steigende Preise von sich zu weisen und auf die Unternehmen abzuwälzen. Seine Behauptung, er werde die Zölle für andere Länder in den nächsten Wochen festlegen und dabei „sehr fair“ sein, während gleichzeitig von „150 Ländern, die ein Abkommen schließen wollen“ die Rede ist, zeugt von einem erratischen und wenig berechenbaren Kurs. Selbst wenn es, wie behauptet, zu einem Kompromiss mit China käme, den Peking jedoch bestreitet, bleibt die Unsicherheit ein Gift für die Wirtschaft.
Die Handelspolitik ist dabei nur ein Teil einer größeren Agenda. Trumps Feldzug gegen Diversitätsinitiativen in Unternehmen wie Verizon, seine harte Linie in der Einwanderungspolitik, inklusive der umstrittenen Anwendung eines Gesetzes aus dem Jahr 1798 zur Abschiebung venezolanischer Migranten, oder die Diskussionen um das Geburtsortsprinzip – all dies sind Facetten eines politischen Stils, der auf Konfrontation und Disruption setzt. Die Handelspolitik mit ihren Zöllen dient hierbei nicht nur als vermeintliches Instrument zur „Beilegung von Rechnungen“ und zur „Friedensstiftung“, sondern auch als Mittel, um Stärke zu demonstrieren und innenpolitisch zu mobilisieren, selbst wenn die Kollateralschäden für die eigene Bevölkerung und Wirtschaft beträchtlich sind. Der Präsident, der einst mit dem Versprechen antrat, die Inflation zu beenden und Amerika für alle erschwinglich zu machen, riskiert mit seiner Zollpolitik genau das Gegenteil. Das Spiel mit den Zöllen ist ein hochriskantes Unterfangen – und die amerikanischen Bürger könnten am Ende diejenigen sein, die den höchsten Preis zahlen.