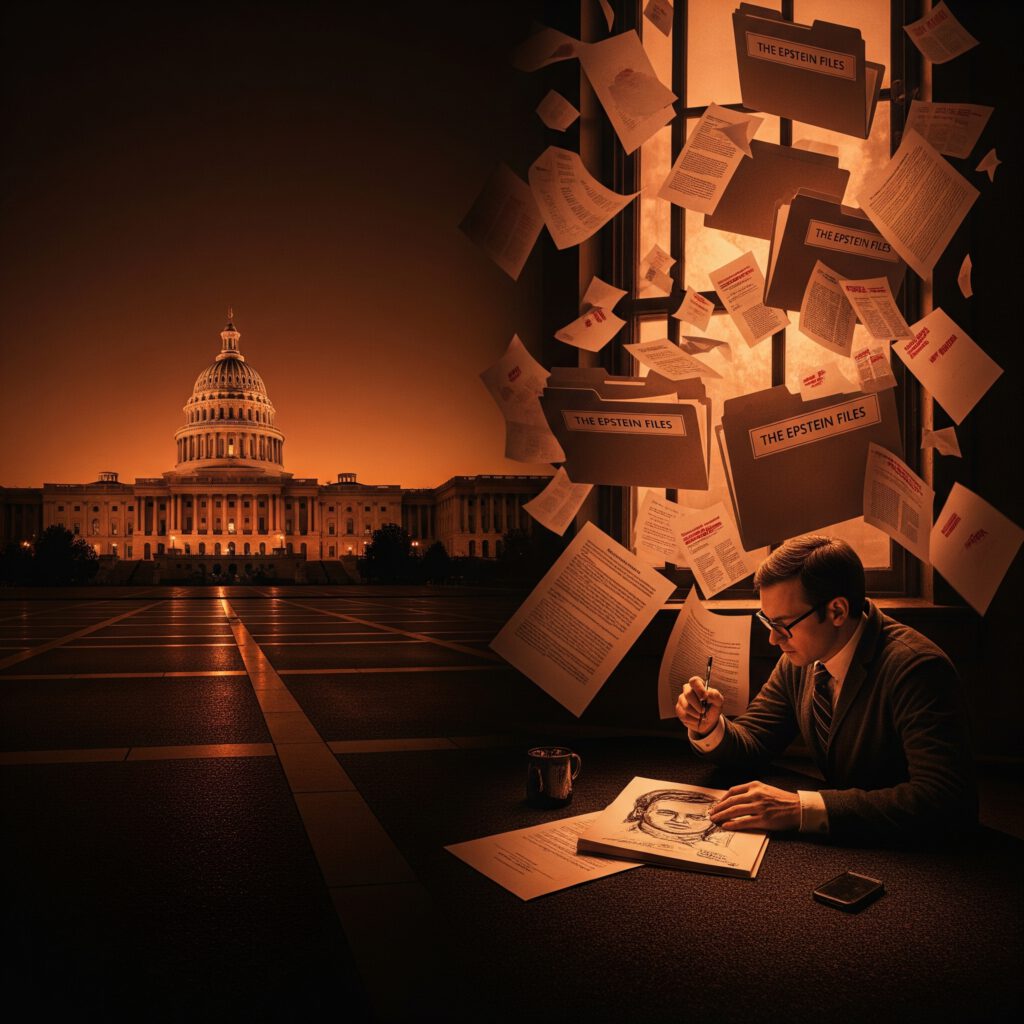Es ist kurz nach Mitternacht, als eine neue Zeitrechnung beginnt. Kein dramatischer Umsturz, kein lauter Knall, sondern das leise, fast unmerkliche Inkrafttreten einer Politik, die das Fundament des globalen Handels erschüttert. Mit der Präzision eines Uhrwerks schnappen die von Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle zu und legen sich wie ein unsichtbares Netz über die Warenströme von mehr als 90 Nationen. Dies ist kein gewöhnlicher politischer Akt; es ist der Beginn eines radikalen Experiments, das den amerikanischen Leitzins für Zölle auf den höchsten Stand seit fast einem Jahrhundert katapultiert. Die erklärte Mission: Amerikas Industrie wiederzubeleben, als unfair empfundene Handelsbeziehungen neu zu justieren und die Abhängigkeit von China zu kappen. Doch unter der Oberfläche dieser nationalistischen Rhetorik entfaltet sich ein Drama von globalem Ausmass, dessen Drehbuch täglich neu geschrieben wird – ein Drama voller unbeabsichtigter Konsequenzen, cleverer Umgehungsstrategien und erzwungener Loyalitäten.
Die Trump-Administration inszeniert ihre Handelspolitik als einen Befreiungsschlag für die amerikanische Wirtschaft. Doch was als Akt der Stärke und Selbstbehauptung verkauft wird, erweist sich bei näherer Betrachtung als ein hochriskantes Spiel mit unkalkulierbarer Streuung. Es ist eine Politik, die nicht nur die globalen Lieferketten in ein chaotisches Labyrinth verwandelt, sondern auch tiefe Gräben in der heimischen Wirtschaft aufreisst und die Last am Ende auf jene abwälzt, die sie eigentlich zu schützen vorgibt: die amerikanischen Unternehmen und Verbraucher. Die zentrale These, die sich aus den Trümmern der alten Handelsordnung erhebt, ist daher eine zutiefst beunruhigende: Trumps Zollpolitik ist weniger ein strategisches Werkzeug zur wirtschaftlichen Erneuerung als vielmehr eine Waffe, die ein globales Katz-und-Maus-Spiel entfesselt, die Grenzen zwischen Wirtschafts- und Machtpolitik verwischt und eine neue Ära der Unberechenbarkeit einläutet, deren wahren Preis noch niemand beziffern kann.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Das grosse Umlenken: Chinas Schatten-Exporte und die Grenzen der Zollmauern
Im Zentrum von Trumps handelspolitischem Feldzug steht der Konflikt mit China. Ein zusätzlicher Strafzoll von 30 Prozent auf chinesische Waren soll die Waage des Handels wieder ins Gleichgewicht bringen, die sich seit Jahrzehnten massiv zugunsten Pekings neigt. Doch die Reaktion aus dem Reich der Mitte ist ebenso raffiniert wie vorhersehbar. Anstatt zu kapitulieren, haben chinesische Unternehmen einen wirtschaftlichen Umweg gefunden, eine Art handelspolitische Guerilla-Taktik: das „Transshipment“. Die Waren werden nicht mehr direkt in die USA verschifft, wo sie von den Zöllen erfasst würden. Stattdessen nehmen sie den Weg über Drittländer, allen voran in Südostasien und Afrika. Dort werden sie umdeklariert, um ihre wahre Herkunft zu verschleiern, und treten dann ihre Weiterreise in die amerikanischen Häfen an.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Während Chinas direkte Exporte in die USA im Juli um mehr als ein Fünftel einbrachen, schossen die Ausfuhren in die Transitregionen durch die Decke. Die Exporte nach Südostasien stiegen im selben Monat um 16,6 Prozent, jene nach Afrika sogar um atemberaubende 42,4 Prozent. Seit Beginn von Trumps erster Amtszeit haben sich diese Exporte nahezu verdreifacht. Es ist ein gigantisches Umlenkungsmanöver, das die intendierte Wirkung der Zölle untergräbt und die Zollmauern porös wie einen Schweizer Käse erscheinen lässt. Die Trump-Administration ist sich dieser Entwicklung bewusst und plant Gegenmassnahmen. Neue, schärfere Regeln sollen definieren, was als Umgehungsversuch gilt, und auf derartige Waren sollen künftig Zölle von 40 Prozent erhoben werden. Doch dieser Versuch, die Löcher zu stopfen, könnte neue, unvorhergesehene Probleme schaffen. Denn die Flut chinesischer Waren sorgt mittlerweile auch in den Transitländern für Unbehagen. Staaten wie Indonesien oder Südafrika fürchten, von der chinesischen Konkurrenz erdrückt zu werden, und haben ihrerseits bereits mit Schutzzöllen reagiert. Das Spiel geht in die nächste Runde, wird komplexer und unübersichtlicher.
Der Preis der „Befreiung“: Wer zahlt die Rechnung für Trumps Handelskrieg?
Während Präsident Trump seine Politik als Quelle sprudelnder Zolleinnahmen feiert und behauptet, die Kosten würden „deutlich sinken“, zeichnen Ökonomen und Wirtschaftsdaten ein gänzlich anderes, düstereres Bild. Die Zölle wirken wie eine unsichtbare Steuer, die sich durch die Lieferketten frisst und am Ende auf den Preisschildern im Supermarkt und im Autohaus landet. Es sind die amerikanischen Verbraucher, die die Zeche zahlen. Bereits jetzt werden Produkte wie Haushaltsgeräte, Kleidung und Möbel teurer. Ökonomen wie Mark Zandi von Moody’s Analytics warnen vor einem „sehr stagflationsähnlichen“ Umfeld – einer toxischen Mischung aus stagnierender Wirtschaft und steigenden Preisen.
Die Zahlen untermauern diese Sorge. Das Wirtschaftswachstum hat sich auf ein anämisches Tempo verlangsamt, und auch der Arbeitsmarkt zeigt erste Risse mit einem deutlich verlangsamten Stellenaufbau im Juli. Das Budget Lab der Universität Yale hat errechnet, dass die Zölle einen durchschnittlichen amerikanischen Haushalt jährlich 2.400 Dollar kosten könnten. Gleichzeitig könnte die Wirtschaftsleistung um einen halben Prozentpunkt sinken. Diese Fakten stehen in krassem Widerspruch zur Darstellung des Präsidenten, der die negativen Daten kurzerhand als politisch motivierte Fälschung abtut und den Leiter der zuständigen Statistikbehörde feuerte. Unternehmen bestätigen die Einschätzung der Experten. Procter & Gamble, Nike, Hasbro und der Schuhhersteller Weyco haben bereits angekündigt oder vollzogen, die gestiegenen Zollkosten durch höhere Preise an die Kunden weiterzugeben. Es ist eine einfache wirtschaftliche Logik, die sich nicht durch politische Rhetorik aushebeln lässt: Am Ende der Kette zahlt der Konsument.
Das Halbleiter-Gambit: Zwischen nationaler Sicherheit und erzwungener Loyalität
Nirgendwo wird die Ambivalenz von Trumps Handelspolitik so deutlich wie im Fall der Halbleiter. Diese winzigen Chips sind das Herzstück jeder modernen Technologie, von Smartphones über Autos bis hin zu Waffensystemen. Die Abhängigkeit von asiatischen, insbesondere taiwanischen Produzenten, wird in Washington seit Langem als strategisches Risiko betrachtet. Trumps Lösung ist radikal: ein angedrohter Zoll von 100 Prozent auf alle importierten Halbleiter. Es ist ein wirtschaftliches Damoklesschwert, das über der globalen Tech-Industrie schwebt. Doch der Präsident hat eine Hintertür eingebaut, einen Ausweg, der seine Politik von einem reinen Schutzinstrument in einen mächtigen Verhandlungshebel verwandelt. Von den Zöllen befreit wird, wer sich verpflichtet, in den USA zu investieren und zu produzieren.
Dieser Ansatz markiert eine fundamentale Abkehr von der Strategie der Vorgängerregierung. Während die Biden-Administration mit dem CHIPS and Science Act auf Subventionen und finanzielle Anreize setzte, um die heimische Produktion anzukurbeln, ersetzt Trump die Karotte durch den Stock. Er zwingt die Unternehmen zu einer öffentlichen Loyalitätsbekundung, die in Milliarden Dollar gemessen wird. Das prominenteste Beispiel ist Apple. An der Seite von CEO Tim Cook verkündete Trump im Oval Office die neue Politik. Im Gegenzug für eine Befreiung von den Zöllen erhöhte Apple seine Zusage für Investitionen in den USA auf eine schwindelerregende Summe von 600 Milliarden Dollar. Dieses Zusammenspiel schafft eine Art „Pay-to-Play“-Dynamik. Der Präsident erhält die Möglichkeit, Unternehmensentscheidungen direkt zu beeinflussen und sich mit öffentlichkeitswirksamen Investitionsdeals zu schmücken. Für die Firmen entsteht eine enorme Unsicherheit, da die genauen Kriterien für eine Befreiung – wie viel Investition ist genug? – im Unklaren bleiben und dem Präsidenten einen erheblichen Ermessensspielraum geben.
Zölle als Waffe: Wenn Handelspolitik zur Aussenpolitik wird
Die neue Zollpolitik ist längst mehr als nur ein wirtschaftspolitisches Instrument. Sie wird zunehmend zu einer Waffe im aussenpolitischen Arsenal des Präsidenten, die er gezielt einsetzt, um politischen Druck auszuüben. Die Logik ist simpel: Wer sich nicht an Washingtons Linie hält, wird mit wirtschaftlichen Nachteilen bestraft. So wurden hohe Zölle gegen Brasilien als Vergeltung für die Strafverfolgung des ehemaligen, mit Trump verbündeten Präsidenten Jair Bolsonaro verhängt. Indien drohen Zölle von 50 Prozent, weil das Land russisches Öl kauft. Selbst kleinere Konflikte, wie jener zwischen Thailand und Kambodscha, versucht Trump durch die Androhung von Handelsbarrieren zu beeinflussen.
Diese Politisierung des Handels schafft eine unberechenbare und volatile Umgebung für global agierende Unternehmen. Die Geschichte des Schuhherstellers Weyco ist hierfür ein bezeichnendes Beispiel. Um den hohen Zöllen auf chinesische Waren zu entgehen, verlagerte das Unternehmen einen Teil seiner Produktion nach Indien. Kaum war diese kostspielige Umstellung im Gange, wurde während einer Telefonkonferenz mit Investoren bekannt, dass Trump nun auch die Zölle auf indische Produkte drastisch anheben will. Der CEO konnte nur noch resigniert feststellen, dass man nun eventuell gezwungen sei, die Produktion wieder zurück nach China zu verlagern. Dieses Beispiel entlarvt die Illusion einer strategisch geplanten Industriepolitik. Stattdessen erleben wir eine impulsive, von politischen Launen getriebene Politik, die Unternehmen in einem ständigen Zustand der Ungewissheit gefangen hält und jede langfristige Planung unmöglich macht.
Am Ende dieses tiefen Einblicks in die Mechanik von Trumps Handelspolitik bleibt ein beunruhigendes Gesamtbild. Der Versuch, die amerikanische Wirtschaft mit dem Vorschlaghammer der Zölle neu zu formen, hat eine Kettenreaktion globaler Verwerfungen ausgelöst. Die angestrebte Abkopplung von China führt zu kreativen, aber destabilisierenden Umgehungsstrategien. Der angebliche Schutz der heimischen Industrie wird mit höheren Preisen für die eigenen Bürger und einer lähmenden Unsicherheit für Unternehmen erkauft. Und die Verwandlung von Zöllen in eine politische Waffe macht die Weltwirtschaft zu einem unberechenbaren Spielfeld.
Zudem schwebt über dem gesamten Konstrukt die Frage der Rechtmässigkeit. Die Zölle basieren auf einer weitreichenden Auslegung präsidialer Notstandsbefugnisse, die bereits vor Gerichten angefochten wird. Ein Urteil gegen die Regierung könnte das gesamte handelspolitische Kartenhaus über Nacht zum Einsturz bringen und die Frage wohl bis vor den Supreme Court tragen. Unabhängig vom juristischen Ausgang ist der wirtschaftliche und politische Schaden bereits spürbar. Trumps Handelskrieg mag aus dem Versprechen angetreten sein, Amerika wieder gross zu machen. Doch im Moment scheint er vor allem eine Welt zu schaffen, die für alle Beteiligten – Verbündete, Gegner, Unternehmen und Bürger – vor allem eines ist: unberechenbarer, teurer und gefährlicher.