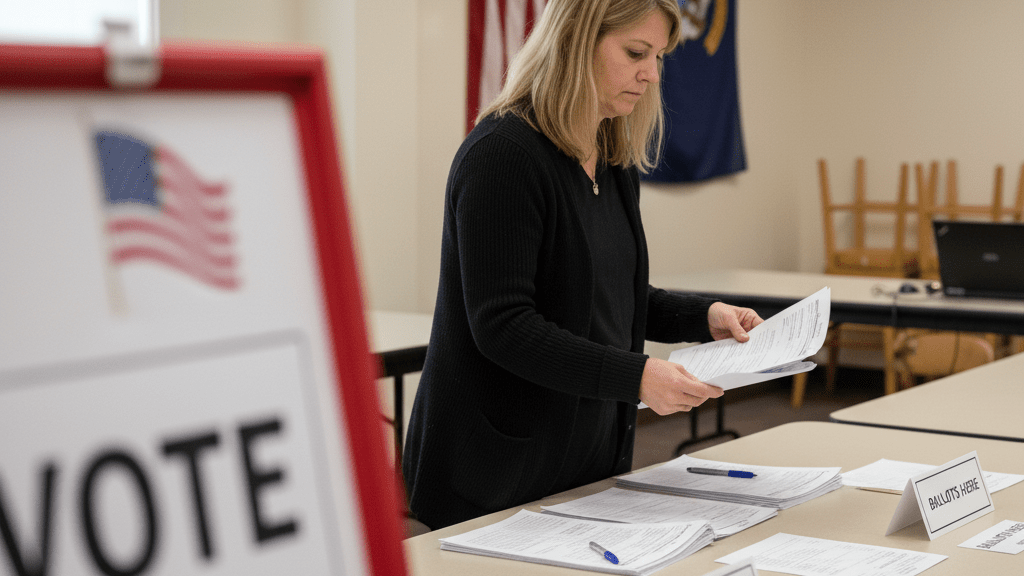
Ein Jahr vor den entscheidenden Zwischenwahlen 2026 bieten die Vereinigten Staaten das Bild eines politischen Paradoxons. Die Nation ist erschöpft, die Regierung befindet sich im Stillstand, und der Präsident, Donald Trump, regiert zunehmend an den Institutionen vorbei. Umfragen zeichnen ein düsteres Bild seiner Amtsführung: Eine satte Mehrheit von 59 Prozent lehnt seinen Kurs ab. Seine Kerninitiativen, von der Wirtschaftspolitik (62 Prozent Ablehnung) über Zölle (65 Prozent Ablehnung) bis zur reinen Verwaltung des Regierungsapparats (63 Prozent Ablehnung), finden in der Bevölkerung keinen Rückhalt.
Man sollte meinen, dies sei ein gefundenes Fressen für die Opposition, ein offenes Feld für einen Erdrutschsieg. Doch wer im Herbst 2025 auf die Demokratische Partei blickt, sieht keine triumphierende Alternative, sondern eine Partei in einer tiefen strategischen und kulturellen Krise. Die Demokraten scheitern derzeit nicht an Trumps Stärke. Sie scheitern an sich selbst.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die „Abgehobenheits-Falle“: Warum Trumps Krise kein Geschenk ist
Der Government Shutdown, ausgelöst durch einen erbitterten Streit über auslaufende Gesundheitssubventionen (ACA), legt die Wirtschaft lahm und trifft Millionen Amerikaner empfindlich. Die Öffentlichkeit macht dafür primär Trump und die Republikaner verantwortlich (45 Prozent). Gleichzeitig hält eine überwältigende Mehrheit von 64 Prozent Trumps Versuche, die Macht der Präsidentschaft auszubauen, für einen Schritt „zu weit“.
Doch diese massive Unzufriedenheit übersetzt sich nicht in Unterstützung für die Demokraten. Im Gegenteil: Das Rennen um die Kongressmehrheit 2026 ist mit 46 Prozent für die Demokraten zu 44 Prozent für die Republikaner gefährlich knapp – eine statistische Pattsituation. Der Grund offenbart eine schmerzhafte Wahrheit für die Demokraten: Sie werden als noch stärker von der Lebensrealität der Menschen entfernt wahrgenommen als die Regierung. Auf die Frage, wer „out of touch“ (abgehoben) sei, nennen 63 Prozent Trump und 61 Prozent die Republikanische Partei. Doch ganze 68 Prozent der Amerikaner sagen dasselbe über die Demokratische Partei. Sie haben die Unbeliebtheit des Präsidenten nicht nur eingeholt, sie haben sie übertroffen. Dieses Dilemma zeigt sich bei den „moderaten Ablehnern“. Jene Wähler, die Trumps Kurs zwar missbilligen, aber nicht fundamental hassen, sind die entscheidende Gruppe für eine Mehrheit. Doch genau diese Gruppe können die Demokraten nicht bündeln. Wähler, die Trump nur „moderat ablehnen“ (disapprove somewhat), sind gespalten: 36 Prozent würden den demokratischen Kandidaten wählen, aber 35 Prozent den republikanischen. Fast 30 Prozent von ihnen würden lieber gar nicht wählen. Die Unzufriedenheit mit Trump führt nicht automatisch in die Arme der Opposition; oft führt sie in die Apathie.
„Verrückt“ gegen „belehrend“: Die kulturelle Entfremdung der Demokraten
Wie konnte es so weit kommen? Die Diagnosen sind vielfältig, doch sie kreisen alle um einen Kern: eine kulturelle Entfremdung. Der Kolumnist Ezra Klein liefert eine provokante These: In unzähligen Fokusgruppen höre man von Wählern, die Republikaner seien „verrückt“ (crazy), die Demokraten aber „belehrend“ (preachy). Und viele Wähler, so die bittere Pointe, nehmen lieber „verrückt“ als „belehrend“, denn „verrückt schaut wenigstens nicht auf mich herab“. Es ist das Gefühl einer Partei, die, wie Klein argumentiert, zwischen 2012 und 2024 eine scharfe Linkswendung vollzogen hat und dabei den Kontakt zu jenen Gruppen verlor, die einst ihre Basis bildeten: hispanische Wähler, junge Wähler, Arbeiter. Der Motor dieser Entfremdung sei eine „professionelle politische Klasse“, die in einer nationalisierten Medien- und Online-Blase lebt. Diese Klasse, so die Analyse, betreibe „Überzeugung ohne Repräsentation“ – sie höre den Wählern nicht mehr zu, sondern erkläre ihnen, warum ihre Anliegen falsch seien.
Andere Analysen, etwa aus Leserbriefen, stützen diese Diagnose, setzen aber andere Akzente. Es sei nicht nur die belehrende Kultur, sondern ein fundamentaler Vertrauensverlust – etwa durch die Hinterzimmer-Manöver bei der Nominierung von Kamala Harris 2024. Es sei die Assoziation der gesamten Partei mit „Fringe-Ideen“ (Randgruppen-Ideen) wie offenen Grenzen oder einer toleranten Kriminalitätspolitik, die der Marke schadeten. Oder es sei, ganz profan, eine überalterte Führung („elders“), die den notwendigen Wandel blockiere und den Kontakt zur nächsten Generation verloren habe.
Die Zerreißprobe: Muss Politik „gut“ sein oder Wahlen gewinnen?
Diese kulturelle Kluft mündet in eine strategische Zerreißprobe. Die Demokraten stecken fest zwischen „expressiver“ Politik (Haltung zeigen, moralisch rein sein) und „konsequenter“ Politik (Mehrheiten gewinnen, um Dinge umzusetzen). Nirgendwo wird dies deutlicher als im Umgang mit den eigenen Abweichlern. Politiker wie Joe Manchin (ehemals) oder Jared Golden sind Meister darin, in tiefroten, Trump-freundlichen Bezirken zu gewinnen. Sie sind der mathematische Beweis, dass Demokraten dort noch existieren können. Doch innerhalb der progressiven Online-Kultur werden sie als Verräter gehasst und bekämpft. Die Partei, so Kleins Argument, habe verlernt, interne Differenzen als Stärke zu sehen; sie suche „Purifikation“ (Reinigung) statt „Pluralismus“ (Vielfalt). Sie hat ihre geografische Reichweite geopfert, um ihre ideologische Kohärenz zu schärfen.
Während die Demokraten über Reinheit debattieren, schafft Trump Fakten. Er nutzt den Shutdown, um die Macht der Exekutive massiv auszubauen und Milliarden am Kongress vorbeizusteuern. Er testet die Grenzen des Sag- und Machbaren, was Sorgen um Gesetze wie den „Insurrection Act“ nährt. Selbst scheinbar bizarre Nebenkonflikte wie der Abriss des Ostflügels für einen 300-Millionen-Dollar-Ballsaal offenbaren diese Asymmetrie: Während 56 Prozent der Amerikaner das Projekt ablehnen, feiern es 62 Prozent der Republikaner. Trump bedient seine Basis mit Symbolen der Macht, während die Demokraten darüber streiten, welche Sprache sie benutzen dürfen.
Die Laboratorien 2025: Wo die Zukunft der Koalitionen getestet wird
Wie dieser Konflikt ausgeht, wird nicht erst 2026 entschieden, sondern in den „Laboratorien“ der Wahlen im Herbst 2025.
In New Jersey wird die Stabilität der neuen Koalitionen getestet. 2024 erlebte Trump massive Zugewinne bei hispanischen Wählern im Staat. War dies ein einmaliger, Trump-spezifischer Effekt, oder eine dauerhafte Neuausrichtung? Republikanische Kandidaten wie Jack Ciattarelli versuchen nun, diese Wähler – die oft unter hohem ökonomischem Stress stehen – mit einem „Trump-light“-Ansatz bei der Stange zu halten. Es ist ein Vabanquespiel: Können sie Trumps Wähler ohne Trumps Polarisierung mobilisieren?
In Virginia findet ein prozeduraler Kampf statt. Die Demokraten hatten das „Early Voting“ (die frühe Stimmabgabe) massiv ausgebaut, was ihnen 2021 half. Nun adaptieren die Republikaner diese Taktik. Obwohl sie die Regeln offiziell ablehnen, treiben sie ihre Anhänger aggressiv zur frühen Stimmabgabe. Sie beginnen, die Demokraten mit deren eigenen, datengetriebenen Waffen zu schlagen.
In Kalifornien schwelt derweil der strukturelle Kampf. Als direkte Antwort auf aggressives republikanisches Gerrymandering in Texas versuchen die Demokraten mit „Proposition 50“, die Karten neu zu zeichnen. Es ist ein strategisches Spiel mit dem Feuer: Man opfert das hochgehaltene Prinzip der „unabhängigen Redistricting-Kommission“, um kurzfristig bis zu fünf Sitze im Repräsentantenhaus zu gewinnen. Der Hebel dafür ist eine simple, hochemotionale „Stop Trump“-Botschaft, die den demokratischen Reflex zum Kampf gegen den Präsidenten nutzt.
Das zweischneidige Schwert der Immigrationspolitik
Ein zentrales Thema in Trumps Arsenal bleibt die Einwanderung. Seine Administration hat die Gangart verschärft, ICE-Razzien sind an der Tagesordnung. Die Taktik scheint klar: Abschreckung und die Mobilisierung der eigenen, harten Basis. Demokraten und Aktivisten befürchten, dass die Angst in Latino-Gemeinden die Wahlbeteiligung drückt.
Doch die Realität ist, wie so oft, komplexer. Die Datenlage zur Wahlbeteiligung ist unklar. Stattdessen berichten Medien und Wähler in Kalifornien von einem gegenteiligen Effekt: Wut statt Angst. Trumps Härte scheint bei manchen eine Gegenmobilisierung auszulösen. Josefa Rivera, eine eingebürgerte Bürgerin, ging extra persönlich zur Wahl (für Prop 50), um ein Zeichen zu setzen. Sie stimme, so sagte sie, nicht nur für sich selbst, sondern „für jene, die nicht sprechen können“. Trumps Versuch, eine Gruppe einzuschüchtern, könnte unbeabsichtigt den politischen Widerstand Tausender anderer geweckt haben.
Der Kampf um Repräsentation
Die Demokraten stehen an einem Kipppunkt. Die Wahlen 2025 sind mehr als nur Regionalwahlen; sie sind ein Referendum über die Seele und die Strategie der Partei. Um 2026 zu gewinnen, reicht es nicht, auf Trumps anhaltende Unbeliebtheit zu hoffen. Die Partei muss, wie es die Analysen nahelegen, das zurückgewinnen, was sie in den letzten zehn Jahren verloren hat: die geografische Breite. Sie muss wieder lernen, Menschen zu „repräsentieren“, die, wie Klein es formulierte, „wirklich andere Menschen sind“ – nicht nur Objekte der eigenen, oft als belehrend empfundenen Philanthropie.
Der Government Shutdown wird irgendwann enden. Trumps umstrittener Ballsaal wird vielleicht gebaut. Aber die Frage, ob die Demokratische Partei wieder eine Mehrheitspartei werden kann, die mehr Orte als nur die urbanen Zentren und ihre Online-Echokammern gewinnt, ist die eigentliche, ungelöste Krise der amerikanischen Politik im Herbst 2025.


