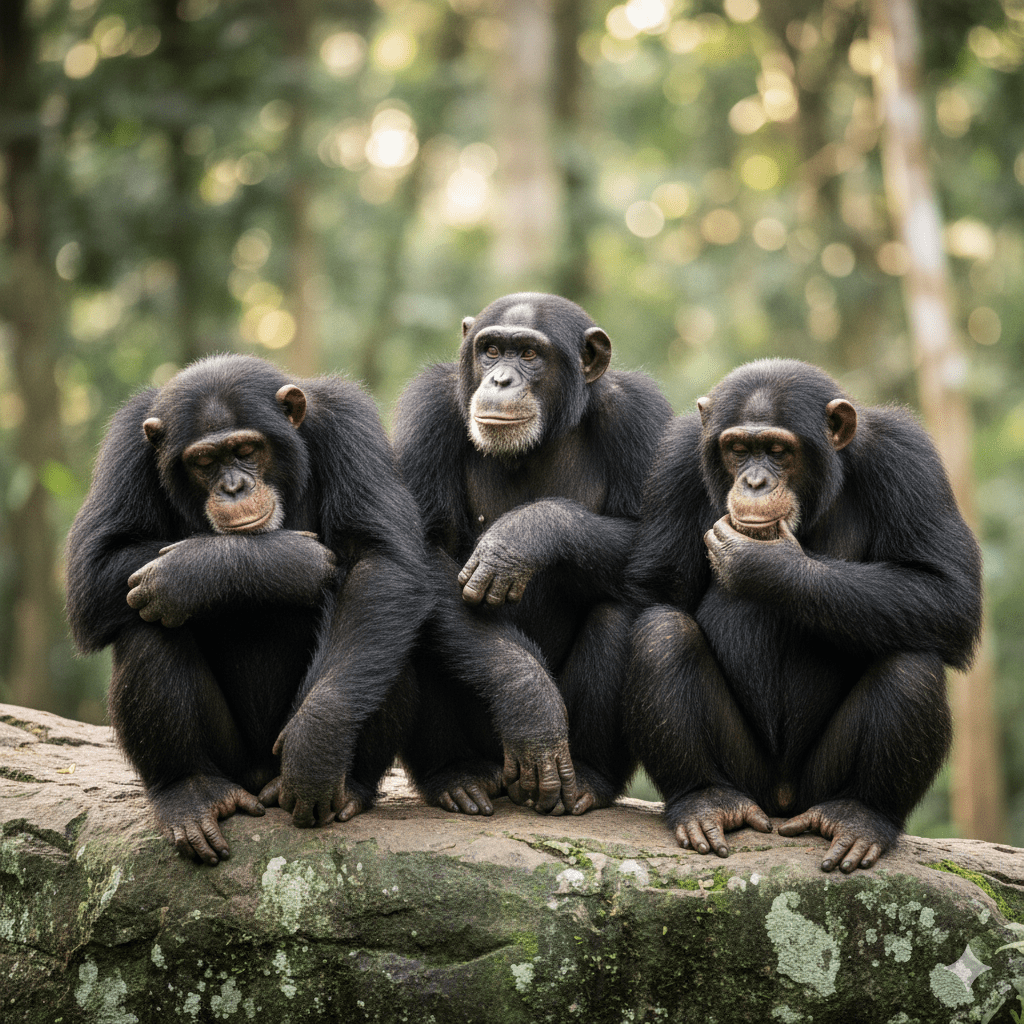Ein Händedruck, der Bände spricht. Als Chinas Staatschef Xi Jinping und der indische Premierminister Narendra Modi am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Tianjin aufeinandertreffen, ist die Szene mehr als nur diplomatische Routine. Sie ist das sichtbare Symptom einer tektonischen Verschiebung in der globalen Machtarchitektur – ein Akt, der vor wenigen Monaten noch undenkbar schien und der seinen wahren Architekten nicht im Raum, sondern Tausende von Kilometern entfernt in Washington hat. Denn es ist die Politik von US-Präsident Donald Trump, die zwei erbitterte asiatische Rivalen in ein ebenso unbehagliches wie unausweichliches Bündnis zwingt. Trumps aggressive Handelspolitik, gekrönt von drakonischen 50-Prozent-Strafzöllen gegen Indien, hat nicht nur eine jahrzehntelange amerikanische Strategie pulverisiert; sie liefert China, dem Hauptkonkurrenten der USA, einen strategischen Triumph auf dem Silbertablett. Die Welt blickt auf eine erzwungene Annäherung, deren Fundament nicht auf Vertrauen, sondern auf der gemeinsamen Abwehr eines unberechenbaren Freundes ruht. Es ist ein geopolitisches Paradox, das die Landkarte der Loyalitäten neu zeichnet und die Frage aufwirft, ob Washington gerade dabei ist, einen seiner wichtigsten Partner zu verlieren – und das ausgerechnet an seinen größten Gegner.
Ein Riss im Fundament: Wie eine sorgsam gepflegte Freundschaft zerbrach
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die Entfremdung zwischen Washington und Neu-Delhi so tief ist, gerade weil die persönliche Beziehung zwischen Donald Trump und Narendra Modi einst so eng schien. Modi hatte viel in diese Männerfreundschaft investiert, inszenierte pompöse Empfänge wie „Howdy Modi!“ in Texas und „Namaste Trump!“ in seinem Heimatstaat Gujarat und wich damit von Indiens traditioneller Blockfreiheit ab. Man wähnte sich auf der sicheren Seite, ein spezieller Partner, geschützt vor den Launen eines Präsidenten, der Außenpolitik vor allem als eine Abfolge persönlicher Deals und Loyalitätstests begreift.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch dieser Schutzschild zerbarst im Sommer 2025 mit ohrenbetäubendem Lärm. Der Auslöser war eine für Indien hochsensible Angelegenheit: der schwelende Konflikt mit dem Erzfeind Pakistan. Trump brüstete sich wiederholt damit, durch seine persönliche Intervention einen Krieg zwischen den beiden Atommächten verhindert zu haben. Mehr noch, er implizierte, Modi solle ihn – wie es Pakistan bereits getan hatte – für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Für Modi, dessen Image des starken Mannes maßgeblich auf einer unnachgiebigen Haltung gegenüber Pakistan beruht, war dies eine öffentliche Demütigung. Eine amerikanische Mediation in dieser Frage zu akzeptieren, ist in der indischen Politik seit jeher ein Tabu. Modis schroffe Zurückweisung verletzte Trumps Ego an einem wunden Punkt.
Was folgte, war eine Strafaktion, die Analysten als Mischung aus gekränkter Eitelkeit und handelspolitischem Groll beschreiben. Zuerst kündigte Washington eine allgemeine Zollrunde an, doch dann wurde Indien – gemeinsam mit Brasilien – mit einem Rekordstrafzoll von 50 Prozent belegt. Die offizielle Begründung war zweigeteilt: 25 Prozent als allgemeiner Strafzoll auf Handelsungleichgewichte und weitere 25 Prozent als Sanktion für Indiens fortgesetzte Käufe von russischem Öl und Waffen. In Neu-Delhi empfand man dies als „gundagardi“ – als pure Schikane. Schließlich hatte die vorherige US-Regierung Indien ermutigt, russisches Öl zu kaufen, um die globalen Energiepreise zu stabilisieren. Zudem kauft China, das mit einem moderateren Zoll von 30 Prozent davonkam, weitaus mehr russisches Öl. Die Botschaft an Indien war unmissverständlich: Wer sich dem Willen des Präsidenten widersetzt, zahlt einen hohen Preis. Die über 30 Jahre sorgsam aufgebaute Partnerschaft, von Bill Clinton als „natürliche Allianz“ bezeichnet und von seinen Nachfolgern als definierendes Bündnis des 21. Jahrhunderts gepriesen, lag in Trümmern.
Der Elefant tanzt mit dem Drachen: Ein Zweckbündnis aus der Not geboren
In dem Moment, in dem die Tür nach Washington zuschlug, öffnete sich eine andere in Richtung Osten. Narendra Modis Reise nach Tianjin war mehr als nur die Teilnahme an einem regionalen Gipfel; sie war ein diplomatischer Canossagang und seine erste Chinareise seit sieben Jahren. Die Beziehungen zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Nationen der Welt hatten einen Tiefpunkt erreicht. Noch im Jahr 2020 waren ihre Soldaten im Himalaja in brutalen Gefechten aufeinandergeprallt, bei denen mindestens 20 indische Soldaten ihr Leben verloren. Seitdem stehen sich Zehntausende Soldaten an der unmarkierten Grenze kampfbereit gegenüber. Indien verbot Hunderte chinesische Apps, darunter TikTok, und blockierte chinesische Investitionen.
Dass Modi nun ausgerechnet nach China reist, während Peking den Vorsitz der SOZ innehat, ist ein deutliches Signal, das in Washington nicht unbemerkt bleiben dürfte. Es ist die direkte Konsequenz des amerikanischen Drucks, der Neu-Delhi dazu zwingt, eine Politik der Risikominimierung zu betreiben und sich nach Alternativen umzusehen. China, das die Situation meisterhaft für sich zu nutzen weiß, rollt den roten Teppich aus. Xi Jinping spricht poetisch vom „Tanz des Drachen und des Elefanten“, der die richtige Entscheidung für beide Seiten sei. Für Peking ist Modis Besuch ein diplomatischer Coup. Er zeigt der Welt und insbesondere dem Globalen Süden, dass Indien sich nicht dem amerikanischen Kurs zur Eindämmung Chinas anschließt.
Doch hinter der Fassade der neuen Harmonie verbirgt sich ein tiefes strategisches Dilemma für Indien. Das Land sieht sich mit einem massiven und wachsenden Handelsdefizit gegenüber China konfrontiert, das im letzten Jahr auf 129 Milliarden US-Dollar anstieg. Zudem herrscht eine gefährliche Abhängigkeit von chinesischen Vorprodukten und Rohstoffen wie Seltenen Erden. China bleibt für Indien die größte strategische Bedrohung. Modis Annäherung ist daher kein Liebesbündnis, sondern ein pragmatischer Balanceakt. Er muss mit einem Rivalen kooperieren, um dem Druck eines unzuverlässigen Freundes standzuhalten. Es ist ein Spiel mit hohem Einsatz, bei dem Indien riskiert, zwischen den Stühlen zerrieben zu werden.
Zahlen, Jobs und Zukunftsängste: Die harte Realität hinter den Zöllen
Die amerikanischen Strafzöller sind keine abstrakte diplomatische Drohgebärde; sie treffen die indische Wirtschaft ins Mark. Mit den USA als bislang größtem Exportmarkt droht ein schwerer Schlag. Besonders verwundbar ist die Textilindustrie, der viertgrößte Hersteller der Welt und ein Sektor, der Millionen von Menschen beschäftigt. Analysten befürchten, dass die Exporte in diesem preissensiblen Markt um bis zu 70 Prozent einbrechen könnten, was kurzfristig bis zu zwei Millionen Arbeitsplätze gefährden würde. Auch andere Branchen wie Schmuck, Meeresfrüchte und Leder sind von der vollen 50-Prozent-Abgabe betroffen. Zwar sind wichtige Güter wie Generika, Elektronikprodukte wie in Indien gefertigte iPhones und Erdölprodukte von den Zöllen ausgenommen, doch der Schaden für die beschäftigungsintensiven Sektoren bleibt immens.
Die indische Regierung versucht gegenzusteuern, indem sie den Binnenkonsum ankurbelt und Exporterleichterungen schafft. Doch die Frage bleibt: Kann eine stärkere Anlehnung an China und die SOZ-Staaten den Verlust des riesigen amerikanischen Marktes kompensieren? Die Daten legen nahe, dass dies kaum realistisch ist. Die SOZ-Mitglieder machen zusammen zwar etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung aus, aber nur rund ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung. Die Organisation ist zudem von internen Rivalitäten und tiefem Misstrauen geprägt und besitzt keine starke institutionelle Struktur, um als geschlossener Wirtschaftsblock zu agieren.
Peking versucht zwar, Indien mit wirtschaftlichen Gesten zu locken, etwa durch die Zusage, Exportbeschränkungen für Seltene Erden oder Düngemittel aufzuheben. Doch dies kann die strukturellen Probleme nicht lösen. Indiens wirtschaftliche Zukunft hängt an einem seidenen Faden. Die Regierung muss einen Weg finden, die unmittelbaren wirtschaftlichen Schmerzen zu lindern, ohne sich in eine langfristige Abhängigkeit von ihrem größten geopolitischen Konkurrenten zu begeben.
Ein Tango auf dünnem Eis: Die ungewisse Zukunft der neuen Nähe
Trotz der symbolträchtigen Bilder aus Tianjin bleibt die Annäherung zwischen Indien und China ein fragiles Gebilde. Narendra Modi selbst unternimmt alles, um den Eindruck einer anti-westlichen Achse zu vermeiden. Unmittelbar vor seiner Reise nach China besuchte er Japan, einen wichtigen Partner des Westens und ebenfalls ein Rivale Chinas. In Tianjin angekommen, telefonierte er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und sicherte ihm Unterstützung zu – ein klares Signal in Richtung Washington und Moskau. Modi weigerte sich auch, an einem von China gewünschten trilateralen Treffen mit Wladimir Putin teilzunehmen. Seine Botschaft ist klar: Indien verfolgt eine Politik der strategischen Autonomie und lässt sich seine Beziehungen nicht von einer dritten Partei diktieren.
Die grundlegenden Konflikte zwischen den beiden asiatischen Giganten sind damit keineswegs gelöst. Die Grenzfrage im Himalaja bleibt ein Pulverfass. China unterstützt weiterhin Indiens Erzfeind Pakistan militärisch und wirtschaftlich. Und Pekings Anspruch auf eine Vormachtstellung in Asien steht im direkten Widerspruch zu Indiens eigener Ambition als aufsteigende Globalmacht. Analysten sind sich daher einig: Das große Ganze hat sich nicht verändert. Die derzeitige Entspannung ist ein taktisches Manöver, geboren aus der Notwendigkeit, dem Druck aus Washington standzuhalten. Die Zukunft dieses Verhältnisses hängt von mehreren Faktoren ab. Sollte sich der handelspolitische Kurs der USA unter Trump verfestigen, könnte dies Indien und China weiter zusammenschweißen. Eine Eskalation an der Grenze oder ein offener Konflikt zwischen Indien und Pakistan, bei dem China sich auf die Seite Islamabads stellt, könnte die zarten Bande jedoch sofort wieder zerreißen. Am Ende ist der „Tanz des Drachen und des Elefanten“ ein riskanter Balanceakt auf dünnem Eis. Beide Akteure wissen, dass der Partner von heute morgen wieder der Rivale von gestern sein kann. Für den Moment jedoch hat Donald Trumps Politik sie zu Tanzpartnern wider Willen gemacht – mit ungewissem Ausgang für die globale Ordnung.