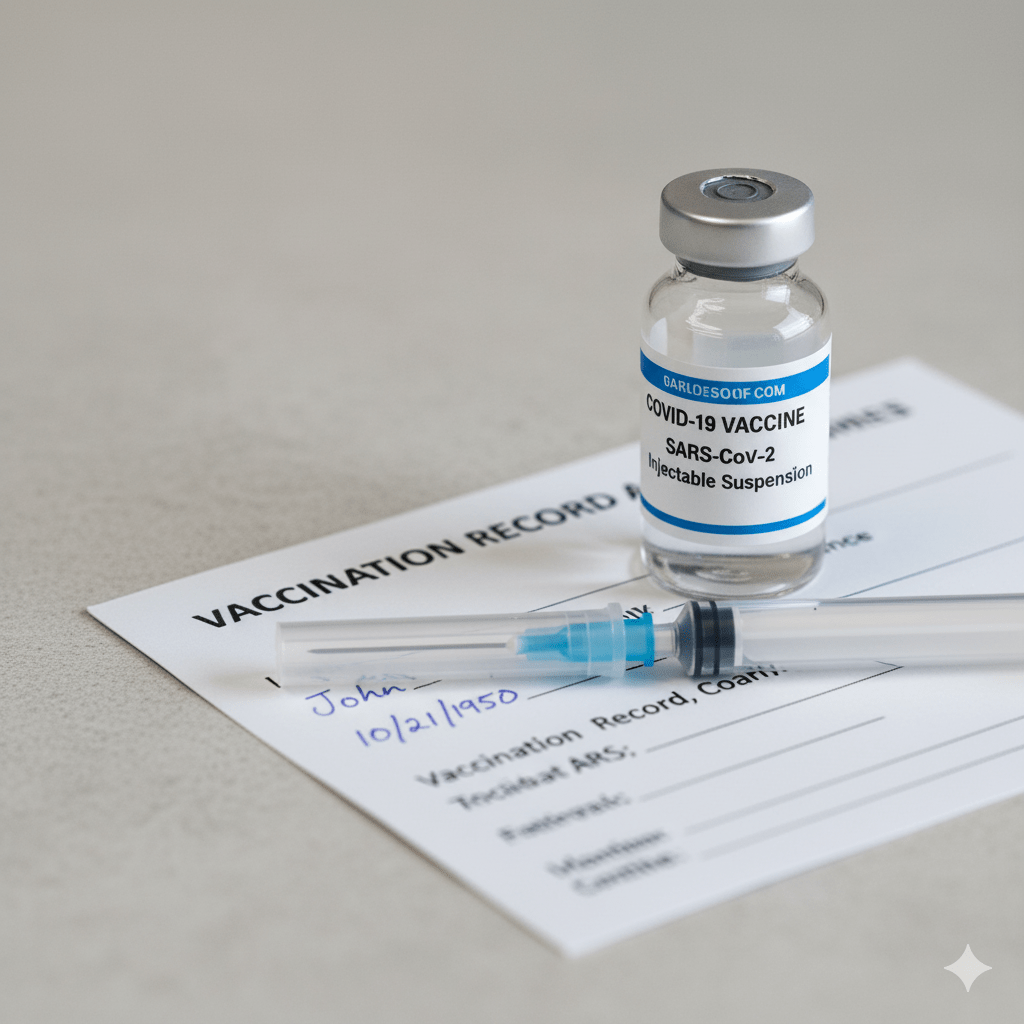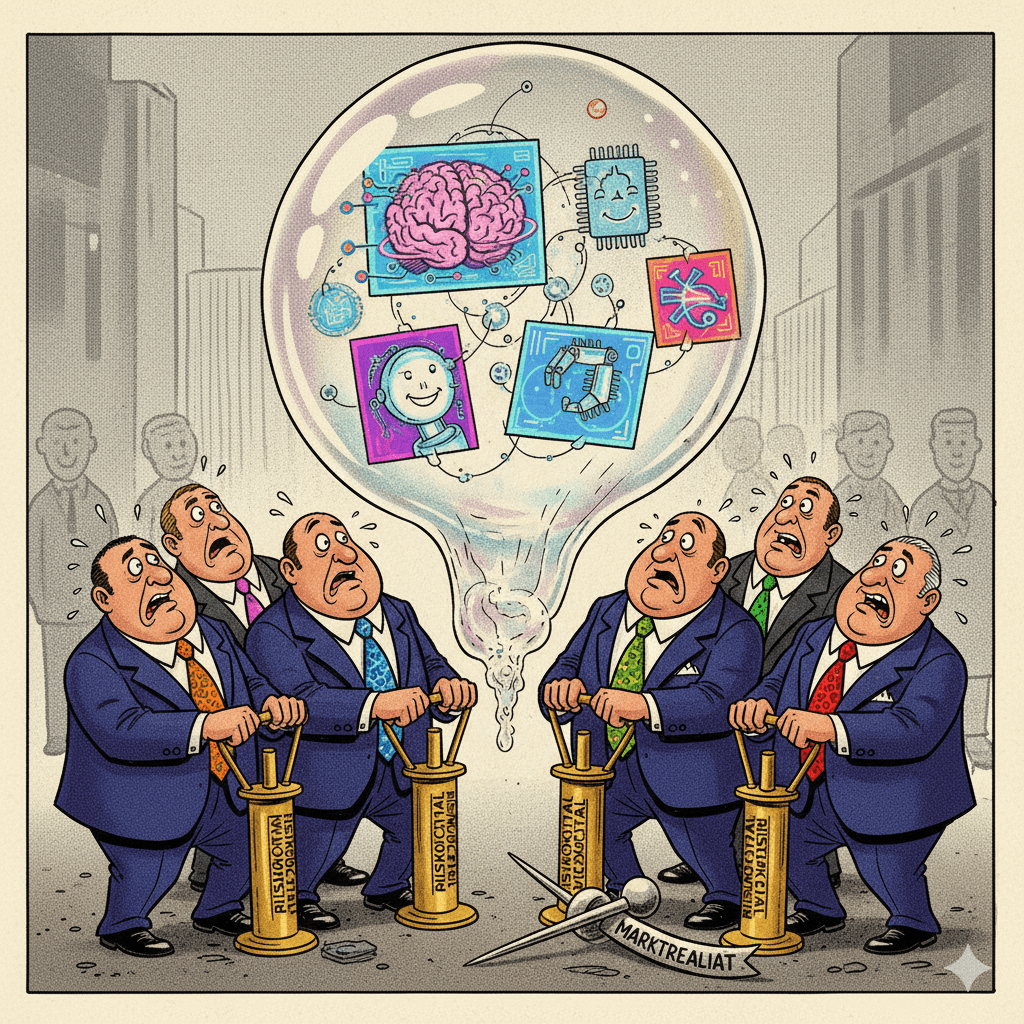Die Nachricht schlug in Washington ein wie ein lange erwartetes, aber dennoch erschütterndes politisches Gewitter: Die Trump-Regierung fordert den Kongress formell auf, bereits bewilligte Bundesmittel in Höhe von über neun Milliarden US-Dollar zurückzufordern. Betroffen sind vor allem Programme der Auslandshilfe und die finanzielle Basis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den USA, namentlich NPR und PBS. Was auf den ersten Blick wie ein Routineakt im ewigen Ringen um den US-Haushalt erscheinen mag, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein vielschichtiges Manöver mit potenziell gravierenden Folgen. Es geht um weit mehr als um fiskalische Korrekturen; es ist ein erneuter Vorstoß, die Machtbalance zwischen Weißem Haus und Kapitol zu verschieben, ein ideologisch motivierter Feldzug gegen unliebsame Programme und Institutionen und nicht zuletzt ein symbolpolitischer Akt zur Mobilisierung der eigenen Basis. Die Konsequenzen könnten die Rolle Amerikas in der Welt ebenso nachhaltig verändern wie die innenpolitische Landschaft und das Vertrauen in öffentliche Institutionen.
Im Schatten von DOGE: Der Kreuzzug gegen „Verschwendung“ und unliebsame Geister
Die offizielle Begründung für diesen drastischen Schritt liest sich wie ein Manifest konservativer Regierungskritik. Russell Vought, der Budgetdirektor des Weißen Hauses und ein zentraler Architekt dieser Politik, spricht von Programmen, die „den amerikanischen Interessen zuwiderlaufen“. Genannt werden unter anderem die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), LGBTQI+-Aktivitäten, sogenannte „Equity“-Programme und als „radikal“ eingestufte Umweltinitiativen. Auch die Corporation for Public Broadcasting (CPB), die Dachorganisation von NPR und PBS, steht im Fadenkreuz: Sie subventioniere ein „politisch voreingenommenes Mediensystem“ und stelle eine „unnötige Ausgabe für den Steuerzahler“ dar. Diese Argumentation wird flankiert von der Behauptung, man wolle lediglich Empfehlungen des „Department of Government Efficiency“ (DOGE) umsetzen, einer unter dem früheren Vorsitz von Elon Musk ins Leben gerufenen Behörde, die Effizienzsteigerungen und Ausgabenkürzungen identifizieren soll. So sprach auch der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, davon, mit diesem Paket „fiskalische Vernunft wiederherstellen“ zu wollen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch die Zahlen werfen Fragen auf bezüglich der tatsächlichen fiskalischen Wirkung. Die anvisierten Kürzungen von rund neun Milliarden Dollar stehen einem prognostizierten Haushaltsdefizit von zwei Billionen Dollar gegenüber. Selbst wenn die Kürzungen vollständig umgesetzt würden, wäre ihr Einfluss auf die Gesamtverschuldung marginal. Dies nährt den Verdacht, dass das Argument der „Haushaltssanierung“ eher als politisches Feigenblatt dient. Kritiker sehen hier vielmehr den Versuch, unter dem Deckmantel der Sparsamkeit eine ideologische Agenda voranzutreiben. Die Auslandshilfe beispielsweise macht laut den vorliegenden Berichten lediglich 0,88 Prozent der gesamten Staatsausgaben im Fiskaljahr 2024 aus. Die Behauptung der Verschwendung wird hier zum politischen Instrument, um Programme zu demontieren, die nicht in das Weltbild der Regierung passen oder deren Nutzen von ihr in Frage gestellt wird. Die Rolle von DOGE und die Verbindung zu Elon Musk werfen zusätzlich die Frage auf, inwieweit hier externe Akteure mit einer spezifischen Agenda Einfluss auf die Regierungspolitik nehmen.
Machtprobe am Potomac: Trumps Ringen mit der Budgethoheit des Kongresses
Der Vorstoß ist auch vor dem Hintergrund des verfassungsmäßig verankerten Rechts des Kongresses zu sehen, über die Verwendung von Steuergeldern zu entscheiden – die sogenannte „Power of the Purse“. Die Trump-Regierung hat seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit wiederholt die Grenzen der präsidentiellen Einflussnahme auf Haushaltsfragen ausgelotet. Es gab bereits frühere Versuche, vom Kongress bewilligte Mittel eigenmächtig nicht auszugeben oder umzuwidmen. So blockierte die Administration laut Angaben von Demokraten in den Haushaltsausschüssen des Kongresses unilateral über 425 Milliarden Dollar an vom Kongress mandatierten Ausgaben. Die damalige Einstellung von USAID-Finanzierungen beispielsweise führte zu juristischen Auseinandersetzungen und für die Regierung ungünstigen Gerichtsurteilen.
Im aktuellen Fall wählt die Administration formal einen anderen Weg: Sie bittet den Kongress, die Kürzungen per Gesetz zu beschließen („rescind“). Dies könnte als Zugeständnis an die Rolle des Kongresses interpretiert werden. Allerdings kann ein solches Gesetz mit einfacher Mehrheit in beiden Kammern verabschiedet werden, und im Senat ist keine 60-Stimmen-Mehrheit zur Überwindung eines demokratischen Filibusters nötig. Diese Vorgehensweise, die als „normale Kanäle“ bezeichnet wird, ist möglicherweise eine Lehre aus früheren Niederlagen. Während Trumps erster Amtszeit scheiterte ein ähnlicher Versuch, bereits bewilligte Mittel zurückzufordern, am Widerstand einiger republikanischer Senatoren. Die jetzige, offenbar gezieltere Auswahl der Kürzungsziele könnte darauf abzielen, eine erneute parteiinterne Rebellion zu verhindern. Dennoch bleibt der Vorstoß ein fundamentaler Test für die Budgethoheit des Kongresses. Sollte die Exekutive erfolgreich Druck ausüben können, um bereits getroffene Haushaltsentscheidungen der Legislative nachträglich zu revidieren, könnte dies die Machtbalance weiter zugunsten des Präsidenten verschieben und einen Präzedenzfall für zukünftige Regierungen schaffen.
Kollateralschaden Public Broadcasting: Das Kalkül hinter den Angriffen auf NPR und PBS
Ein besonders umstrittener Punkt des Kürzungsplans ist die Reduzierung der Mittel für die Corporation for Public Broadcasting um über eine Milliarde Dollar. Die CPB unterstützt Hunderte von lokalen Radio- und Fernsehstationen im ganzen Land, die unter den Marken NPR (National Public Radio) und PBS (Public Broadcasting Service) bekannt sind. Die Argumente der Befürworter der Kürzungen sind seit langem bekannt: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei politisch linkslastig und eine unnötige Belastung für die Steuerzahler. So bezeichnete der House Freedom Caucus, eine Gruppe erzkonservativer Abgeordneter, die Sender als „notorisch für ihre liberale Voreingenommenheit“.
Die Leitungsebenen von NPR und PBS warnen hingegen vor dramatischen Konsequenzen. Katherine Maher, die Chefin von NPR, sprach von einem „verheerenden Einfluss“ auf lokale Sender, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo diese oft die einzige Quelle für lokale Nachrichten und Informationen seien. Die Auswirkungen wären unmittelbar, sollte das bereits bewilligte Geld tatsächlich gestrichen werden. Paula Kerger, die Leiterin von PBS, ergänzte, dass die Kürzungen die Amerikaner um „einzigartige lokale Programme und Notfalldienste in Krisenzeiten“ bringen würden. Die Chefin der CPB selbst, Patricia Harrison, betonte, die staatliche Finanzierung sei „unersetzlich“. Zwar beziehen NPR und PBS auch signifikante Mittel aus privaten Spenden, doch die Basisfinanzierung durch die CPB ist für viele kleinere Stationen existenziell.
Die Auseinandersetzung um die Finanzierung ist nicht neu. Bereits zuvor hatte Trump per Dekret versucht, die Mittel für NPR und PBS zu kappen, was NPR gerichtlich anfocht und als „Lehrbuchbeispiel für Vergeltung“ für unliebsame journalistische Berichterstattung bezeichnete. Auch wenn direkte Beweise für eine Vergeltungsabsicht in den aktuellen Dokumenten schwer zu fassen sind, nährt die Vorgeschichte den Verdacht, dass es hier nicht nur um Haushaltsdisziplin geht, sondern auch darum, kritische Stimmen zu schwächen. Die öffentliche Meinung ist gespalten, aber mit einer leichten Tendenz zugunsten der Weiterfinanzierung: Eine Umfrage des Pew Research Center ergab, dass 43 Prozent der Amerikaner für eine Beibehaltung der Bundesmittel sind, während 24 Prozent deren Streichung befürworten und 33 Prozent unentschieden sind. Die parteipolitische Kluft ist jedoch deutlich: 44 Prozent der Republikaner und republikanisch tendierenden Unabhängigen unterstützen ein Ende der Bundesfinanzierung, während 69 Prozent der Demokraten und demokratisch tendierenden Unabhängigen Kürzungen ablehnen.
Globale Ambitionen auf dem Prüfstand: Die Axt an Amerikas internationaler Verantwortung
Den Löwenanteil der vorgeschlagenen Kürzungen macht mit 8,3 Milliarden Dollar die Auslandshilfe aus. Ziel sind unter anderem Mittel für die US-Agentur für Internationale Entwicklung (USAID), die Programme zur globalen Gesundheit, Hungerbekämpfung, Krankheitsprävention und wirtschaftlichen Entwicklung verwaltet. Auch die US-Beiträge zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Mittel für internationale Friedenssicherungseinsätze stehen auf der Streichliste.
Besonders heikel ist die geplante Kürzung von 400 Millionen Dollar für das President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), ein von George W. Bush initiiertes Programm, dem die Rettung von über 25 Millionen Menschenleben weltweit zugeschrieben wird. Die republikanische Senatorin Susan Collins, Vorsitzende des einflussreichen Bewilligungsausschusses, hat bereits unmissverständlich erklärt, dass sie eine Kürzung von PEPFAR nicht unterstützen werde. Dies zeigt, dass selbst innerhalb der Regierungspartei die Einschnitte in bewährte und international anerkannte Programme auf Widerstand stoßen. Die Kürzungen im Bereich der globalen Gesundheitshilfe hätten weitreichende Folgen für die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Krankheiten wie HIV/AIDS und könnten das Ansehen und die humanitäre Rolle der USA in der Welt empfindlich schwächen. Langfristig könnten solche Schritte auch das Vertrauen in die Verlässlichkeit amerikanischer Zusagen im internationalen Kontext untergraben. Die öffentliche Meinung zur Auslandshilfe ist ambivalent: Während eine Mehrheit von 60 Prozent der Amerikaner laut einer Umfrage der General Social Survey der Meinung ist, die USA gäben zu viel für Hilfe an andere Länder aus, sprach sich in einer anderen Erhebung eine Mehrheit von 62 Prozent gegen das Einfrieren von Mitteln für Nahrungsmittel, Gesundheit und Krankheitsprävention für Menschen in armen Ländern aus.
Zerreißprobe für die Republikaner: Die parteiinternen Bruchlinien im Kürzungsstreit
Obwohl die republikanische Führung im Repräsentantenhaus, darunter Sprecher Mike Johnson und der Vorsitzende des Bewilligungsausschusses Tom Cole, sowie der konservative House Freedom Caucus die Kürzungspläne unterstützen, ist der Erfolg im Kongress keineswegs gesichert. Die knappen Mehrheitsverhältnisse in beiden Kammern machen jede Stimme entscheidend. Neben Senatorin Collins‘ Bedenken hinsichtlich PEPFAR hat auch die republikanische Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska in der Vergangenheit ihre Unterstützung für die staatliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekundet, den sie als „wichtigen Teil des täglichen Lebens“ bezeichnete.
Diese potenziellen Abweichler erinnern an Trumps erste Amtszeit, als ein ähnlicher Versuch, bereits vom Kongress genehmigte Mittel zurückzufordern, am Widerstand von zwei republikanischen Senatoren scheiterte. Die Administration hat die aktuellen Vorschläge zwar offenbar eingegrenzt, um eine Wiederholung dieses Szenarios zu vermeiden. Dennoch offenbaren die unterschiedlichen Reaktionen die internen Bruchlinien innerhalb der Republikanischen Partei. Es prallen fiskalkonservative Hardliner auf gemäßigtere Kräfte, die die Auswirkungen spezifischer Kürzungen auf bewährte Programme oder die Interessen ihrer Wählerschaft kritischer sehen. Die Demokraten hingegen haben bereits geschlossenen Widerstand angekündigt. Senatorin Patty Murray, die ranghöchste Demokratin im Bewilligungsausschuss des Senats, wies die Forderung des Weißen Hauses scharf zurück.
Ein Kampf um Amerikas Kurs: Mehr als nur Zahlen
Die geplante Rückforderung von über neun Milliarden Dollar ist somit weit mehr als ein buchhalterischer Vorgang. Sie ist ein Kulminationspunkt verschiedener strategischer und ideologischer Bestrebungen der Trump-Regierung: die Festigung exekutiver Machtansprüche gegenüber dem Kongress, die Durchsetzung einer spezifischen politischen Agenda durch die gezielte Schwächung unliebsamer Programme und Institutionen und die Bedienung einer politischen Basis, die tiefgreifende Veränderungen fordert.
Unabhängig davon, ob und in welchem Umfang diese Kürzungen letztlich den Kongress passieren, senden sie bereits jetzt ein starkes Signal. Sie signalisieren eine mögliche Abkehr von langjährigen internationalen Verpflichtungen, eine potenzielle Verödung der Medienlandschaft insbesondere in strukturschwachen Regionen und eine fortgesetzte Infragestellung etablierter verfassungsmäßiger Normen. Der Ausgang dieses Ringens wird nicht nur über die Verteilung von Milliardenbeträgen entscheiden, sondern auch wichtige Weichen für die zukünftige politische Ausrichtung und das Selbstverständnis der Vereinigten Staaten stellen. Es ist ein Kampf um den Kurs Amerikas, dessen Auswirkungen noch lange zu spüren sein werden.