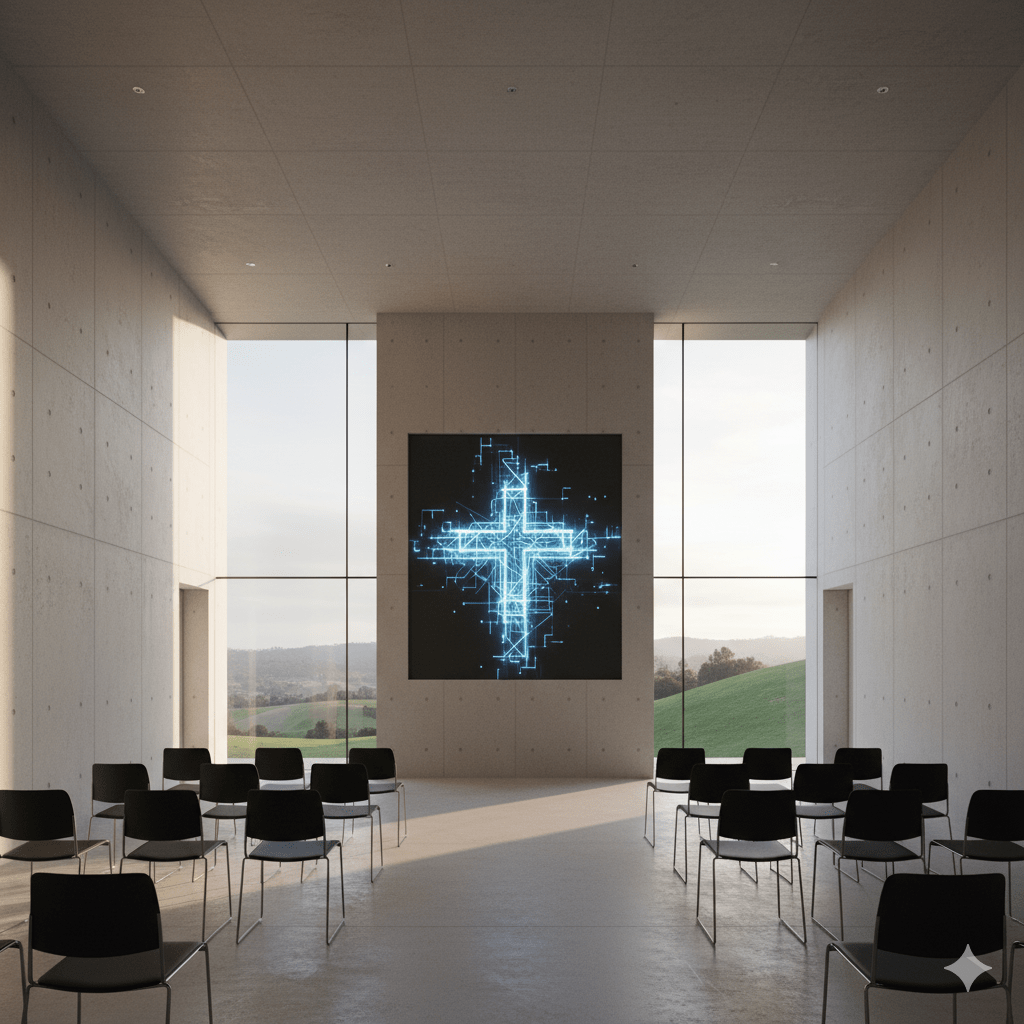Der Himmel über dem Iran brennt, und in Washington stehen die Grundfesten der Trump’schen Außenpolitik in Flammen. Israels verheerender Militärschlag gegen iranische Atomanlagen hat nicht nur den Nahen Osten an den Rand eines großen Krieges gebracht – er hat vor allem die sorgfältig inszenierte Rolle von Donald Trump als globaler Friedensstifter und meisterhafter „Dealmaker“ pulverisiert. Gefangen zwischen der Loyalität zum engsten Verbündeten, dem Druck seiner isolationistischen Basis und den Trümmern seiner eigenen diplomatischen Ambitionen, wird der US-Präsident vom Gestalter zum Getriebenen. Die Krise legt die tiefen Widersprüche seiner „America First“-Doktrin schonungslos offen und zwingt die USA auf einen gefährlichen Pfad, den Trump stets zu meiden schwor.
Der geplatzte Deal: Diplomatie als erstes Opfer
Noch wenige Stunden vor dem israelischen Angriff schien die diplomatische Welt für die Trump-Administration zumindest auf dem Papier in Ordnung. Nach monatelangem, zähem Ringen standen amerikanische und iranische Unterhändler kurz vor einer neuen Verhandlungsrunde im Oman. Auf dem Tisch lag ein Vorschlag von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff, der Teheran einen schrittweisen Ausstieg aus der Urananreicherung ermöglichen und im Gegenzug Sanktionen lockern sollte. Präsident Trump selbst hatte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholt ermahnt, von einem Militärschlag abzusehen, um diesen fragilen Prozess nicht zu torpedieren. Er äußerte die Befürchtung, ein Angriff würde die Verhandlungen „in die Luft jagen“.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Diese Befürchtung wurde mit den ersten Explosionen in Natanz und Isfahan zur bitteren Realität. Der Angriff machte die Gespräche in Oman obsolet, noch bevor sie begonnen hatten. Aus Teheraner Sicht, so sind sich Analysten einig, ist es nun unmöglich, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen. Jedes Entgegenkommen würde nach der militärischen Demütigung als Kapitulation und Schwäche ausgelegt – ein politisches Selbstmordkommando für das angeschlagene Regime. Die diplomatische Initiative, einst das Herzstück von Trumps Iran-Strategie, war mit einem Schlag „tot“, wie es ein Insider formulierte.
Trumps Reaktion auf dieses Debakel offenbarte seine ganze Zerrissenheit. Während er öffentlich die israelische Militäraktion als „exzellent“ lobte und von „bereits geplanten Angriffen“ sprach, die noch „brutaler“ ausfallen würden, hatte er hinter den Kulissen bis zuletzt versucht, genau dies zu verhindern. Diese widersprüchlichen Signale sind mehr als nur typisch Trump’sche Rhetorik; sie sind der Ausdruck eines fundamentalen Dilemmas. Er will Stärke demonstrieren und den Falken in seiner Partei gefallen, ohne jedoch sein Image als derjenige zu opfern, der Amerikas Kriege beendet und Deals macht, wo andere nur Konflikte sehen. Das Ergebnis ist ein unberechenbarer Zickzack-Kurs, der in Washington und den Hauptstädten der Welt für maximale Verunsicherung sorgt.
Amerikas zerrissene Falken: Der innenpolitische Sprengsatz
Die Eskalation im Nahen Osten hat eine tiefe Kluft innerhalb der Republikanischen Partei und der „America First“-Bewegung aufgerissen, die direkt ins Herz von Trumps politischer Koalition zielt. Der Konflikt zwingt seine Anhänger, sich zwischen zwei unvereinbaren Kernprinzipien seiner Ideologie zu entscheiden.
Auf der einen Seite stehen die Isolationisten, angeführt von Vordenkern wie Stephen K. Bannon und prominenten Aktivisten wie Charlie Kirk. Sie sehen in dem israelischen Vorgehen eine gefährliche Provokation, die darauf abzielt, die USA unweigerlich in einen weiteren, kostspieligen und blutigen Krieg im Nahen Osten zu ziehen. Für sie ist jeder Militäreinsatz, der nicht dem direkten Schutz amerikanischer Interessen dient, ein Verrat an der „America First“-Agenda. „Wir können uns nicht in einen Krieg auf dem eurasischen Festland hineinziehen lassen“, warnte Bannon unmissverständlich. Kirks Podcast-Hörer, so berichtete er, lehnten eine Parteinahme für Israel in diesem Konflikt im Verhältnis von 99 zu eins ab.
Auf der anderen Seite haben sich die traditionellen Iran-Falken und die standhaften Unterstützer Israels positioniert, zu denen einflussreiche Senatoren wie Lindsey Graham gehören. Aus ihrer Sicht war der israelische Angriff längst überfällig und absolut notwendig, um zu verhindern, dass ein feindseliges Regime in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Ein nuklear bewaffneter Iran, so ihre Argumentation, sei eine existenzielle Bedrohung nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt, und die Zahl der Republikaner, die dies nicht so sähen, sei „außerordentlich klein“.
Präsident Trump selbst ist zwischen diesen beiden Lagern gefangen. Er versucht, sich von Israels „unilateraler Aktion“ zu distanzieren, indem sein Außenminister Marco Rubio betont, die USA seien „nicht involviert“. Gleichzeitig feiert er den Erfolg des Angriffs und droht dem Iran mit noch Schlimmerem. Dieser Spagat kann auf Dauer nicht funktionieren. Die Krise zwingt ihn zu einer klaren Positionierung, doch jede Entscheidung birgt das Risiko, einen wichtigen Teil seiner Wählerbasis zu verprellen. Der Konflikt wirkt damit wie ein Katalysator, der die inneren Spannungen und Widersprüche der MAGA-Bewegung offengelegt und eine „große Spaltung“ verursacht, wie Charlie Kirk prophezeite.
Zwischen Beistand und Brandmauer: Die riskante Rolle des US-Militärs
Während die Politiker in Washington um die richtige Linie rangen, schuf das US-Militär in der Region Fakten. Unmittelbar nach den ersten Angriffen verlegten die USA Kriegsschiffe, darunter den Zerstörer U.S.S. Thomas Hudner, sowie zusätzliche Kampfflugzeuge ins östliche Mittelmeer. Diese Maßnahmen dienten einem doppelten Zweck: dem Schutz amerikanischer Truppen in der Region und der aktiven Unterstützung der israelischen Luftverteidigung.
Als der Iran mit einem Hagel von Raketen und Drohnen antwortete, spielten die USA eine entscheidende, wenn auch offiziell heruntergespielte Rolle. Amerikanische Streitkräfte halfen nachweislich dabei, anfliegende iranische Flugkörper abzufangen, ähnlich wie sie es bereits bei früheren Konfrontationen getan hatten. Es war ein Balanceakt auf dem Hochseil: Man leistete dem Verbündeten unverzichtbare militärische Hilfe, ohne selbst offensive Kampfhandlungen gegen den Iran zu führen. Das Pentagon betonte, die verlegten Einheiten seien nicht für einen Angriff auf den Iran positioniert. Diese Politik fungiert als eine Art Brandmauer, die eine direkte Konfrontation zwischen den USA und dem Iran verhindern soll. Doch mit jeder abgeschossenen Rakete wird diese Mauer dünner und das Risiko einer unkontrollierbaren Eskalation, die auch amerikanische Soldaten das Leben kosten könnte, steigt.
Die ökonomischen Schockwellen des Konflikts erreichten die USA unterdessen unmittelbar. Der Preis für Rohöl schoss nach den ersten Nachrichten von den Angriffen um sechs Prozent in die Höhe und überschritt kurzzeitig die Marke von 77 Dollar pro Barrel. Für Präsident Trump, der sich im Wahlkampf als derjenige inszeniert, der die Energiekosten senkt und die Inflation im Griff hat, ist dies eine Hiobsbotschaft. Ein anhaltend hoher Ölpreis würde nicht nur die Benzinpreise für amerikanische Verbraucher in die Höhe treiben, sondern auch seine wirtschaftspolitischen Erfolgsversprechen untergraben. Die Krise im Nahen Osten ist somit längst auch zu einer innenpolitischen und wirtschaftlichen Belastungsprobe für die Trump-Administration geworden.
Eskalation als letzter Ausweg oder fatale Fehlkalkulation?
Die Meinungen darüber, ob Israels Vorgehen klug oder fahrlässig war, gehen in der Analyse scharf auseinander und spiegeln die grundlegenden Debatten über den richtigen Umgang mit dem Iran wider. Befürworter, wie der Kolumnist Bret Stephens, sehen in dem Angriff einen Akt der Notwehr und strategischen Weitsicht. Aus ihrer Perspektive hatte Israel keine realistische Alternative mehr. Jahrelange diplomatische Bemühungen, sowohl unter der Regierung von Präsident Biden als auch unter Trump, seien an der Unnachgiebigkeit und Täuschung Teherans gescheitert. Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) selbst hatte kurz vor dem Angriff festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Nichtverbreitungsvertrag verletze und die Anreicherung von hochangereichertem Uran vorantreibe. Angesichts eines Regimes, das wiederholt die Auslöschung Israels propagiert hat, sei es daher unerlässlich gewesen, dessen Weg zur Atombombe militärisch zu blockieren, bevor es zu spät ist. Ein nuklear bewaffneter Iran, so die Sorge, würde nicht nur Israel bedrohen, sondern auch einen gefährlichen atomaren Rüstungswettlauf mit Saudi-Arabien, der Türkei und Ägypten auslösen.
Kritiker zeichnen ein gänzlich anderes Bild. Sie warnen, dass der Angriff genau das Gegenteil von dem bewirken könnte, was er beabsichtigte. Analysten wie der ehemalige US-Botschafter Daniel Shapiro argumentieren, dass die Zerstörung der Anlagen und die Tötung von Wissenschaftlern den Iran nun erst recht dazu anspornen könnte, mit aller Macht nach der Bombe zu streben. Eine Atomwaffe würde aus Sicht der Hardliner in Teheran als ultimative Lebensversicherung für das Regime erscheinen, ein unverzichtbares Abschreckungsmittel gegen zukünftige Angriffe. Die militärischen Schläge könnten so ironischerweise die Bereitschaft zu diplomatischen Kompromissen endgültig zerstören und einen „verzweifelten Sprint“ zur Bombe auslösen. Darüber hinaus, so warnt der Kolumnist Nicholas Kristof, könnte der Angriff eine nationalistische Gegenreaktion in der iranischen Bevölkerung hervorrufen. Obwohl das Regime zutiefst unpopulär sei, könnten ausländische Bomben die Menschen aus Patriotismus hinter der verhassten Führung vereinen.
Die Wahrheit ist, dass niemand die langfristigen Folgen vorhersagen kann. Israel hat eine Wette abgeschlossen. Eine Wette darauf, dass der militärische Rückschlag den Iran nachhaltig schwächt und dass Präsident Trump, konfrontiert mit vollendeten Tatsachen, letztlich Beifall klatschen würde. In Bezug auf Trump scheint dieses Kalkül aufgegangen zu sein. Doch ob der Schlag gegen den Iran dessen nukleare Ambitionen beendet oder sie auf eine neue, noch gefährlichere Stufe gehoben hat, werden erst die kommenden Monate und Jahre zeigen. Für Donald Trump ist der Schaden bereits jetzt sichtbar: Sein außenpolitisches Projekt liegt in Trümmern, und er muss einen Flächenbrand managen, den er zwar nicht selbst gelegt hat, für dessen Entstehung er aber durch den Ausstieg aus dem ursprünglichen Atomabkommen im Jahr 2018 mit den Weg bereitet hat. Der selbsternannte „Peacemaker“ steht vor dem Scherbenhaufen seiner eigenen Politik.