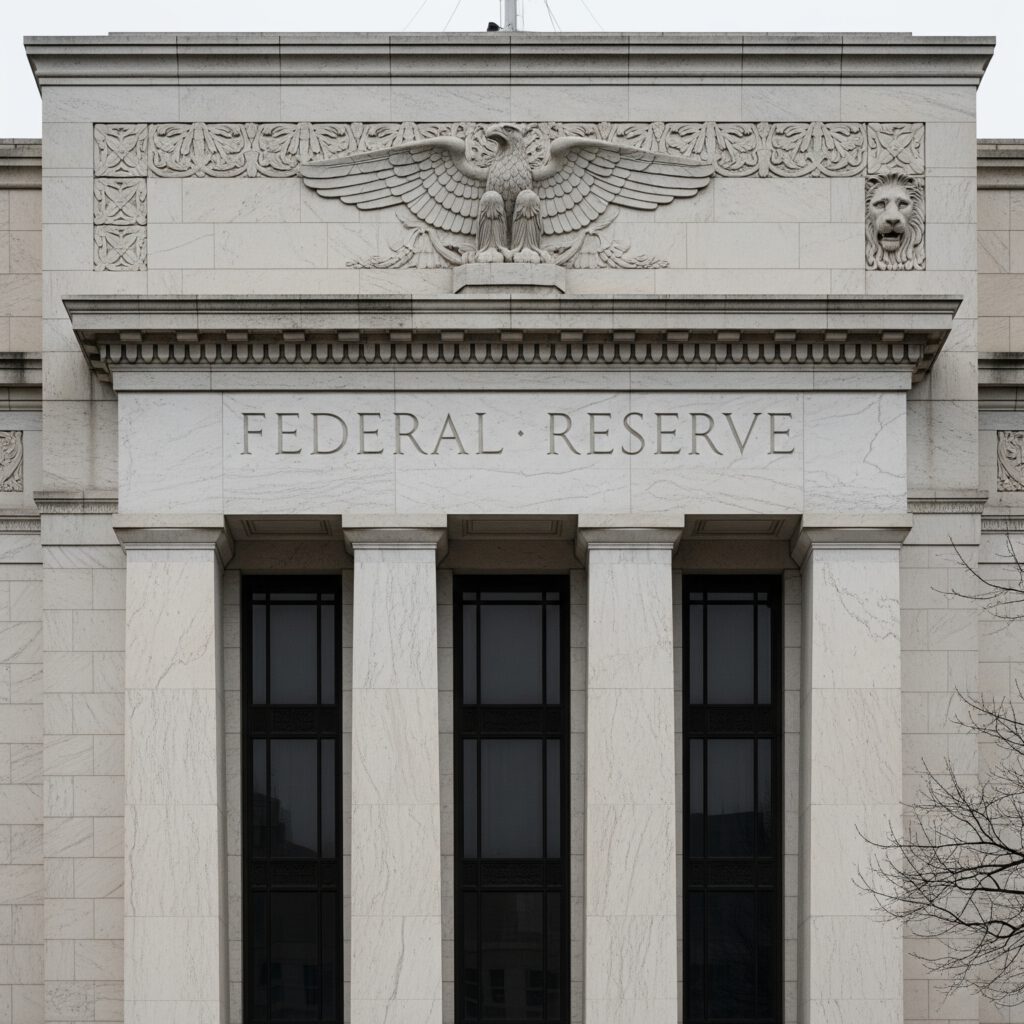Ein geopolitischer Bazooka – so wurden die Sanktionen einst beschrieben, die ganze Nationen in die Knie zwingen sollten. Nun hat Präsident Donald Trump diese Waffe gezückt, doch das Zielfernrohr richtet er nicht allein auf den Kreml, sondern auf einen seiner wichtigsten strategischen Partner: Indien. Mit der drastischen Verdopplung der Strafzölle auf 50 Prozent, einer Reaktion auf Indiens fortgesetzte Importe russischen Öls, hat die Trump-Administration eine Eskalationsstufe gezündet, deren Schockwellen weit über die Handelsbilanzen hinausreichen. Vordergründig ist es ein Versuch, Russlands Kriegskasse auszutrocknen und Moskau an den Verhandlungstisch zu zwingen. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dieser Schritt als ein hochriskantes Manöver voller Widersprüche. Es ist ein Spiel, das die Grundfesten der amerikanisch-indischen Partnerschaft erschüttert, langfristige strategische Ziele für kurzfristige Impulse opfert und am Ende ausgerechnet jenem Konkurrenten in die Hände spielen könnte, dem man gemeinsam die Stirn bieten wollte: China.
Ein Sturm zieht auf: Wie ein Ölgeschäft zur Staatsaffäre wurde
Die Logik des Weißen Hauses scheint auf den ersten Blick bestechend einfach. Russland finanziert seinen Krieg gegen die Ukraine maßgeblich durch den Verkauf von fossilen Brennstoffen. Um diesen Geldhahn zuzudrehen, müssen die größten Abnehmer unter Druck gesetzt werden. Seit Beginn der Invasion hat sich Indien neben China zum wichtigsten Rettungsanker für Russlands Ölindustrie entwickelt. Der Anteil russischen Öls an den indischen Importen explodierte von unter zwei Prozent vor dem Krieg auf über 35 Prozent. Für Indien war es ein lukratives Geschäft; das preisgünstige russische Öl sicherte nicht nur die Energieversorgung einer rasant wachsenden Nation, sondern spülte durch den Weiterverkauf von raffinierten Produkten wie Diesel nach Europa auch Milliardengewinne in die Kassen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Diese für Neu-Delhi pragmatische Wirtschaftsentscheidung wurde in Washington zunehmend als Affront wahrgenommen. Trump, der monatelang auf ein Ende der Kämpfe in der Ukraine gedrängt und dem Kreml ein Ultimatum gestellt hatte, sah sich zum Handeln gezwungen. Die Folge war ein Exekutivbefehl, der eine Strafmaßnahme von historischem Ausmaß darstellt: ein zusätzlicher Zoll von 25 Prozent, der auf einen bereits bestehenden 25-prozentigen Tarif aufgeschlagen wird. Indiens Reaktion fiel ebenso deutlich aus. Man nannte die Entscheidung „extrem unglücklich“, „unfair“ und „ungerechtfertigt“. Die Begründung blieb standhaft: Die Energiebedürfnisse von 1,4 Milliarden Menschen seien nicht verhandelbar und diktiert von nationalem Interesse, eine Haltung, die auch andere Länder für sich in Anspruch nehmen.
Trumps zweischneidiges Schwert: Die Widersprüche einer riskanten Strategie
Doch blickt man genauer auf das Spielfeld, offenbaren sich Risse in der Fassade dieser scheinbar geradlinigen Machtdemonstration. Die zentrale Frage, die sich Beobachter stellen, ist jene nach der Konsistenz. Warum wird Indien, ein demokratischer Verbündeter, mit einer Härte bestraft, die jene übertrifft, die gegenüber dem eigentlichen Systemrivalen China an den Tag gelegt wird? China ist nicht nur der größte Abnehmer russischen Öls, sondern pflegt auch eine weitaus engere strategische Partnerschaft mit Moskau. Dennoch verhandelt die Trump-Administration mit Peking über Handelsabkommen, während sie Neu-Delhi mit Zöllen überzieht, die indische Exporte in die USA um bis zu 50 Prozent einbrechen lassen könnten.
Kommentatoren in Indien bezeichnen dieses Vorgehen als „heuchlerisch“ und vermuten, dass Washington den direkten Konflikt mit Peking aufgrund dessen wirtschaftlicher Macht und seiner Kontrolle über kritische Rohstoffe scheut, die für die US-Wirtschaft und Verteidigung unerlässlich sind. Es entsteht der Eindruck, dass die Zölle weniger ein präzises Skalpell zur Schwächung Russlands sind, sondern vielmehr ein Vorschlaghammer, dessen Kollateralschaden in Kauf genommen wird.
Zudem wird die Wirksamkeit der Maßnahme selbst infrage gestellt. Experten sind skeptisch, ob der Entzug der indischen Öleinnahmen allein ausreicht, um Russlands Kriegsmaschinerie zu stoppen. Russland habe sich als widerstandsfähig erwiesen und könnte selbst ohne diese Einnahmen noch mindestens ein Jahr weiterkämpfen. Die Sanktionen wirken indirekt, indem sie indische Exportbranchen wie Pharma und Elektronik treffen, die dann Druck auf ihre Regierung ausüben sollen. Ob dieser komplexe Mechanismus greift, bleibt ungewiss. Die Gefahr besteht, dass die Zölle zwar die indische Wirtschaft empfindlich treffen, ihr eigentliches Ziel – eine entscheidende Schwächung Putins – aber verfehlen.
Modis Dilemma: Zwischen nationalem Stolz und wirtschaftlicher Vernunft
Für Premierminister Narendra Modi ist die Konfrontation mit Trump ein Gang auf dem Drahtseil. Er muss eine Vielzahl von innen- und außenpolitischen Faktoren ausbalancieren, die ihm nur wenig Spielraum lassen. Da ist zum einen sein sorgfältig kultiviertes Image als starker Mann, das kaum Raum für nachgiebige Gesten gegenüber ausländischem Druck lässt. Jede größere Konzession könnte ihm von der Opposition als „Kapitulation“ ausgelegt werden.
Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen Imperative unübersehbar. Indien ist auf stabile Energiepreise angewiesen, und die US-Zölle bedrohen exportabhängige Industrien, die für das Wirtschaftswachstum und Millionen von Arbeitsplätzen von entscheidender Bedeutung sind. Besonders heikel ist die Lage im Agrarsektor. Fast die Hälfte der indischen Arbeitskräfte ist in der Landwirtschaft beschäftigt, und die Öffnung dieses Sektors für US-Importe – eine der härtesten Forderungen Trumps – ist innenpolitisch extrem brisant. Die Erinnerung an die massiven Bauernproteste, die seine Regierung zu einer Reform-Rücknahme zwangen, ist noch frisch.
Zu dieser Gemengelage kommt eine persönliche Dimension hinzu. Berichten zufolge ist Trump frustriert darüber, dass Modi seine Rolle bei der Vermittlung eines Waffenstillstands zwischen Indien und Pakistan nicht öffentlich gewürdigt hat. Diese persönliche Verärgerung, gepaart mit Indiens Weigerung, die russischen Ölkäufe zu stoppen, scheint die Haltung des US-Präsidenten verhärtet zu haben. Modi steht somit vor der gewaltigen Aufgabe, einen Weg zu finden, Trump einen symbolischen „Sieg“ zu gewähren, ohne dabei vor seinem heimischen Publikum das Gesicht zu verlieren.
Kollateralschaden: Wer den Preis für den Handelskrieg zahlt
Die potenziellen Kosten dieses Konflikts sind enorm und betreffen längst nicht mehr nur die direkt beteiligten Akteure. Für Indien könnte die Zoll-Attacke die ambitionierten Pläne, sich als Alternative zu China als „Fabrik der Welt“ zu etablieren, jäh durchkreuzen. Internationale Konzerne wie Apple oder Micron haben Milliarden in den indischen Markt investiert, angelockt von der Aussicht auf politische Stabilität und einen riesigen Binnenmarkt. Diese Investitionen, die darauf abzielten, die Abhängigkeit von China zu verringern, erscheinen nun plötzlich verwundbar. Ein 50-prozentiger Zoll würde die Kalkulation für den Export von in Indien gefertigten Waren in die USA zunichtemachen.
Aber auch die globale Wirtschaft ist gefährdet. Sollte Indien tatsächlich auf russisches Öl verzichten, müssten andere Produzenten wie die OPEC-Staaten die Lücke füllen. Ob sie dazu bereit und in der Lage wären, ohne die Preise in die Höhe zu treiben, ist fraglich. Ein plötzlicher Anstieg der Ölpreise würde die Inflation weltweit anheizen. Speziell Europa könnte die Folgen spüren: Indische Raffinerien sind zu einem wichtigen Lieferanten für Benzin und Diesel für die EU geworden, seit russische Lieferungen weggefallen sind. Ein Experte warnte vor einem Worst-Case-Szenario, in dem am Ende Russland, China und die OPEC gewinnen, während der Rest der Welt verliert.
Das Ende einer Ära? Amerikas strategischer Schwenk und Chinas lachendes Auge
Vielleicht liegt die größte Ironie und das verheerendste Risiko von Trumps Politik in ihrer strategischen Konsequenz. Über Jahrzehnte hinweg haben US-Administrationen beider Parteien Indien als entscheidendes geopolitisches Gegengewicht zum aufsteigenden China hofiert. Die größte Demokratie der Welt sollte an der Seite der USA helfen, die Macht Pekings in Asien auszubalancieren. Diese langfristige strategische Vision scheint nun für eine kurzfristige, impulsive Handelspolitik geopfert zu werden.
Anstatt Indien als Partner im Systemwettbewerb mit China zu stärken, behandelt Washington es wie einen Gegner und treibt es möglicherweise in die Arme ebenjener Mächte, die man eindämmen möchte. Ein ehemaliger indischer Handelsbeamter warnte, die US-Maßnahmen könnten Indien dazu drängen, seine strategische Ausrichtung zu überdenken und die Beziehungen zu Russland und China zu vertiefen. In diesem Szenario wäre China der lachende Dritte. Peking würde nicht nur weiterhin von günstigem russischem Öl profitieren, sondern könnte auch eine geschwächte amerikanisch-indische Achse für seine eigenen Interessen nutzen.
Zwar werden in den Texten mögliche Auswege skizziert, etwa indische Zugeständnisse bei Verteidigungsgütern oder beim Import von amerikanischem Flüssiggas. Doch ob solche Angebote ausreichen, um den fundamentalen Dissens zu überbrücken, ist ungewiss. Auf dem geopolitischen Schachbrett hat die Trump-Administration eine Figur bewegt, die das gesamte Spiel verändert. Es ist ein Zug, der als meisterhafte Druckausübung in die Geschichte eingehen könnte – oder als ein historischer Fehler, der einen unverzichtbaren Verbündeten verprellt und dem größten Rivalen einen unschätzbaren Vorteil verschafft hat. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie schmal der Grat zwischen diesen beiden Möglichkeiten wirklich ist.