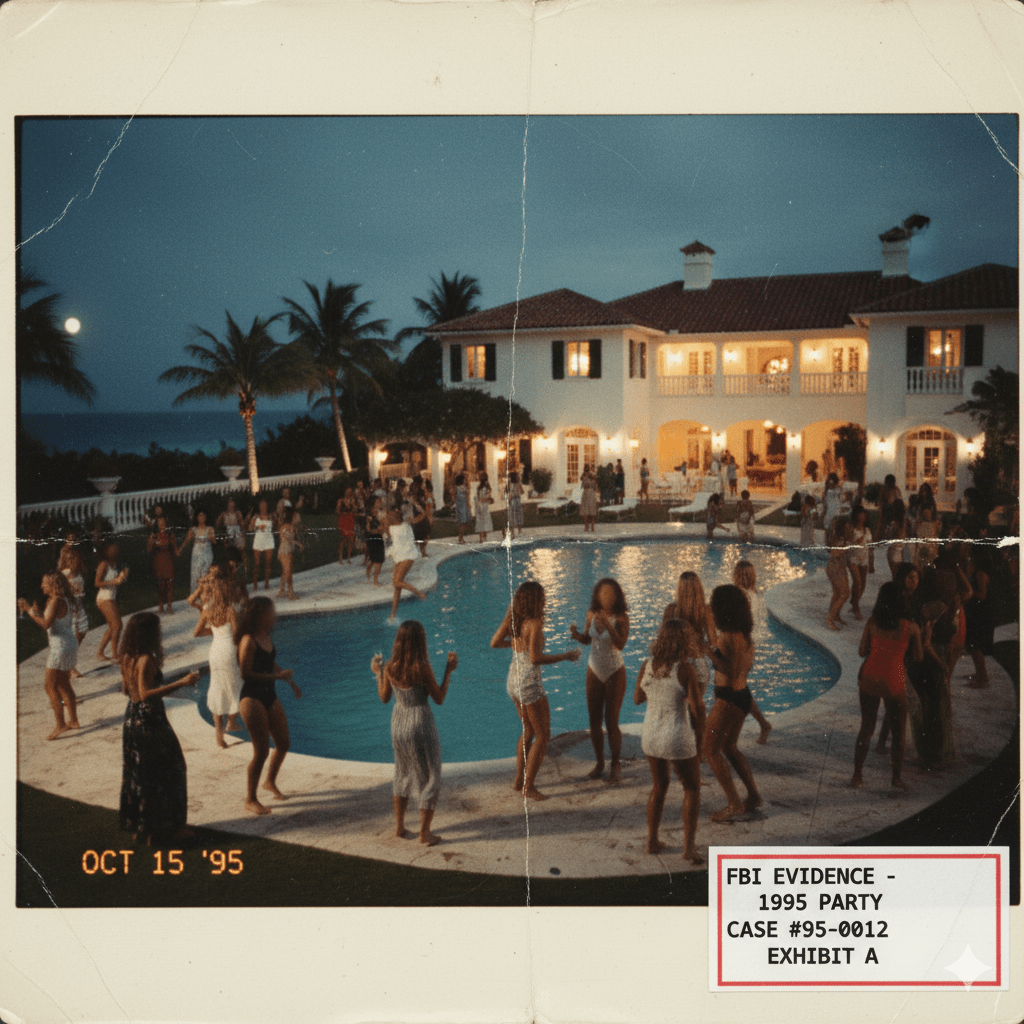Die Abschlussfeier in West Point, einst ein Symbol für Kontinuität und die überparteiliche Ausbildung künftiger Militärführer, geriet unter Präsident Donald Trump zur Bühne einer tiefgreifenden ideologischen Neuausrichtung der amerikanischen Streitkräfte. In seiner Rede vor den Kadetten proklamierte Trump nicht weniger als eine „goldene Ära“ des Militärs, die er persönlich eingeläutet habe. Doch hinter der Fassade von Stärke und Erneuerung, die der Präsident mit seiner „Make America Great Again“-Kappe inszenierte, verbirgt sich ein Feldzug, der die Grundfesten der militärischen Kultur, die akademische Freiheit und das Selbstverständnis einer traditionsreichen Institution fundamental zu verändern droht. Diese Transformation, angetrieben von einer strikten Ablehnung von Diversitäts-, Gleichstellungs- und Inklusionsinitiativen (DEI) und einer radikalen „America First“-Doktrin, stößt auf erheblichen Widerstand und nährt die Sorge vor einer gefährlichen Politisierung des Militärs.
Das Dogma der Gleichschaltung: Trumps Feldzug gegen Diversität im Militär
Im Zentrum der von Trump und seinem Verteidigungsminister Pete Hegseth – einem ehemaligen Fox News-Moderator – vorangetriebenen Agenda steht die aggressive Eliminierung jeglicher DEI-Programme aus Regierung und Militär. Trump brüstet sich damit, die Streitkräfte von „absurden ideologischen Experimenten“ und „spalterischen und entwürdigenden politischen Schulungen“ befreit zu haben. An die Stelle von Vielfalt als anerkannter Stärke – eine Maxime, die Hegseth als die „dümmste Phrase der Militärgeschichte“ bezeichnete – tritt das Postulat einer reinen „Meritokratie“. Die Regierung behauptet, diese Neuausrichtung habe bereits zu einer Stärkung der Moral, einer Verbesserung der Rekrutierungszahlen und einer Fokussierung des Militärs auf seine Kernaufgaben geführt, nämlich Amerika zu verteidigen. So sollen Ernennungen und Beförderungen nun frei von politischen oder identitären Erwägungen erfolgen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch diese Darstellung wird von kritischen Stimmen massiv infrage gestellt. Experten für zivil-militärische Beziehungen und Beobachter sehen in den Maßnahmen „rücksichtslose Veränderungen“ in der Ausbildung von Führungskräften. Die Behauptung, eine Abkehr von Diversitätsbemühungen steigere die Einsatzbereitschaft und „Tödlichkeit“ der Truppe, wie von Hegseth und dem Weißen Haus propagiert, ignoriert die komplexen Anforderungen moderner Kriegsführung und die Realität einer vielfältigen Gesellschaft, aus der sich das Militär rekrutiert. Die aggressive Ausrichtung gegen alles, was als „woke“ gilt, bis hin zur Tilgung der Würdigung von Minderheiten und Frauen, selbst auf dem Nationalfriedhof Arlington, sendet ein fatales Signal an viele Soldaten und potenzielle Rekruten. Mindestens neun hochrangige Militärs, die während der Biden-Administration Diversitätstrainings als Stärke hervorhoben, wurden unter Trump und Hegseth entlassen.
West Point im Visier: Wenn akademische Freiheit der Ideologie weicht
Die Auswirkungen dieser Kulturrevolution sind an der traditionsreichen Militärakademie West Point besonders spürbar. Einst eine historisch unpolitische Institution, die Wert auf eine breite und kritische Ausbildung legte, sieht sich West Point nun im Fadenkreuz von Trumps ideologischem Feldzug. Auf Anweisung des Präsidenten und seines Verteidigungsministers wurden Bücher über Rassismus und Gender aus den Regalen entfernt, ein Dutzend Interessengruppen für Minderheiten und Frauen aufgelöst, Lehrpläne umgeschrieben und ganze Kurse gestrichen. Dozenten, die es wagten, diese Eingriffe als gefährliche Beschneidung der akademischen Freiheit zu kritisieren, sahen sich unter Druck gesetzt; einer trat öffentlichkeitswirksam zurück. Graham Parsons, ein ehemaliger Professor in West Point, beschrieb das Gefühl als „echten Peitschenhieb“ und konstatierte, dass Diskussionen über strukturelle Probleme wie Rassismus und Sexismus nun nicht mehr geduldet würden.
Die Zensur reicht bis in die Wortwahl hinein: Begriffe wie „Feminismus“ oder „systemischer Rassismus“ sollen aus den Lehrplänen getilgt werden. An der Marineakademie werden Forschungsvorhaben von Dozenten offenbar mithilfe einer KI auf Konformität mit den neuen Richtlinien überprüft, wobei Wörter wie „Barriere“, „Schwarz“, „Verbündeter sein“ („allyship“) oder „kulturelle Unterschiede“ als problematisch markiert werden. Ein Professor der Marineakademie beklagte, man versage den Studenten und der eigenen Aufgabe, wenn Wahrheiten unterdrückt und Falschheiten nachgeplappert würden. Diese Gängelung des freien Denkens und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wirft einen dunklen Schatten auf die Qualität der Offiziersausbildung und die Fähigkeit künftiger Führungskräfte, komplexe globale Herausforderungen zu verstehen und zu bewältigen.
Von „ewigen Werten“ zur „Ausmerzung“: Trumps rhetorische Volten und Amerikas verunsicherte Rolle
Besonders frappierend ist der Wandel in Trumps eigener Rhetorik. Noch im Jahr 2020, als die USA von den Protesten nach dem Tod George Floyds erschüttert wurden, ermahnte Trump die West-Point-Absolventen, das Erbe jener Soldaten nicht zu vergessen, die für die „Auslöschung des Übels der Sklaverei“ gekämpft hatten. Er beschwor die Widerstandsfähigkeit amerikanischer Institutionen gegen die „Leidenschaften und Vorurteile des Augenblicks“ und betonte die Bedeutung des „Beständigen, Zeitlosen, Dauerhaften und Ewigen“. Damals wies die Schulleitung die Kadetten an, sich ein akademisches Jahr lang mit Rassismus, Sexismus und anderen Vorurteilen auseinanderzusetzen.
Fünf Jahre später, im Mai 2025, klingt dies wie aus einer anderen Welt. Nun geht es darum, „Ablenkungen loszuwerden“ und das Militär auf seine Kernaufgabe zu fokussieren: „Amerikas Gegner zu vernichten, Amerikas Feinde zu töten und unsere großartige amerikanische Flagge zu verteidigen wie nie zuvor“. Diese aggressive Rhetorik steht im Widerspruch zu seiner gleichzeitigen Ablehnung von „Nation-Building-Kreuzzügen“ in Ländern, die „nichts mit uns zu tun haben wollten“. Eine beiläufige, möglicherweise versprochene Bemerkung Trumps, die Aufgabe der Streitkräfte sei es, „Demokratie auf der ganzen Welt mit der Spitze eines Gewehrs zu verbreiten“, nachdem er kurz zuvor Auslandseinsätze zur kulturellen Transformation abgelehnt hatte, illustriert die konzeptionellen Verwirrungen. Diese widersprüchlichen Signale, gepaart mit der Aussage von Vizepräsident JD Vance, die USA sollten „vorsichtig sein, bevor sie zuschlagen“, und der Ankündigung einer gleichzeitigen Erhöhung der „Tödlichkeit“ bei gleichzeitiger Absicht, bewaffnete Konflikte zu begrenzen, zeichnen das Bild einer unberechenbaren Supermacht.
Zwischen Gehorsam und Gewissen: Der stille Widerstand in Uniform
Angesichts dieser Direktiven und des sich wandelnden Klimas regt sich innerhalb der Militärakademien und darüber hinaus Besorgnis und teils offener, teils subtiler Widerstand. Neben öffentlichen Rücktritten und kritischen Meinungsbeiträgen gibt es Berichte über Kadetten an der Marineakademie, die nicht-staatliche E-Mail-Adressen nutzen, um aufgelöste Interessengruppen im Untergrund weiterzuführen oder ihre Bedenken über zensierte Bücher und Kurse mit Professoren zu teilen. Einige Dozenten versuchen, die strikten Vorgaben durch sprachliche Anpassungen in ihren Lehrplänen zu umschiffen, um weiterhin kritische Inhalte vermitteln zu können. Die Angst vor beruflichen Nachteilen ist dabei ein ständiger Begleiter, da kritische Äußerungen über den Präsidenten oder andere Bundesbeamte für Militärangehörige disziplinarische Konsequenzen haben können.
Ein Professor der Marineakademie berichtete von tiefen inneren Konflikten bei Studenten, die sich zwischen ihrer Dienstpflicht gegenüber dem Land und ihren Sorgen über den Befehlshaber, den Präsidenten, hin- und hergerissen fühlen. Er riet ihnen, ihrem Dienst nachzukommen, bis sie mit einem Befehl konfrontiert würden, den sie für illegal hielten – diesen sollten sie dann verweigern, anstatt ihre Integrität zu kompromittieren. Ein anderer Professor formulierte pointiert, es gebe einen Punkt, an dem „Befolgung zu Mittäterschaft wird“. Diese internen Kämpfe offenbaren die tiefen Wertekonflikte, die Trumps Agenda in den Reihen des Militärs provoziert.
Erosion des Fundaments: Die Risiken einer politisierten Streitmacht
Die von Trump und Hegseth propagierte Vision eines „wiederaufgebauten“, von „sozialen Experimenten“ und angeblich spalterischen Diversitätsbemühungen „befreiten“ Militärs steht in krassem Gegensatz zu den Warnungen von Kritikern. Diese sehen nicht eine Stärkung, sondern eine Schwächung der Streitkräfte durch die Untergrabung von Vielfalt als strategischem Vorteil und die gefährliche Politisierung einer traditionell überparteilichen Institution. Die langfristigen Konsequenzen dieser Entwicklung sind besorgniserregend. Ein Militär, das zunehmend als parteipolitisches Instrument wahrgenommen wird, riskiert einen schweren Schaden für das zivil-militärische Verhältnis in den USA, das auf gegenseitigem Vertrauen und der Anerkennung klar getrennter Rollen beruht.
Darüber hinaus könnte die internationale Reputation des US-Militärs leiden, wenn es den Anschein erweckt, von ideologischen Säuberungen und einer Verengung des intellektuellen Horizonts geprägt zu sein. Dies könnte sich auch negativ auf die Bereitschaft zukünftiger Generationen auswirken, in den Streitkräften zu dienen, insbesondere wenn diese als ein Umfeld wahrgenommen werden, das Vielfalt ablehnt und kritisches Denken unterdrückt. Der Versuch, eine „goldene Ära“ durch ideologische Gleichschaltung zu erzwingen, könnte sich als Pyrrhussieg erweisen, der das Fundament der amerikanischen Militärmacht nachhaltig erodiert. Die geplante millionenschwere Militärparade zum 250. Geburtstag der U.S. Army, die zufällig auf Trumps Geburtstag fällt, mag da eher wie eine selbstherrliche Inszenierung denn wie ein Zeichen echter Stärke wirken.