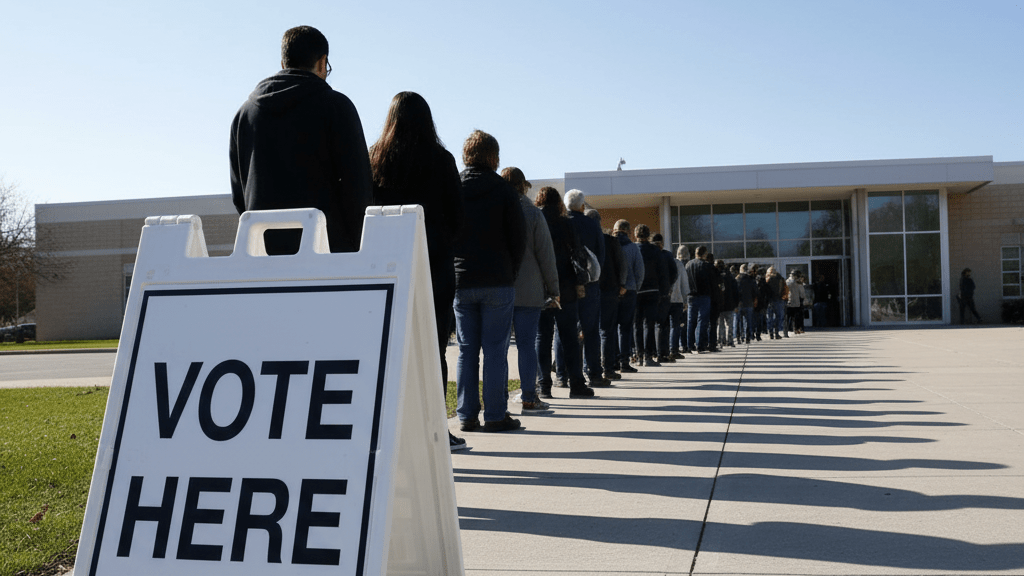
Die Entsendung von Wahlbeobachtern des Justizministeriums in demokratisch regierte Staaten ist nur die Spitze eines umfassenden Versuchs, die amerikanische Demokratie von innen heraus umzugestalten. Es ist eine Strategie, die auf zwei Säulen ruht: der Bestrafung politischer Feinde und der systematischen Übernahme der Wahlinfrastruktur.
Ein neuer Anstrich für die „Wahlintegrität“
Es ist ein an sich routinierter Akt, der im Herbst 2025 für tiefes Misstrauen sorgt: Das US-Justizministerium (DOJ) kündigt die Entsendung von Wahlbeobachtern nach Kalifornien und New Jersey an. Offiziell geht es um „Transparenz“ und die „Sicherung der Wahlurnen“. Doch der Kontext ist alles andere als routiniert.
Anders als in der Vergangenheit, als Beobachter oft auf Grundlage des „Voting Rights Act“ entsandt wurden, um die Rechte von Minderheiten zu schützen, erfolgt dieser Schritt nun auf explizite Anforderung der lokalen Republikanischen Parteien. Diese hatten vage „Unregelmäßigkeiten“ gemeldet – ein Euphemismus, der in der Trump-Administration eine spezifische Bedeutung erlangt hat.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Reaktionen sind heftig. Führende Demokraten in beiden Staaten, von den Gouverneuren bis zu den Generalstaatsanwälten, nennen den Vorgang eine „Einschüchterungstaktik“. Sie fürchten, die Präsenz föderaler Beamter in überwiegend demokratischen und von Minderheiten geprägten Bezirken wie Passaic County diene nur einem Zweck: Wähler zu verunsichern und von der Urne fernzuhalten. Diese Beobachter sind jedoch nur die sichtbarste Manifestation einer viel tiefer gehenden Strategie. Sie sind die Vorboten eines administrativen Umbaus, der darauf abzielt, die föderale Kontrolle über Wahlen zu zementieren und das Justizsystem als Waffe gegen politische Gegner zu instrumentalisieren.
Die Geister der Vergangenheit: Warum 2020 nicht sterben darf
Um die Manöver im Jahr 2025 zu verstehen, muss man ins Jahr 2020 blicken. Obwohl Präsident Trump die Wahl 2024 gewonnen hat, bleibt die Aufarbeitung seiner Niederlage von 2020 ein zentrales Motiv seiner Regierung. Die unbewiesene Behauptung des „gestohlenen“ Wahlsiegs dient als allgegenwärtige Rechtfertigung für die jetzigen Eingriffe.
Das Justizministerium agiert dabei wie eine Ermittlungsbehörde auf der Suche nach einer nachträglichen Begründung. In Fulton County, Georgia, versucht das DOJ aggressiv, Zugriff auf 148.000 versiegelte und längst mehrfach geprüfte Stimmzettel von 2020 zu erhalten. Lokale Beamte wehren sich und verweisen darauf, dass die Wahl längst zertifiziert und die Ergebnisse durch Audits bestätigt wurden.
Noch direkter ist der Vorstoß in Missouri und Colorado. Dort haben hochrangige DOJ-Beamte – darunter Andrew „Mac“ Warner, ein Mann, der selbst falsche Behauptungen über die Wahl 2020 verbreitet hat – lokale Wahlleiter kontaktiert. Die Forderung: Zugriff auf die physischen Wahlgeräte, die 2020 verwendet wurden.
Die lokalen Beamten, selbst Republikaner, sind alarmiert und verweigern den Zugriff. Ihr Argument ist fundamental für die Wahlsicherheit: Würden sie die Maschinen an eine unbefugte Stelle wie das DOJ übergeben, wäre die „Chain of Custody“ – die lückenlose Beweiskette – gebrochen. Die Geräte wären mit einem Schlag de-zertifiziert und für zukünftige Wahlen unbrauchbar. Die Trump-Administration verlangt von lokalen Beamten also sehenden Auges, gegen staatliche Gesetze zu verstoßen und die Integrität ihrer eigenen Ausrüstung zu zerstören.
Der administrative Umsturz: Wer die Wahlen überwacht, bestimmt die Regeln
Die Strategie beschränkt sich nicht auf externe Ermittlungen; sie zielt auf das Herz der Wahlsicherheit. Die Trump-Administration ist dabei, die zuständigen Behörden von innen heraus zu übernehmen, indem sie loyale Aktivisten in kritische Positionen hebt. Zwei Namen stehen sinnbildlich für diesen Wandel: Heather Honey und Marci McCarthy.
Heather Honey, eine Schlüsselfigur der diskreditierten „Prüfung“ der Wahlergebnisse in Maricopa County, Arizona, und eine prominente Aktivistin in Cleta Mitchells Netzwerk von Wahlleugnern, wurde zur stellvertretenden Staatssekretärin für „Wahlintegrität“ im Heimatschutzministerium (DHS) ernannt. In internen Runden soll Honey bereits die Idee ventiliert haben, dass der Präsident eine „nationale Notlage“ ausrufen könnte, um die Kontrolle über Wahlen von den Bundesstaaten an sich zu reißen – ein verfassungsrechtlich höchst zweifelhafter Vorstoß.
Gleichzeitig wurde Marci McCarthy, die in Georgia falsche Behauptungen über Wahlgeräte verbreitete, zur Direktorin für öffentliche Angelegenheiten bei der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ernannt. Dieser Personalwechsel ist eine feindliche Übernahme. Während Aktivisten ohne Fachexpertise die Führung übernehmen, wird die eigentliche Expertise der CISA systematisch abgebaut. Etablierte Fachleute für Cybersicherheit und Wahl-Desinformation werden auf administrative Posten versetzt, ihre Budgets gekürzt oder sie werden ganz auf Eis gelegt. Der Bock wird zum Gärtner gemacht. Die Behörde, die einst als überparteiliche Ressource zur Abwehr tatsächlicher Bedrohungen durch Desinformation und Hacking diente, wird nun von Personen geleitet, die selbst Desinformation verbreitet haben. Die Fähigkeit der Staaten, sich auf die Midterms 2026 vorzubereiten, wird so aktiv geschwächt.
Eine Justiz mit zwei Gesichtern: Bestrafung für Feinde, Amnesie für Freunde
Parallel zur Übernahme der Wahlbehörden veranschaulicht das Justizministerium, was Loyalität – und Illoyalität – im neuen Washington bedeutet. Das DOJ agiert mit einer gespaltenen Zunge. Auf der einen Seite wird der Apparat als Waffe gegen die Opposition mobilisiert. Der Druck von Präsident Trump, seine „wahrgenommenen Feinde“ zu verfolgen, hat zu konkreten Ergebnissen geführt.
Die Liste derer, die sich mit Ermittlungen oder Anklagen konfrontiert sehen, liest sich wie ein „Who is Who“ der Trump-Kritiker:
- Der ehemalige FBI-Direktor James Comey.
- Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James.
- Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton.
- Der demokratische Senator Adam Schiff.
- Die Bezirksstaatsanwältin Fani Willis, die Trump in Georgia angeklagt hatte.
- Und sogar eine Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa Cook.
Die Botschaft ist unmissverständlich: Wer sich dem Präsidenten widersetzt, muss mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen, selbst wenn die Anklagen (wie im Fall von Schiff und James wegen angeblichen Hypothekenbetrugs) von Kritikern als politisch motiviert und fadenscheinig abgetan werden.
Auf der anderen Seite betreibt dasselbe Justizministerium aktive Geschichtsklitterung zugunsten des Präsidenten. Der Fall Taylor Taranto ist hierfür exemplarisch. Taranto, ein Mann, der am 6. Januar 2021 am Kapitol war, wurde 2023 mit Schusswaffen und Munition in der Nähe des Wohnsitzes von Barack Obama verhaftet. Die zuständigen Staatsanwälte beschrieben Taranto in einem Gerichtsdokument als Teil eines „Mobs von Randalierern“ vom 6. Januar. Die Reaktion der DOJ-Führung war brutal: Die Staatsanwälte wurden von ihren Geräten ausgesperrt und vom Dienst suspendiert. Das Gerichtsdokument wurde zurückgezogen und in einer neuen Version wieder eingereicht – vollständig bereinigt von jeder Erwähnung des 6. Januar. Dies geschah, obwohl der zuständige Richter die disziplinierten Staatsanwälte öffentlich für ihre „exzellente Arbeit“ lobte. Dieser Vorgang offenbart einen tiefen internen Widerspruch: Wie kann ein Justizministerium glaubwürdig Fani Willis wegen der Verfolgung einer Wahleinmischung ins Visier nehmen, während es gleichzeitig die Erinnerung an den gewaltsamsten Angriff auf eine Wahlzertifizierung in der US-Geschichte aus seinen eigenen Akten tilgt?
Der Plan für 2026: Ein nationales Wahlsystem unter Trumps Kontrolle?
Alle Fäden – die Beobachter in blauen Staaten, die Jagd auf alte Wahlzettel, die Infiltration der Sicherheitsbehörden und die politisierte Justiz – laufen auf ein Ziel zu: die Wahlen 2026. Die Administration testet derzeit, wie weit sie gehen kann.
Ein zentrales Projekt ist der Versuch, ein nationales Wählerverzeichnis aufzubauen. Das DOJ verklagt derzeit mehrere, meist demokratisch geführte Staaten, um die Herausgabe ihrer vollständigen, sensiblen Wählerlisten zu erzwingen. Offiziell, um Nicht-Staatsbürger zu finden. Wahlbeamte warnen jedoch, dass solche Daten – oft unvollständig oder veraltet – missbraucht werden könnten, um massenhafte, fehlerhafte „Säuberungen“ von Wählerlisten durchzuführen (sogenanntes „Purging“).
Die Verfassung gibt dem Präsidenten keine direkte Kontrolle über Wahlen; diese liegt bei den Bundesstaaten. Trumps Versuche, dies per Exekutiverlass zu ändern, wurden von den Gerichten bisher weitgehend blockiert. Doch der administrative Umbau bietet nun neue, gefährlichere Möglichkeiten. Stellen wir uns ein knappes Wahlergebnis bei den Midterms 2026 vor. Dieses Mal sitzen keine unabhängigen Experten mehr bei CISA oder DHS. Es sitzen Heather Honey und Marci McCarthy in den Kontrollräumen. Was passiert, wenn diese neu ernannten Loyalisten plötzlich „Unregelmäßigkeiten“ melden? Sie wären in der perfekten Position, Zweifel zu säen, die Zertifizierung von Ergebnissen zu verzögern oder jene „nationale Notlage“ auszurufen, die als Vorwand für einen föderalen Eingriff dienen könnte.
Das Ende der Gewissheiten
Was wir derzeit erleben, ist nicht weniger als der Versuch, die Institutionen, die als Schiedsrichter der Demokratie dienen, in Spieler für ein einziges Team umzufunktionieren. Das Justizministerium wird von einem unabhängigen Garanten des Rechts in ein politisches Instrument verwandelt; die Wahlsicherheitsbehörden von einer Verteidigungslinie in ein Überwachungsorgan für politische Loyalität.
Der Widerstand lokaler Beamter und die Trägheit der Gerichte sind die letzten verbliebenen Brandmauern. Doch der Druck auf diese Mauern wächst täglich. Das größte Risiko ist dabei nicht nur eine einzelne manipulierte Wahl. Es ist der schleichende Tod des öffentlichen Vertrauens – der Verlust der „Chain of Custody“ der gesamten Demokratie. Wenn die Bürger nicht mehr darauf vertrauen können, dass die Regeln für alle gleich sind und die Hüter dieser Regeln unparteiisch handeln, erodiert das Fundament, auf dem die Republik steht. Die Frage, die am Ende bleibt, ist nicht, ob das System den nächsten Angriff überlebt, sondern ob es sich selbst noch als System wiedererkennt.


