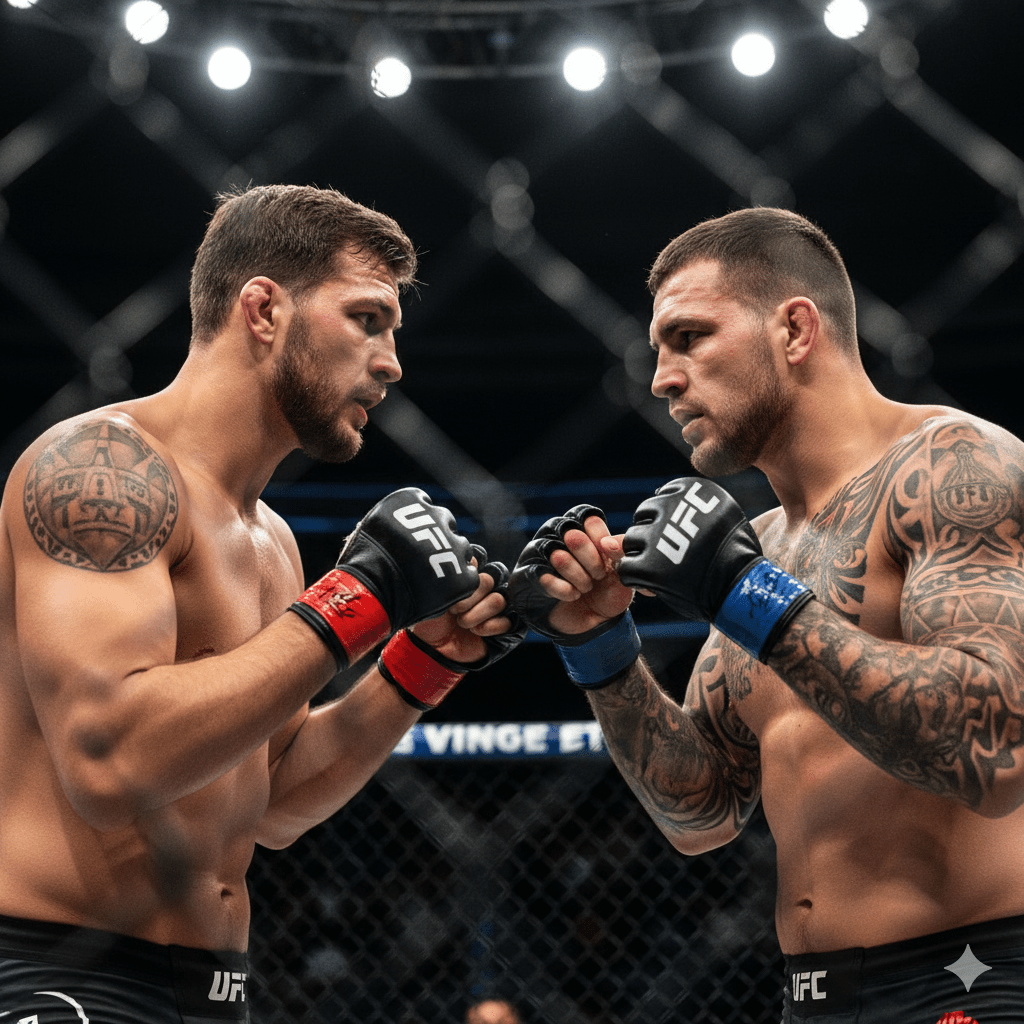Die Trump-Administration hat eine neue Eskalationsstufe in ihrer Auseinandersetzung mit der amerikanischen Hochschullandschaft und internationalen Akademikern gezündet. Jüngste Maßnahmen, wie die abrupte Aussetzung neuer Visa-Interviews für ausländische Studierende zur Vorbereitung einer verschärften Social-Media-Durchleuchtung und die massive finanzielle sowie administrative Drangsalierung von Spitzenuniversitäten, allen voran Harvard, signalisieren eine Offensive, die weit über einzelne politische Scharmützel hinauszugehen scheint. Vordergründig mit nationaler Sicherheit, der Bekämpfung von Antisemitismus und dem Kampf gegen Diskriminierung begründet, zeichnet sich das Bild eines umfassenderen Versuchs ab, ideologische Konformität zu erzwingen und kritische Institutionen unter Druck zu setzen.
Motive, Mittel, Mäntelchen: Der doppelte Schlag gegen Wissen und Weltoffenheit
Die Strategie der Trump-Administration scheint auf zwei Ebenen zu operieren: der direkten Erschwerung des Zugangs für internationale Studierende und der gezielten Schwächung von als liberal oder kritisch wahrgenommenen Eliteuniversitäten. Die Anordnung des Außenministeriums unter Marco Rubio, vorerst keine neuen Visa-Interviewtermine mehr für Studierende und Austauschbesucher zu vergeben, bis neue Richtlinien zur Social-Media-Überprüfung vorliegen, ist hierbei nur die Spitze des Eisbergs. Es ist ein Schritt, der Unsicherheit sät und Amerikas Ruf als Hort der akademischen Freiheit untergräbt. Parallel dazu wird Harvard University mit einer beispiellosen Kampagne überzogen: Die Entziehung der Befugnis, internationale Studierende aufzunehmen (vorerst gerichtlich gestoppt), die Streichung von Forschungsgeldern in Milliardenhöhe und die jüngste Anweisung der General Services Administration (GSA) an Bundesbehörden, Verträge mit Harvard im Wert von rund 100 Millionen Dollar zu überprüfen und gegebenenfalls zu kündigen, sprechen eine deutliche Sprache.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die offiziellen Begründungen wirken dabei oft wie vorgeschobene Argumente, um ein tieferliegendes ideologisches Ziel zu verschleiern. Nationale Sicherheit und die Notwendigkeit, zu wissen, „wer hierher kommt“, klingen zunächst plausibel. Doch die Fokussierung auf Social-Media-Aktivitäten, insbesondere im Kontext von pro-palästinensischen Äußerungen oder Campus-Protesten, nährt den Verdacht, dass es weniger um Terrorabwehr als um Gesinnungsprüfung geht. Auch die Vorwürfe gegen Harvard – angeblicher Antisemitismus, Rassendiskriminierung in Zulassungs- und Einstellungsprozessen und eine angebliche Toleranz gegenüber Gewalt – dienen als Hebel. Harvard-Präsident Alan Garber selbst äußerte Unverständnis darüber, wie das Kappen von Forschungsgeldern, die für gesamtgesellschaftlich wichtige Projekte vorgesehen sind, Antisemitismus bekämpfen solle. Vielmehr scheint Harvard als Symbol einer weltoffenen, intellektuellen Elite zum Exempel statuiert zu werden, um eine breitere „Umerziehung“ der amerikanischen Hochschullandschaft einzuleiten. Trump selbst bekräftigte, sicherstellen zu wollen, dass ausländische Studierende „unser Land lieben können“ und wetterte gegen die Aufnahme „radikalisierter“ Personen.
Kollateralschäden eines Kulturkampfes: Amerikas Ruf als Wissensstandort in Gefahr
Die Auswirkungen dieser Politik sind vielfältig und potenziell verheerend. Bildungsorganisationen wie NAFSA warnen vor einem nachhaltigen Schaden für die Reputation der USA als Top-Destination für internationale Studierende. Die Unsicherheit durch ausgesetzte Visa-Termine und die verschärfte Überwachung dürften viele Talente abschrecken. Dies hat nicht nur kulturelle, sondern auch handfeste wirtschaftliche Konsequenzen: Internationale Studierende spülen jährlich Milliarden in die US-Wirtschaft und die Kassen der Universitäten, die oft auf die vollen Studiengebühren angewiesen sind, um beispielsweise Kürzungen staatlicher Forschungsgelder zu kompensieren. Die Reduzierung ihrer Zahl könnte Hochschulbudgets empfindlich treffen und die Innovationskraft des Landes schwächen, die stark von internationalen Forschern und Wissenschaftlern profitiert. PEN America sieht die USA gar auf dem Weg, ihren Status als „Leuchtturm für intellektuellen und kulturellen Austausch“ zu verspielen. Die Reaktion Japans, das prüft, wie es von den Sanktionen betroffenen Harvard-Studierenden helfen und eigene Universitäten als Alternativen stärken kann, deutet an, dass andere Länder bereitstehen, die Lücke zu füllen, die die USA hinterlassen könnten.
Recht und Rache: Die Axt an den Grundfesten der akademischen Freiheit
Die Maßnahmen der Trump-Administration werfen zudem gravierende rechtliche und ethische Fragen auf. Die erweiterte Social-Media-Überprüfung von Visumantragstellern und die Begründungen für Sanktionen gegen Universitäten tangieren Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Datenschutz und das Recht auf ein faires Verfahren. Experten befürchten, dass die vagen Kriterien und die enorme Ermessensfreiheit der Konsularbeamten zu willkürlichen Entscheidungen führen könnten, ohne dass Betroffene die genauen Gründe für eine Ablehnung erfahren. Stuart Anderson von der National Foundation for American Policy merkt an, dass die Konzentration auf Personen vor ihrer Ankunft in den USA darauf abzielen könnte, rechtliche Wege abzuschneiden, die ihnen im Land offenstünden. Die Forderung des Department of Homeland Security an Harvard, detaillierte Informationen über internationale Studierende preiszugeben, einschließlich Disziplinarakten und Aufzeichnungen über Protestbeteiligungen, stellt einen tiefen Eingriff in die Autonomie der Universität und die Privatsphäre der Studierenden dar. Harvard hat bereits mit Klagen reagiert und konnte Teilerfolge erzielen, etwa die vorläufige Aussetzung des Entzugs der Akkreditierung für internationale Studierende. Der GSA-Brief, der Harvard unter anderem anhaltende Rassendiskriminierung, Diskriminierung bei der Einstellung und die Tolerierung antisemitischer Vorfälle sowie Gewalt vorwirft und die Kündigung von Verträgen empfiehlt, ist ein weiterer Baustein in diesem juristischen und politischen Kräftemessen. Die Administration wirft Harvard vor, nicht im Einklang mit „nationalen Werten und Prioritäten“ zu handeln.
Von Elite-Forschung zu „Handelsschulen“: Trumps Plan zur Umerziehung der Akademielandschaft
Ein besonders entlarvender Aspekt dieser Kampagne ist Präsident Trumps Vorschlag, die Harvard entzogenen Forschungsgelder in Höhe von drei Milliarden Dollar an „Handelsschulen“ (Trade Schools) umzuleiten. Diese Idee, die er als „großartige Investition für die USA“ anpries, offenbart eine tiefsitzende Geringschätzung für Grundlagenforschung und die intellektuelle Ausrichtung von Eliteuniversitäten, die er als „Hort des Liberalismus und Antisemitismus“ oder als von „marxistischen Maniakern“ kontrolliert diffamiert. Die Forschung, die an Institutionen wie der T.H. Chan School of Public Health in Harvard betrieben wird – etwa zur Bekämpfung von Tuberkulose oder zur Erforschung von Multipler Sklerose – ist mit den praxisorientierten Ausbildungen an Handelsschulen, die von Automobilreparatur bis Kosmetik reichen, schlicht nicht vergleichbar. Vertreter von Handelsschulen begrüßten Trumps Vorstoß zwar, doch die praktische Umsetzbarkeit und der wissenschaftliche Sinn einer solchen Umverteilung sind mehr als fragwürdig. Es scheint vielmehr um eine symbolische Bestrafung und eine populistische Geste zu gehen, die auf eine Klientel zielt, die der akademischen Elite ohnehin misstrauisch gegenübersteht. Die angedrohte Besteuerung von Universitätsvermögen und die Vision einer „American Academy“ ohne „Wokeness oder Jihadismus“, die Trump bereits 2023 skizzierte, unterstreichen diesen kulturkämpferischen Ansatz.
Die aktuellen Maßnahmen schaffen gefährliche Präzedenzfälle. Wenn Regierungen beginnen, Hochschulen nicht nach wissenschaftlicher Exzellenz, sondern nach ideologischer Linientreue zu bewerten, Forschungsgelder als politische Waffen einzusetzen und den internationalen Austausch aufgrund von Gesinnungsprüfungen zu beschränken, steht die Autonomie der Wissenschaft auf dem Spiel. Die langfristigen Konsequenzen für die USA könnten ein Verlust an Innovationskraft, internationaler Wettbewerbsfähigkeit und intellektueller Vielfalt sein. Der „Feldzug“ gegen Amerikas Denkschmieden ist somit nicht nur ein Angriff auf einzelne Institutionen oder Personengruppen, sondern ein Angriff auf die Fundamente einer freien und weltoffenen Wissensgesellschaft. Die Welt schaut zu – und zieht möglicherweise ihre eigenen Schlüsse darüber, wo kritisches Denken und akademische Freiheit zukünftig bessere Bedingungen vorfinden.