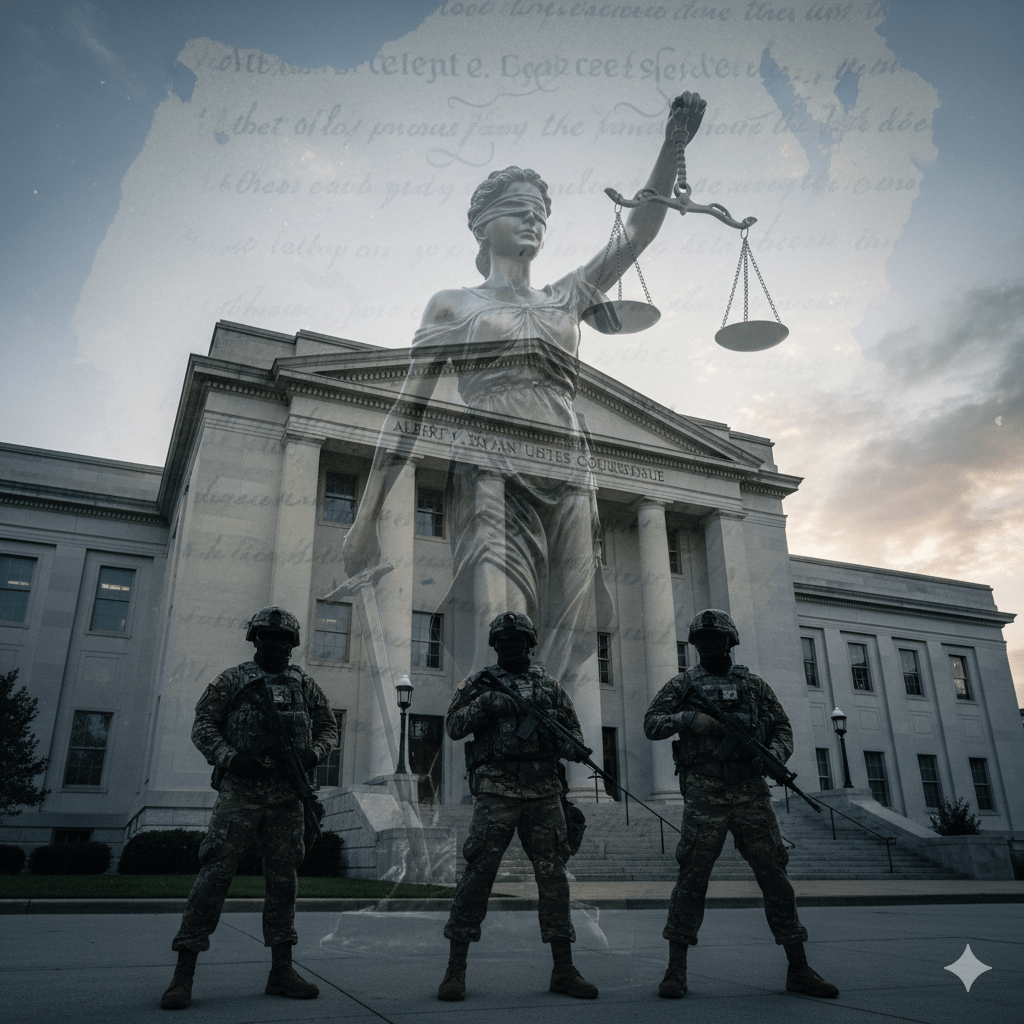Ein diplomatisches Karussell, das sich schwindelerregend schnell dreht und doch nirgendwo anzukommen scheint. Das ist vielleicht das treffendste Bild für die jüngste außenpolitische Offensive von US-Präsident Donald Trump. Innerhalb weniger Tage inszenierte er ein globales Schauspiel: Zuerst ein Gipfeltreffen mit Wladimir Putin in der eisigen Abgeschiedenheit Alaskas, dann ein demonstratives Stelldichein mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und sieben europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus. Die Botschaft, die von diesem diplomatischen Wirbelsturm ausgehen sollte, war klar: Seht her, ich allein kann diesen Krieg beenden. Doch hinter der Fassade aus Händeschütteln, hochfliegenden Versprechen und Social-Media-Verlautbarungen offenbart sich ein strategisches Vakuum, das nicht nur den ersehnten Frieden in weite Ferne rückt, sondern die transatlantische Einheit selbst zu erodieren droht.
Trumps Vorgehen ist keine klassische Diplomatie. Es ist ein hochriskantes Manöver, das weniger von einer kohärenten Strategie als von persönlichen Instinkten, dem unstillbaren Hunger nach medialer Anerkennung und einem fundamentalen Missverständnis der geopolitischen Realitäten angetrieben wird. Anstatt den Krieg zu beenden, droht seine erratische Vorgehensweise, die mühsam aufgebaute westliche Geschlossenheit zu zerfressen und am Ende ausgerechnet dem Aggressor, Wladimir Putin, in die Hände zu spielen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Kunst des Deals als außenpolitische Doktrin
Um die Ereignisse der letzten Wochen zu verstehen, muss man sich von der Vorstellung traditioneller Staatskunst verabschieden. Trumps Methode folgt nicht dem geduldigen, mühsamen Prozess, bei dem Diplomaten monatelang Details aushandeln, bevor die Staatschefs zum finalen Handschlag zusammenkommen. Sein Ansatz ist die Umkehrung dieses Prinzips: Zuerst kommt die große Geste, die Schlagzeile, die Vision eines Friedensnobelpreises, den er für sich reklamiert. Die „Munchkins“, wie sein ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton die untergeordneten Beamten abfällig nennt, sollen die Details dann gefälligst im Nachhinein zusammenfügen.
Dieser Stil ist die direkte Anwendung seiner „Art of the Deal“ auf die Weltbühne – ein Vorgehen, das auf persönlichen Beziehungen, Dominanz und der Überzeugung fußt, dass jeder Konflikt lösbar ist, wenn nur die richtigen Männer am Tisch sitzen. Er operiert in der Annahme, Putin allein durch die Stärke ihrer persönlichen Beziehung zu einem Deal bewegen zu können – eine fatale Fehleinschätzung, die die ideologischen und strategischen Imperative des Kremls ignoriert. Dieser Mangel an institutioneller Expertise in seinem Team, das er von erfahrenen Außenpolitikern gesäubert hat, führt dazu, dass Signale aus Moskau konsequent missverstanden oder überinterpretiert werden. Man glaubt, Fortschritte zu machen, weil man die Sprache der Gegenseite nicht mehr versteht.
Das Trugbild von Anchorage: Ein Pakt mit dem Widerspruch
Das Treffen in Alaska war der Höhepunkt dieser Doktrin. Trump ging in die Verhandlungen mit der Forderung nach einem Waffenstillstand, andernfalls drohten „schwerwiegende Konsequenzen“. Er kam heraus und erklärte, ein Waffenstillstand sei gar nicht mehr nötig. Man strebe direkt einen Friedensvertrag an – eine Position, die sich nahtlos mit der russischen deckte. Wie aber soll ein Land an den Friedensverhandlungstisch kommen, während Raketen und Drohnen auf seine Städte niederprasseln?
Noch gravierender war die Diskrepanz bei den sogenannten Sicherheitsgarantien. Das Weiße Haus verkündete einen „game-changing“ Durchbruch: Putin habe zugestimmt, dass westliche Staaten, potenziell sogar mit Bodentruppen, der Ukraine einen Schutz nach dem Vorbild des NATO-Artikels 5 bieten könnten. Eine Sensation, wäre sie denn wahr gewesen. Doch die russische Reaktion folgte prompt und entlarvte die Ankündigung als Wunschdenken. Moskau bestand weiterhin darauf, bei jeder Sicherheitsgarantie selbst mitzuwirken oder ein Vetorecht zu besitzen – eine Klausel, die jede Garantie von vornherein ad absurdum führen würde. Es wäre, als würde man den Fuchs zum obersten Wächter des Hühnerstalls ernennen. Die Diskrepanz zwischen amerikanischer Verkündung und russischem Dementi war kein Versehen, sondern das Symptom einer tiefen strategischen Fehleinschätzung.
Operation Schadensbegrenzung: Europas Meisterklasse in Washington
Der Auftritt der europäischen Staats- und Regierungschefs wenige Tage später im Weißen Haus war weit mehr als nur ein Höflichkeitsbesuch. Es war eine meisterhaft inszenierte Intervention. In dem Wissen, dass Trumps Positionen oft von seinen letzten Gesprächspartnern geformt werden, lieferten sie eine Lektion in der Kunst, mit Trump umzugehen. Mit einer Überdosis an Schmeicheleien für seine angebliche Führungsstärke versuchten sie, den Präsidenten behutsam von den Positionen wegzulotsen, die er nach seinem Treffen mit Putin eingenommen hatte.
Dieses Manöver offenbart eine beunruhigende Wahrheit: Europas Führer sehen sich nicht mehr nur als Partner, sondern zunehmend als Korrektiv eines unberechenbaren US-Präsidenten. Ihre Erleichterung nach dem Treffen, Trump wieder etwas eingefangen zu haben, kaschiert nur mühsam die tiefen Risse im transatlantischen Bündnis. Währenddessen setzen sie ihre eigene, von Trumps Sprunghaftigkeit losgelöste Unterstützung für Kiew fort, wie die Besuche des NATO-Generalsekretärs und hochrangiger deutscher und kanadischer Vertreter sowie die milliardenschweren Hilfszusagen aus Norwegen zeigen. Sie bereiten sich auf den Fall vor, dass Putins Krieg weitergeht, und bauen ein Sicherheitsnetz, das nicht allein von den Launen im Oval Office abhängt.
Wenn der Wille an der Wirklichkeit zerschellt
Denn die harte Realität lässt sich nicht durch Deals wegverhandeln. Die fundamentalen Ziele Russlands und der Ukraine sind und bleiben unvereinbar. Putin fordert die vollständige Abtretung der Donbas-Region, eines strategisch und industriell entscheidenden Gebiets, in dem die Ukraine trotz jahrelanger Kämpfe immer noch wichtige Festungsstädte hält. Für Kiew wäre ein solcher Schritt nicht nur eine militärische Katastrophe, sondern auch politischer Selbstmord. Experten warnen eindringlich, dass das Aufgeben von Territorium, das Putin militärisch nicht erobern konnte, ein fatales Signal an alle autoritären Regime weltweit senden würde. Es wäre eine Belohnung für Aggression, die Nachahmer, etwa China im Hinblick auf Taiwan, geradezu ermutigen würde.
Gleichzeitig tobt der Krieg unerbittlich weiter. Während in Washington und Alaska über diplomatische Formeln gerungen wird, kämpfen russische Truppen darum, die letzten Quadratmeilen des Donbas unter ihre Kontrolle zu bringen. Der massive Einsatz von Drohnen hat den Krieg in einen brutalen Abnutzungskrieg verwandelt, der jede größere Truppenbewegung zu einem Himmelfahrtskommando macht. Diese militärische Realität steht in krassem Widerspruch zur Illusion schneller diplomatischer Lösungen. Die Diplomatie übertönt den Lärm der Front nicht; sie wird von ihm übertönt.
Ein Déjà-vu in Zeitlupe: Von Pjöngjang nach Kiew
Die Parallelen zu Trumps Diplomatie mit Nordkorea während seiner ersten Amtszeit sind unübersehbar. Auch damals gab es historische Gipfeltreffen, freundschaftliche Gesten und medienwirksame Inszenierungen. Das Ergebnis: Nordkorea hat bis heute keine einzige Atomwaffe aufgegeben und sein Arsenal seitdem sogar dramatisch erweitert. Die Methode – eine auf persönlichen Beziehungen und spektakulären Gesten basierende Diplomatie ohne substanzielle Vorarbeit – ist dieselbe. Es gibt wenig Grund zur Annahme, dass das Ergebnis diesmal ein anderes sein wird.
Trump, so analysieren Beobachter, missversteht den Kern des Konflikts fundamental. Er glaubt, es gehe um einen territorialen Streit, um „Land Swaps“, die man wie ein Immobiliengeschäft verhandeln kann. Für Russland und die Ukraine geht es jedoch um etwas Existenzielles: um nationale Identität, um die Frage der Zugehörigkeit zum Westen oder zu einer russisch dominierten Sphäre. Dieser Konflikt lässt sich nicht mit einem Handschlag beilegen.
Der Plan B: Trumps gefährliche Drohung mit dem Rückzug
Angesichts der ausbleibenden Fortschritte wächst Trumps Frustration sichtlich. Der Konflikt, den er als mittelschwer eingestuft hatte, entpuppt sich als sein bisher hartnäckigster Fall. Seine Reaktion ist typisch: Er setzt ein vages Ultimatum von „zwei Wochen“, nach dem er entscheiden will, „welchen Weg“ er einschlagen wird. Die Optionen, die er in den Raum stellt, könnten unterschiedlicher nicht sein: Entweder „massive Sanktionen“ gegen Russland oder die komplette Aufgabe der Vermittlerrolle nach dem Motto „Das ist euer Kampf“.
Diese Unentschlossenheit zwischen Eskalation und Isolation ist vielleicht die größte Gefahr. Ein abrupter Rückzug der USA würde die Ukraine ihrem Schicksal überlassen und Putin einen strategischen Sieg bescheren, den er auf dem Schlachtfeld bisher nicht erringen konnte. Es würde die Botschaft senden, dass amerikanische Zusagen nur so lange gelten, wie schnelle Erfolge winken. Die Wahl, sich nicht zu entscheiden, wird so am Ende selbst zu einer Entscheidung – einer Entscheidung für den Aggressor.
Im Labyrinth seiner eigenen Ambitionen hat Donald Trump eine Situation geschaffen, in der es kaum noch gute Auswege gibt. Sein Streben nach einem schnellen, persönlichen Triumph hat die Komplexität eines historischen Konflikts ignoriert und die westliche Allianz einer Zerreißprobe ausgesetzt. Die entscheidende Frage, die am Ende dieses diplomatischen Schauspiels im Raum steht, ist so einfach wie brutal: Wer wird den Preis für einen Frieden zahlen, der vielleicht nie kommt? Und was, wenn der Preis für den Versuch allein schon zu hoch war?