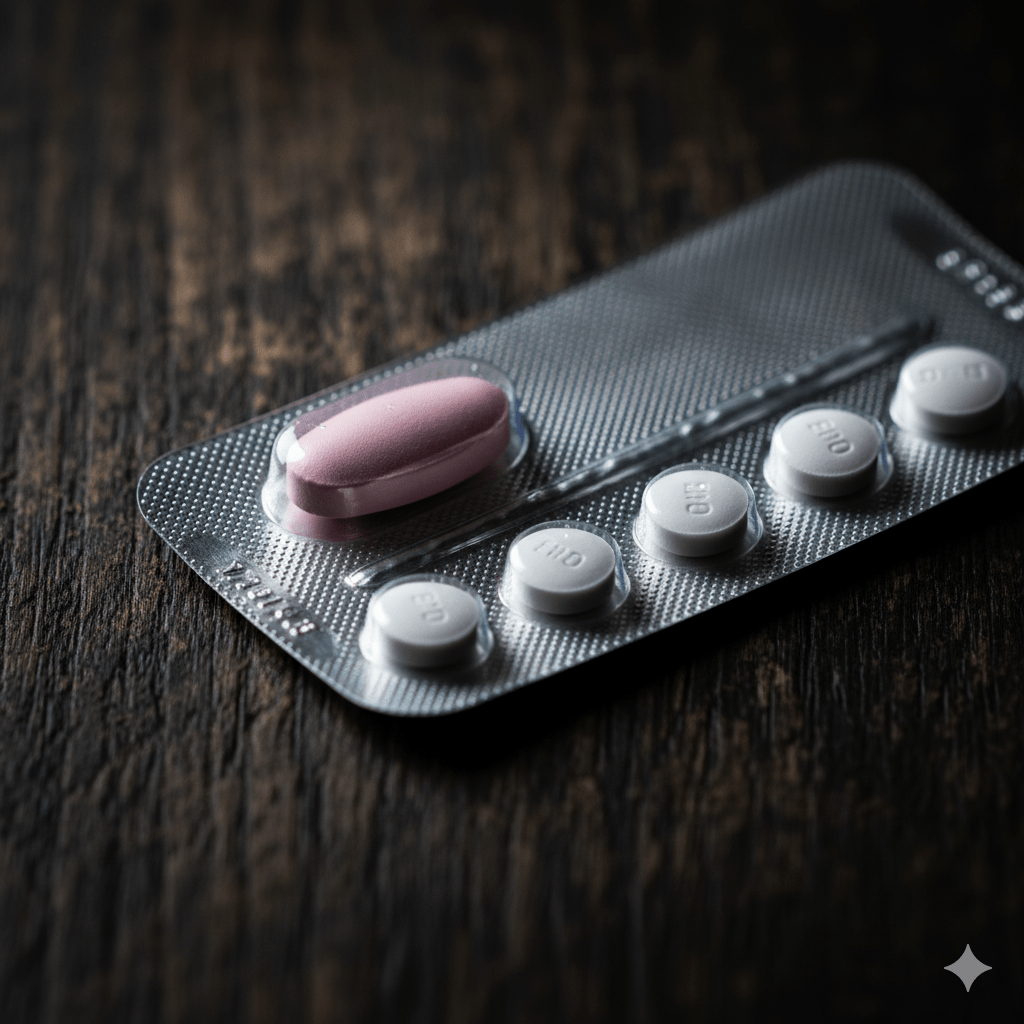In den gleichen Stunden, in denen russische Drohnen- und Raketenschwärme erneut über Kiew niedergingen und die ukrainische Hauptstadt in Rauch und Angst hüllten, traf eine Nachricht aus Washington die alliierte Solidarität in ihrem Fundament. Die Regierung von Präsident Donald Trump bestätigte die Aussetzung kritischer Waffenlieferungen an die Ukraine. In einem der wohl gefährlichsten Momente des Krieges, an einem von den westlichen Partnern ausgerufenen „Wendepunkt“, an dem die Ukraine verzweifelt um ihre Verteidigungsfähigkeit ringt, zieht sich ihr wichtigster militärischer Unterstützer zurück. Die offizielle Begründung aus dem Pentagon, man müsse aufgrund bedenklich schwindender eigener Bestände eine globale Neubewertung vornehmen und „Amerikas Interessen an erste Stelle setzen“, wirkt angesichts der strategischen Implikationen wie eine dürftige Fassade.
Die Entscheidung ist weit mehr als eine logistische Pause; sie ist ein seismischer Schock, der die Grundpfeiler der transatlantischen Sicherheit erschüttert. Sie offenbart eine amerikanische Außenpolitik, die sich weniger an geostrategischer Notwendigkeit als an innenpolitischem Kalkül und der sprunghaften Ideologie ihres Präsidenten orientiert. Dieser abrupte Kurswechsel ist kein Versehen, sondern das bisher deutlichste Symptom eines Paradigmenwechsels: Er schwächt Kiew gezielt, ermutigt den Kreml in seiner aggressiven Haltung und stellt die Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten als globaler Sicherheitsgarant fundamental infrage.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die brüchige Fassade der „leeren Arsenale“
Die Argumentation des Weißen Hauses, die Aussetzung der Lieferungen sei eine unausweichliche Folge zur Neige gehender Bestände, hält einer genaueren Prüfung kaum stand. Kritiker, darunter der ehemalige Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, demaskieren diese Erklärung als fadenscheinig. Sie verweisen darauf, dass die US-Militärhilfe für die Ukraine über zwei wesentliche Kanäle läuft: zum einen über die „Presidential Drawdown Packages“, bei denen Material direkt aus den Beständen des Pentagons entnommen wird, und zum anderen über die „Ukraine Security Assistance Initiative“ (USAI). Letztere finanziert die direkte Beschaffung von Waffen bei Rüstungskonzernen, ohne die aktive Einsatzbereitschaft der US-Armee zu tangieren.
Gerade die Lieferungen im Rahmen der USAI, die bis weit ins nächste Jahr hinein vitale Unterstützung wie Artillerie, Raketen und Luftverteidigung sichern sollten, sind nun das Hauptziel der Aussetzung. Damit entlarvt sich das Argument der gefährdeten US-Militärbereitschaft als politisches Manöver. Es ignoriert zudem, dass die Entnahme aus Pentagon-Beständen durch Mittel des Kongresses refinanziert wird, was letztlich sogar zu einer Modernisierung der US-Streitkräfte führt, da älteres Gerät durch neueres ersetzt wird. Die Entscheidung wirkt daher weniger wie eine vorsorgliche Bestandsaufnahme als vielmehr wie eine gezielte politische Maßnahme unter dem Deckmantel einer administrativen Notwendigkeit. Ein Pentagon-Sprecher erklärte zwar, es handle sich um eine globale Überprüfung aller Waffenempfänger, doch die spezifische und wiederholte Fokussierung auf die Ukraine nährt den Verdacht, dass die Überprüfung als Vorwand dient, um die Unterstützung für Kiew politisch zu beenden.
„America First“ als außenpolitische Doktrin
Die wahren Beweggründe für diesen drastischen Schritt liegen viel tiefer und sind im Kern der politischen DNA von Donald Trump zu finden: der „America First“-Doktrin. Die Entscheidung, die Waffenlieferungen zu stoppen, wird von seinen treuesten Anhängern und der MAGA-Bewegung als Einlösung eines Wahlversprechens gefeiert. Nachdem Trump für die Luftangriffe auf den Iran im Vormonat selbst aus den eigenen Reihen kritisiert wurde, weil er die USA in einen „dummen Krieg“ zu verwickeln drohte, sendet der Ukraine-Stopp nun das beruhigende Signal an seine Basis: Er meint es ernst mit dem Rückzug aus kostspieligen ausländischen Konflikten. Trump selbst rechtfertigte den Schritt mit den Worten, sein Vorgänger Joe Biden habe „unser ganzes Land leergeräumt“, um der Ukraine Waffen zu geben.
Diese Haltung offenbart eine tiefe Spaltung innerhalb der Republikanischen Partei. Während der isolationistische Flügel, angeführt von Denkern wie Elbridge Colby, der die USA für einen „Mehr-Kriege-Einsatz“ nicht gerüstet sieht und den strategischen Fokus auf China legen will, die Entscheidung begrüßt, schlagen die traditionellen Falken Alarm. Erfahrene Republikaner wie Michael McCaul und Brian Fitzpatrick äußerten „ernsthafte Bedenken“ und warnten davor, Putin gerade jetzt triumphieren zu lassen. Sie sehen die Waffenlieferungen nicht als Almosen, sondern als notwendiges Druckmittel, um Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen. Diese Zerrissenheit spiegelt den andauernden Kampf um die Seele der republikanischen Außenpolitik wider – zwischen globaler Verantwortung und einem isolationistischen Nationalismus. Die widersprüchlichen Signale des Präsidenten, der noch wenige Tage vor der Ankündigung öffentlich über die Lieferung weiterer Patriot-Systeme spekulierte, verstärken die Verwirrung und untergraben das Vertrauen in die Berechenbarkeit Washingtons global.
Ein strategisches Geschenk für den Kreml
Für die Ukraine kommt die Entscheidung zur Unzeit und könnte katastrophale Folgen haben. Während Russland seine Luftangriffe auf zivile Infrastruktur mit beispielloser Intensität fortsetzt, wird Kiew ausgerechnet die wichtigste Waffe zur Abwehr entzogen: die Abfangraketen für das Patriot-System. Dieses System ist die einzige effektive Verteidigung der Ukraine gegen russische ballistische Raketen wie den Kinschal. Die Aussetzung trifft das Land an seiner Achillesferse und macht Städte wie Kiew verwundbarer. Ukrainische Offizielle reagierten mit einer Mischung aus Unglauben und Bestürzung, baten um sofortige Klärung und warnten, dass jeder Verzug den Aggressor nur ermutigen würde.
Die Entscheidung Washingtons ist für Wladimir Putin eine strategische Bestätigung seiner gesamten Kriegsführung. Sein Kalkül, den Konflikt in die Länge zu ziehen und auf die Ermüdung des Westens zu setzen, scheint aufzugehen. Anstatt den Druck auf den Kreml zu erhöhen, um einen Waffenstillstand zu erzwingen, liefert die Trump-Administration Putin nun den Beweis, dass seine Geduld belohnt wird. Die russische Führung begrüßte die Nachricht entsprechend erfreut, da weniger Waffen für die Ukraine ein schnelleres Ende der „militärischen Spezialoperation“ bedeuten würden. Während Trump nach einem Telefonat mit Putin enttäuscht feststellte, „keinerlei Fortschritt“ erzielt zu haben, ließ der Kreml ausrichten, man werde die Kriegsziele weiterverfolgen. Stunden nach diesem Gespräch erfolgte einer der bis dato größten Luftangriffe auf die Ukraine – eine zynische Machtdemonstration Putins, der sich durch die amerikanische Haltung in seiner Unnachgiebigkeit bestärkt fühlt.
Mehr als nur Waffen: Das Schweigen der Sanktionen
Die Politikwende der Trump-Regierung erschöpft sich nicht im Stopp der Waffenlieferungen. Parallel dazu hat sie die Sanktionspolitik gegen Russland, das zentrale Instrument des wirtschaftlichen Drucks der Biden-Ära, faktisch zum Erliegen gebracht. Seit Trumps Amtsantritt wurden keine neuen, nennenswerten Sanktionen mehr verhängt. Dieser Stillstand ist fatal, denn Sanktionsregime benötigen ständige „Wartung“, um effektiv zu bleiben. Ohne die kontinuierliche Jagd auf neue Scheinfirmen und Umgehungsnetzwerke, wie sie unter Biden stattfand, kann Russland seine Kriegswirtschaft über Drittländer wie China und Hongkong mit essenziellen Gütern wie Computerchips versorgen.
Diese Passivität gegenüber Russland steht im scharfen Kontrast zu Trumps aggressivem Vorgehen gegen den Iran, gegen den er Hunderte neuer Sanktionen verhängte und sogar Militärschläge anordnete. Diese Diskrepanz legt eine fundamentale Inkohärenz oder eine bewusste Priorisierung offen, die nicht strategisch, sondern persönlich motiviert erscheint. Kritiker wie Jake Sullivan argumentieren, dass wirksame und für US-Steuerzahler kostenneutrale Alternativen auf dem Tisch liegen würden: die Beschlagnahmung der rund 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Staatsvermögen in Europa, um damit die Ukraine zu finanzieren, die Erlaubnis für europäische Verbündete, US-Waffen für Kiew zu kaufen, und eine drastische Verschärfung der Sanktionen gegen den russischen Energiesektor.
Diese ungenutzten Optionen verdeutlichen den Kern des Dilemmas: Trump stellt den Konflikt als eine Wahl zwischen „endlosen Kämpfen“ und „Frieden“ dar. Seine Kritiker halten ihm jedoch vor, dass der von ihm eingeschlagene Weg nicht zu einem wahren, gerechten Frieden durch Verhandlungsstärke führt, sondern zu einem „falschen Frieden“, der einer Kapitulation vor Putins Aggression gleichkommt. Es ist die Definition von Frieden selbst, die zur Disposition steht – eine stabile, souveräne Ukraine oder die Unterwerfung unter die Bedingungen eines Aggressors.
Die Entscheidung der Trump-Administration, sich aus der vordersten Reihe der Ukraine-Unterstützung zurückzuziehen, ist somit weit mehr als eine Kurskorrektur. Sie ist ein fundamentaler Bruch mit der Nachkriegsordnung, ein Signal, das in Kiew als Verrat, in Moskau als Einladung und in den Hauptstädten der Welt als Menetekel für die Zukunft der amerikanischen Führungsrolle verstanden wird. Der „America First“-Ansatz mag innenpolitisch kurzfristig Früchte tragen, doch der Preis dafür ist eine gefährlichere und instabilere Welt, in der die Verlässlichkeit von Allianzen erodiert und das Recht des Stärkeren die internationalen Beziehungen zu dominieren droht. Für die Ukraine, die unter dem Donner russischer Bomben um ihre Existenz kämpft, könnte dieser Preis der höchste von allen sein.