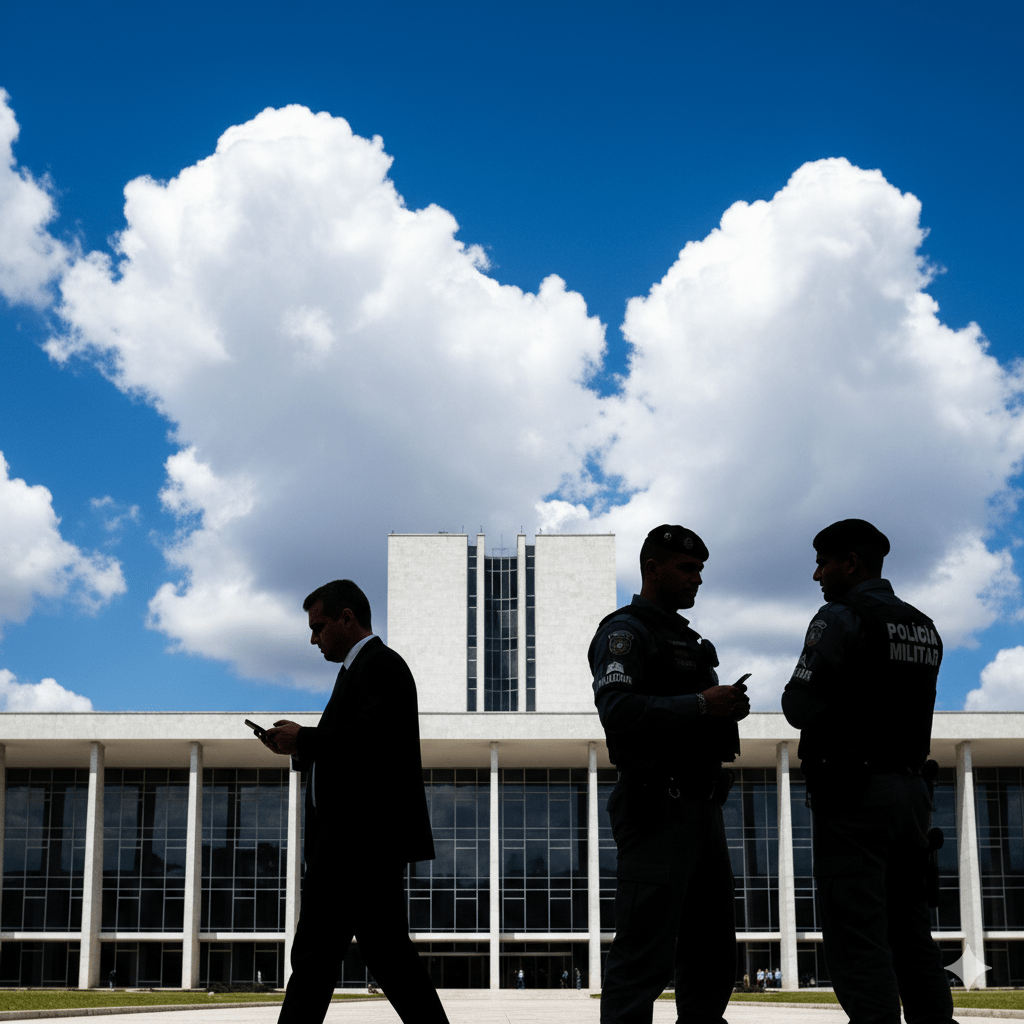Die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung sieht sich erneut mit signifikanten juristischen Hürden konfrontiert. Während der Versuch, ein obskures Kriegsgesetz zur beschleunigten Abschiebung venezolanischer Migranten durchzusetzen, vor Gericht scheiterte, stärkten richterliche Entscheidungen gleichzeitig die Rechte von Migranten in Abschiebeverfahren. Diese Entwicklungen zeichnen ein Bild einer Regierung, deren harte Linie in der Einwanderungspolitik immer wieder an die Grenzen des Rechtsstaats prallt.
Gescheiterter Griff nach dem Kriegsrecht: Venezolanische Migranten schützen sich vor summarischer Abschiebung
Ein zentraler Pfeiler der jüngsten Bemühungen der Trump-Regierung, ihre Einwanderungsagenda voranzutreiben, war die Berufung auf den Alien Enemies Act von 1798. Dieses Gesetz, das in Zeiten erklärten Krieges Anwendung fand, sollte nun dazu dienen, mutmaßliche Mitglieder der venezolanischen Gang Tren de Aragua ohne Anhörung abzuschieben. Doch die Gerichte stellten sich diesem Vorhaben entschieden entgegen. Ein Bundesberufungsgericht in Washington bestätigte die Blockade dieser Abschiebeflüge und argumentierte mit einer Zweidrittelmehrheit, dass die venezolanischen Migranten in ihrer Klage wahrscheinlich Erfolg haben würden, da ihnen ein faires Verfahren verweigert werde. Richterin Patricia A. Millett betonte, dass das Abschiebekonzept der Regierung selbst den „Hauch eines fairen Verfahrens“ vermissen lasse.
Diese Entscheidung ist ein Rückschlag für die Regierung, die argumentiert hatte, dass das Präsidentenrecht in Fragen der nationalen Sicherheit keiner gerichtlichen Überprüfung unterliege. Richterin Karen L. Henderson wies diese Behauptung jedoch zurück und erklärte, dass „sensibles Thema allein ein Gesetz nicht vor dem richterlichen Auge verhüllt“. Sie äußerte zudem Zweifel daran, dass die Handlungen der Gang Tren de Aragua die Kriterien einer „Invasion“ oder eines „räuberischen Einfalls“ im Sinne des Gesetzes erfüllen würden. Während das Weiße Haus die Gerichtsentscheidung kritisierte und eine rasche Intervention des Obersten Gerichtshofs ankündigte, bleibt abzuwarten, ob dieser sich in die laufenden Verfahren um eine einstweilige Verfügung einmischen wird. Beobachter weisen darauf hin, dass höhere Gerichte selten gegen temporäre Verfügungen einschreiten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Schutzstatus und Drittstaaten-Abschiebungen im Fokus richterlicher Intervention
Parallel zu den Auseinandersetzungen um den Alien Enemies Act gab es weitere gerichtliche Entscheidungen, die die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung in Frage stellten. So ordnete eine Bundesrichterin in Virginia die Freilassung eines venezolanischen Ehepaars an, das trotz gültigen vorübergehenden Schutzstatus (TPS) festgenommen worden war. Richterin Leonie M. Brinkema bezeichnete die Festnahmen als unbegründet und rechtswidrig und tadelte Regierungsbeamte für ihre Behauptung, das Paar stelle eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Die Anwälte des Paares hatten argumentiert, dass die Festnahme eine Verletzung ihres TPS und ihres verfassungsmäßigen Rechts auf ein ordentliches Gerichtsverfahren darstelle. Der Fall hatte Besorgnis ausgelöst, dass die Regierung erneut Familien trennen könnte, wie es bereits 2018 im Rahmen der „Null-Toleranz“-Politik geschah.
Eine weitere juristische Niederlage erlitt die Trump-Regierung in Boston. Dort erließ ein Bundesrichter eine einstweilige Verfügung, die die Regierung daran hindert, Personen mit einem endgültigen Abschiebebefehl in Länder abzuschieben, deren Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen, ohne ihnen zuvor eine „sinnvolle Gelegenheit“ zu geben, in den Vereinigten Staaten humanitären Schutz zu suchen. Richter Brian E. Murphy begründete seine Entscheidung mit einem Bundesgesetz, das Abschiebungen in Orte untersagt, an denen „Leben oder Freiheit der Abgeschobenen bedroht wären“, sowie mit dem UN-Antifoltervertrag. Diese Anordnung verpflichtet die Behörden, den Betroffenen schriftlich mitzuteilen, in welches Drittland sie abgeschoben werden sollen, und ihnen die Möglichkeit zu geben, vor einem Einwanderungsgericht Schutz vor Folter zu beantragen. Obwohl diese Entscheidung mutmaßliche Gangmitglieder, die unter dem Alien Enemies Act abgeschoben wurden, nicht betrifft, könnte sie andere Migranten schützen, denen eine schnelle Abschiebung in Drittländer ohne vorherige Prüfung droht.
Die wiederholten juristischen Interventionen unterstreichen die anhaltenden rechtlichen Herausforderungen, mit denen die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung konfrontiert ist. Während die Regierung weiterhin auf eine harte Durchsetzung ihrer Agenda drängt und dabei auch auf ungewöhnliche Rechtsinstrumente zurückgreift, zeigen die Entscheidungen der Gerichte, dass die Prinzipien des fairen Verfahrens und der Schutz vor Verfolgung weiterhin hohe Bedeutung im amerikanischen Rechtssystem genießen. Die Auseinandersetzung um die Rechte von Migranten, insbesondere der venezolanischen Gemeinschaft, dürfte somit noch lange nicht beendet sein.