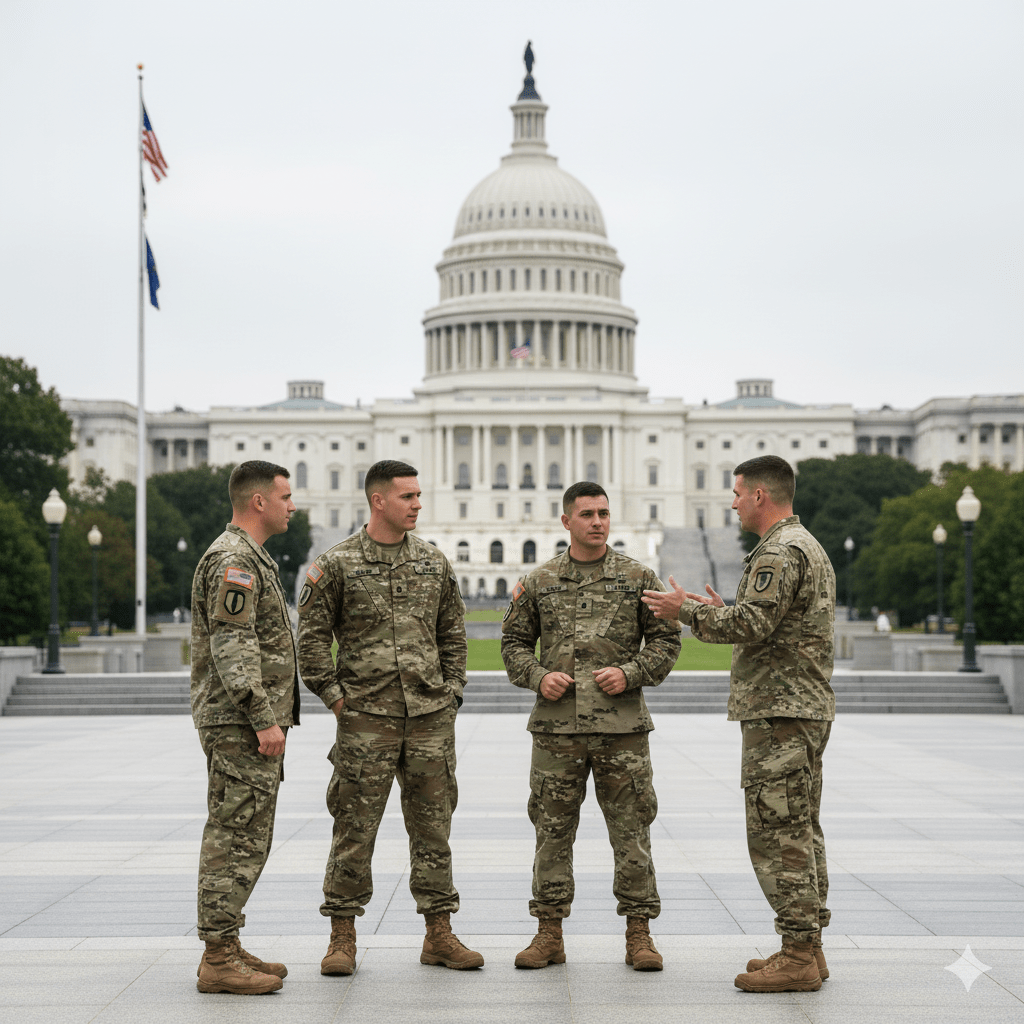Die vergangene Woche vom 19. bis 25. Mai 2025 offenbarte mit erschreckender Deutlichkeit die tiefen Verwerfungen, die die Präsidentschaft Donald Trumps in der amerikanischen Gesellschaft und auf der internationalen Bühne hinterlässt. Von radikalen Umbauplänen im Gesundheitswesen über ethisch fragwürdige Verquickungen von Amt und Privatinteressen bis hin zu einer Außenpolitik, die Verbündete verunsichert und autoritäre Regime zu stärken scheint – die Vereinigten Staaten präsentierten sich als eine Nation im Dauerkrisenmodus. Die Artikel dieser Woche zeichnen das Bild einer Regierung, die etablierte Normen systematisch untergräbt, wissenschaftliche Erkenntnisse missachtet und das Land in eine Spirale aus innenpolitischem Chaos und außenpolitischer Isolation zu treiben droht.
Trumps Feldzug gegen Institutionen: Von Wissenschaftsfeindlichkeit bis zum Angriff auf die Bildungselite
Die Woche begann mit einem alarmierenden Blick auf das US-Gesundheitsministerium unter Robert F. Kennedy Jr., dessen Amtszeit von tiefgreifenden Kontroversen geprägt ist. Seine radikalen Ansichten zu Impfungen, Angriffe auf etablierte medizinische Institutionen und Pläne für einen drastischen Umbau des Gesundheitswesens erschüttern das Vertrauen in die öffentliche Gesundheit. Kennedy, einst für liberales Erbe und Umweltaktivismus bekannt, verbreitet als von Donald Trump ernannter Gesundheitsminister wissenschaftsfeindliche Narrative. Seine von der „Make America Healthy Again“ (MAHA)-Bewegung gestützte Politik stellt den wissenschaftlichen Konsens zu Impfungen infrage und untergräbt das Vertrauen in medizinische Empfehlungen, während die USA mit einem schweren Masernausbruch kämpfen. Geplant ist die Streichung von rund 20.000 Stellen im Gesundheitsministerium (HHS), was einem Viertel der Belegschaft entspricht. Diese Maßnahmen, teilweise unter Mitwirkung von Elon Musks „Department of Government Efficiency“ konzipiert, betreffen massiv die Forschungsfinanzierung und Krankheitsüberwachung. Hunderte Wissenschaftler haben ihre Stellen verloren oder Forschungsgelder wurden gestrichen, was Kritiker wie Senator Bernie Sanders als „Krieg gegen die Wissenschaft“ bezeichnen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Parallel dazu eskalierte der Konflikt zwischen der Trump-Regierung und der Harvard-Universität. Massive Finanzkürzungen und der drohende Entzug der Zulassung für internationale Studierende versetzten die akademische Welt in Aufruhr. Die Regierung wirft Harvard vor, Antisemitismus und Gewalt zu fördern und mit der Kommunistischen Partei Chinas zu konspirieren. Harvard sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Vergeltungsmaßnahme und hat mit Klagen reagiert. Die rund 7.000 internationalen Studierenden Harvards fürchten um ihre Zukunft. Forschungsgelder in Milliardenhöhe wurden gestrichen oder eingefroren, was lebenswichtige Projekte trifft.
Auch die traditionsreiche Militärakademie West Point geriet ins Visier von Trumps Kulturkampf. Im Namen einer strikten Ablehnung von Diversitäts-, Gleichstellungs- und Inklusionsinitiativen (DEI) wurden Bücher über Rassismus und Gender entfernt, Lehrpläne umgeschrieben und Kurse gestrichen. Verteidigungsminister Pete Hegseth bezeichnete Diversität als Stärke als die „dümmste Phrase der Militärgeschichte“. Kritiker sehen darin eine gefährliche Politisierung des Militärs und eine Untergrabung der akademischen Freiheit.
Außenpolitik im Zickzack: Trumps erratischer Kurs zwischen Putin-Nähe, Handelsdrohungen und inszenierten Konflikten
Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges wurden durch ein Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin weiter verkompliziert. Während Trump von exzellenter Stimmung und sofortigen Verhandlungen sprach, blieb Putin vage und pochte auf die „Beseitigung der Grundursachen“ des Konflikts. Diese Diskrepanz nährte Zweifel an einer baldigen Friedenslösung und ließ den Verdacht einer politischen Inszenierung aufkommen. Trump schien nicht bereit, den Druck auf Putin durch Sanktionen zu erhöhen, und äußerte sich positiv über mögliche zukünftige Wirtschaftsbeziehungen, was europäische Verbündete und die Ukraine alarmierte. Präsident Wolodymyr Selenskyj signalisierte zwar Verhandlungsbereitschaft, machte aber klar, dass die Ukraine keinen russischen Ultima-Diktaten zustimmen werde. Die Analysen deuten darauf hin, dass Putin die Verhandlungen als taktisches Manöver nutzt, um Zeit zu gewinnen und die westliche Allianz zu spalten. Trumps unberechenbare, von persönlichen Impulsen und mutmaßlich wirtschaftlichen Interessen getriebene Außenpolitik erweist sich als unkalkulierbarer Faktor.
Gleichzeitig reaktivierte Trump sein handelspolitisches Arsenal und drohte mit massiven Zöllen gegen die Europäische Union (bis zu 50 Prozent) und Apple (25 Prozent auf im Ausland produzierte iPhones). Begründet wurde dies mit der Ankurbelung der amerikanischen Produktion. Ökonomen prognostizieren jedoch gravierende wirtschaftliche Verwerfungen, darunter einen Einbruch der EU-Exporte in die USA um 20 Prozent und einen Preisanstieg in den USA von über 6 Prozent. Die Forderung, Apple solle iPhones in den USA produzieren, wird von Analysten als ökonomisch und logistisch kaum umsetzbar bezeichnet. Die EU prüft Gegenmaßnahmen, sieht sich aber durch interne Abstimmungsprozesse gehemmt.
Auch die Beziehungen zu Südafrika sind angespannt. Trump und seine Getreuen verbreiten das Narrativ eines „weißen Genozids“ in Südafrika, um innenpolitisch bei ihrer Wählerschaft zu punkten. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa kämpft mit Fakten gegen diese Darstellung an. Bei einem Treffen im Oval Office konfrontierte Trump Ramaphosa vor laufenden Kameras mit unbelegten Vorwürfen. Diese Instrumentalisierung außenpolitischer Beziehungen für innenpolitische Zwecke droht, die bilateralen Beziehungen nachhaltig zu beschädigen.
Trumps Vision eines Raketenabwehrsystems namens „Golden Dome“, inspiriert vom israelischen „Iron Dome“, sorgt ebenfalls für internationale Bedenken. Das Projekt, das US-Waffen ins All bringen würde, wird von China und Russland als destabilisierend kritisiert. Experten zweifeln an der technologischen Machbarkeit und den von Trump genannten Kosten von 175 Milliarden Dollar, während das Congressional Budget Office bis zu 542 Milliarden Dollar allein für weltraumgestützte Elemente prognostiziert.
Ethik im Ausverkauf: Die Verquickung von Präsidentenamt und privaten Profiten
Die vergangene Woche warf erneut ein grelles Licht auf die Verflechtung von Donald Trumps Präsidentschaft mit privaten finanziellen Interessen. Ein Angebot Katars, Trump eine gebrauchte Boeing 747 als temporäre Air Force One zu schenken, sorgte für eine Kontroverse. Während Trump das Angebot als „großartige Geste“ pries, warnten Kritiker vor Sicherheitsrisiken und einem Verstoß gegen die „Emoluments Clause“ der US-Verfassung, die Geschenke von ausländischen Staaten ohne Zustimmung des Kongresses verbietet. Die Rechtsauffassung des Justizministeriums unter Generalstaatsanwältin Pam Bondi, einer ehemaligen Lobbyistin für Katar, hält die Annahme für zulässig. Beobachter vermuten, dass Katar sich mit dem 400-Millionen-Dollar-Geschenk Einfluss in Washington sichern will.
Noch direkter scheinen die finanziellen Vorteile aus Trumps Nähe zur Kryptowährungs-Szene zu fließen. Exklusive Dinner mit Investoren und persönlich profitierende Meme-Coins wie der „$TRUMP Coin“ werfen Fragen nach persönlicher Bereicherung und Interessenkonflikten auf. Die Trump Organization und verbundene Unternehmen sollen Hunderte Millionen Dollar durch Verkäufe und Transaktionsgebühren dieses Coins eingenommen haben. Auch die Trump-Familie ist an weiteren Krypto-Projekten wie „World Liberty Financial“ beteiligt. Ethik-Experten werfen Trump vor, die Grenzen zwischen öffentlichem Dienst und persönlicher Bereicherung zu verwischen. Eine Schlüsselfigur ist Justin Sun, ein chinesischer Krypto-Milliardär, gegen den die US-Börsenaufsicht SEC wegen Betrugs ermittelt hatte, das Verfahren aber nach Suns Investitionen in Trump-Projekte aussetzte. Viele Krypto-Investoren erhoffen sich durch die Nähe zu Trump eine industriefreundlichere Regulierung.
Innenpolitische Zerreißproben: Haushaltschaos und eine verschärfte Migrationspolitik
Innenpolitisch stand Trumps Versuch im Fokus, ein ambitioniertes Haushalts- und Infrastrukturpaket („One Big Beautiful Bill“) durch den Kongress zu bringen. Dies entwickelte sich zu einer Machtprobe, die tiefe ideologische Gräben innerhalb der Republikanischen Partei offenlegte. Der fiskalkonservative House Freedom Caucus zeigte sich erzürnt über die prognostizierte Neuverschuldung von 2,8 bis 3,3 Billionen Dollar, während moderate Republikaner Kürzungen bei Medicaid und eine unzureichende Anhebung der SALT-Obergrenze fürchteten. Trumps erratische Führung mit Drohungen und plötzlichen Positionswechseln erschwerte die Verhandlungen zusätzlich. Experten und Ratingagenturen wie Moody’s warnten vor einer Schuldenspirale und stuften die Kreditwürdigkeit der USA herab.
Die umstrittene Praxis, Migranten in Drittstaaten abzuschieben, erreichte unter der Trump-Administration eine neue Eskalationsstufe. Der Fall einer mutmaßlichen Deportation in den krisengeschüttelten Südsudan offenbarte ein System, das rechtsstaatliche Prinzipien und humanitäre Erwägungen einer rigiden Abschreckungspolitik unterordnet. Obwohl das US-Außenministerium selbst vor Reisen in den Südsudan warnt, erwägt die Regierung, Menschen dorthin abzuschieben, was als Teil einer Abschreckungsstrategie gesehen wird. Bundesrichter kritisierten das Vorgehen scharf und rügten die Regierung wegen Missachtung richterlicher Anordnungen und der Verletzung fairer Verfahrensrechte.
Elon Musks Talfahrt: Wenn politische Ambitionen ein Imperium gefährden
Abseits der direkten Trump-Administration geriet auch Tech-Titan Elon Musk weiter unter Druck. Seine politischen Aktivitäten, insbesondere während seiner Tätigkeit für die Trump-Administration, werfen lange Schatten auf sein Unternehmen Tesla. Die Marke sieht sich mit sinkenden Verkaufszahlen, einem ramponierten Ruf und tiefgreifenden internen Verwerfungen konfrontiert. Insbesondere im wichtigen europäischen Markt brachen die Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen dramatisch ein, was Experten direkt mit Musks Person und seiner Unterstützung für rechte politische Strömungen in Verbindung bringen. Interne Probleme wie ein erfolgreich beklagtes milliardenschweres Vergütungspaket für Musk und eine Satzungsänderung, die Aktionärsklagen erschwert, erschüttern das Vertrauen zusätzlich. Auch Aktienverkäufe der Verwaltungsratsvorsitzenden Robyn Denholm inmitten fallender Kurse nährten Zweifel.
Die vergangene Woche hat eindrücklich gezeigt, wie politische Entscheidungen und das Gebaren einzelner Akteure tiefgreifende Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in den USA und darüber hinaus haben. Der rote Faden, der sich durch die Ereignisse zieht, ist eine zunehmende Erosion von Vertrauen – in Institutionen, in wissenschaftliche Fakten und in die Verlässlichkeit politischer Führung. Die langfristigen Folgen dieser Entwicklungen sind kaum absehbar, doch die Vorzeichen, so legen es die Berichte nahe, sind düster.