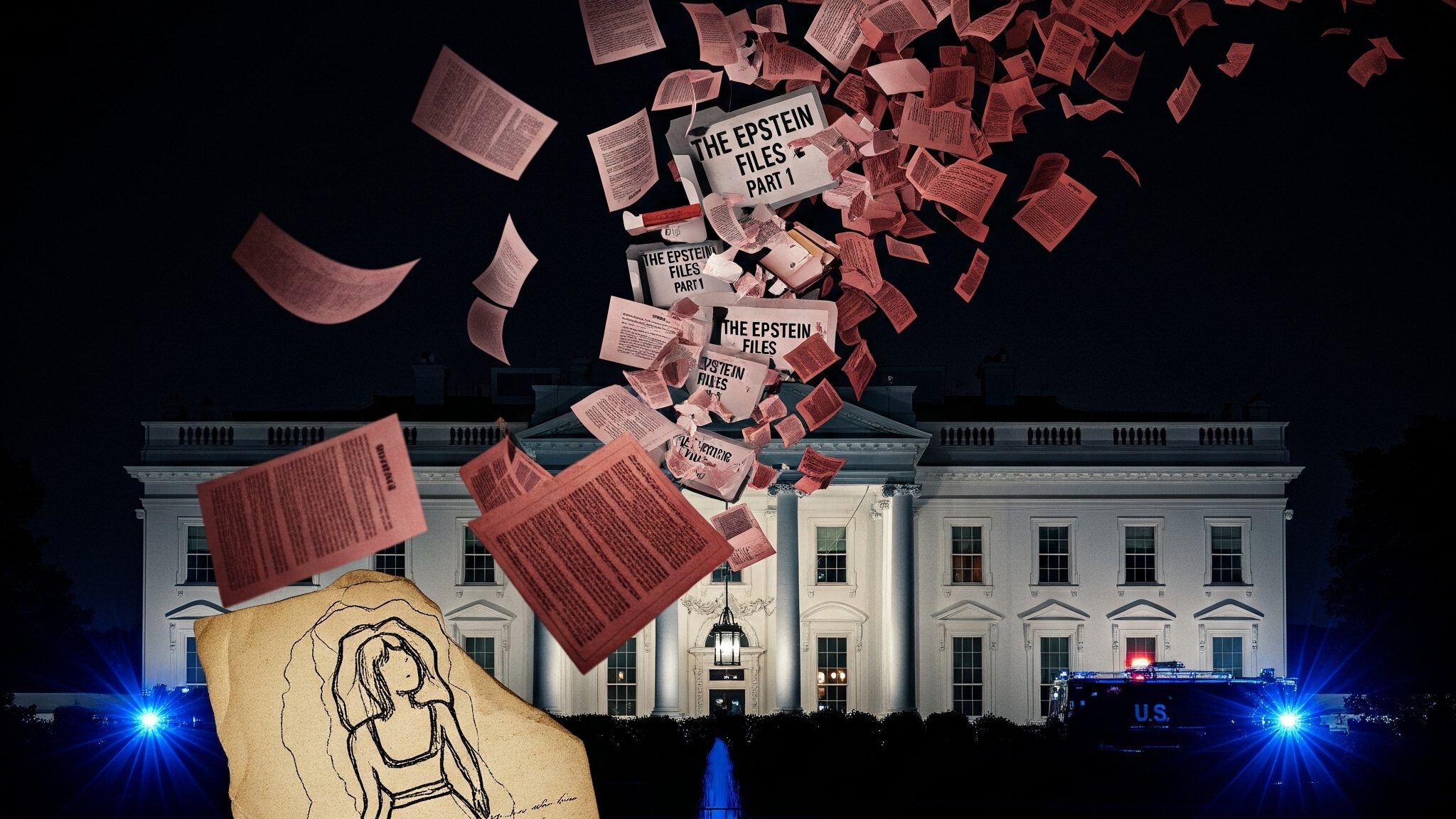
Die vergangene Woche offenbarte mit unerbittlicher Klarheit die Anatomie einer Präsidentschaft, die politische Realitäten nicht gestaltet, sondern im Rausch persönlicher Animositäten und ideologischer Feldzüge zu verbiegen versucht. Von einer erratischen Kehrtwende in der Ukraine-Politik über die offene Revolte der eigenen Basis in der Epstein-Affäre bis hin zur systematischen Demontage staatlicher Institutionen – die Regierung Trump stürzt die USA und die Welt in eine Ära radikaler Unberechenbarkeit. Die Ereignisse der letzten Tage sind mehr als nur politische Manöver; sie sind Symptome eines Systems, das an seinen inneren Widersprüchen zu zerbrechen droht.
Der Epstein-Effekt: Wie eine Verschwörungstheorie die Trump-Bewegung von innen zerfrisst
Die wohl tiefsten Erschütterungen der Woche gingen von einer Causa aus, die wie keine andere die toxische Beziehung zwischen Donald Trump und seiner Basis offenlegt: dem Fall Jeffrey Epstein. Jahrelang wurde die vollständige Offenlegung der Ermittlungsakten als heiliger Gral der MAGA-Bewegung stilisiert – der ultimative Beweis für die Existenz einer korrupten, pädophilen Elite, die Trump zu bekämpfen versprach. Justizministerin Pam Bondi und andere Schlüsselfiguren wie der heutige FBI-Direktor Kash Patel schürten die Erwartungen mit Andeutungen über eine bevorstehende Enthüllung einer brisanten „Klientenliste“.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Paukenschlag kam Anfang Juli, als ausgerechnet Bondis Justizministerium die gesamte Erzählung pulverisierte: Es gebe keine solche Liste, keine Beweise für Erpressung und der Tod Epsteins sei Suizid gewesen. Für die Anhänger, die auf die finale Abrechnung gewartet hatten, kam dies einem Verrat gleich. Eine Welle der Wut und des Misstrauens richtete sich gegen die eigene Führung. Bondi wurde zur Hauptzielscheibe der Angriffe, ihr wurde vorgeworfen, die Basis für dumm zu verkaufen.
Inmitten dieses Infernos platzte die Enthüllung des Wall Street Journal über einen bizarren, anzüglichen Geburtstagsgruß Trumps an Epstein aus dem Jahr 2003, umrahmt von der Zeichnung einer nackten Frau. Trumps Reaktion – eine 10-Milliarden-Dollar-Klage und das leicht zu widerlegende Dementi, er würde keine Bilder zeichnen – wirkte wie ein panisches Ablenkungsmanöver. Die Klage sollte vom eigentlichen Problem ablenken: dem Zorn der eigenen Basis, die sich betrogen fühlt.
Die Krise eskalierte zu einem offenen Machtkampf innerhalb der Regierung, insbesondere zwischen Justizministerin Bondi und dem stellvertretenden FBI-Direktor Dan Bongino, die sich gegenseitig beschuldigten, für das Desaster verantwortlich zu sein. In diesem Klima der Paranoia wurde die Entlassung der angesehenen New Yorker Staatsanwältin Maurene Comey, der Tochter von Trumps Erzfeind James Comey, zum strategischen Bauernopfer. Ihre Kündigung, Teil einer größeren Säuberungswelle im Justizministerium, sollte die wütenden Anhänger besänftigen, die zuvor ihren Kopf gefordert hatten, weil sie sich gegen eine vorschnelle Offenlegung von Ermittlungsdetails ausgesprochen hatte. Trump selbst reagierte auf die Rebellion mit einer Mischung aus Geringschätzung und widersprüchlichen Schuldzuweisungen, was seine strategische Hilflosigkeit nur noch unterstrich.
Psychodrama statt Geopolitik: Trumps Feldzüge erschüttern die Weltordnung
Die gleiche, von persönlichen Impulsen getriebene Politik, die innenpolitisch zu Chaos führt, prägte in der vergangenen Woche auch die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik. Die spektakulärste Volte war Trumps Kehrtwende in der Ukraine-Politik. Nachdem er monatelang die US-Hilfe als sinnlose Verschwendung gegeißelt hatte, inszeniert er sich nun als Schlüssellieferant für die ukrainische Verteidigung. Die Analyse der Umstände legt jedoch nahe, dass dieser Schwenk weniger auf einer strategischen Neubewertung beruht als auf einer tiefen narzisstischen Kränkung. Wladimir Putin hatte Trumps Avancen, den Krieg binnen 24 Stunden zu beenden, monatelang ignoriert und ihn so als schwach und naiv dastehen lassen. Die neue Härte ist daher keine pro-ukrainische, sondern eine Anti-Putin-Reaktion – ein Akt der Selbstbehauptung.
Um diesen Kurswechsel innenpolitisch zu verkaufen, wurde ein Modell entwickelt, das perfekt zur „America First“-Ideologie passt: Die USA liefern die Waffen, aber die europäischen Partner bezahlen die Rechnung. Dieser „Deal“ erlaubt es Trump, sowohl die Falken in der eigenen Partei wie Lindsey Graham zufriedenzustellen als auch seine isolationistische Basis zu beruhigen. Für die NATO bedeutet dieser Pakt jedoch, dass Bündnissolidarität zu einer verhandelbaren Variablen wird, die von den Launen eines Mannes abhängt.
Die Heuchelei innerhalb der Republikanischen Partei ist atemberaubend. Abgeordnete und Senatoren, die eben noch jedes Hilfspaket blockierten, preisen nun Trumps „brillante Diplomatie“. Selbst schärfste Kritiker wie Vizepräsident J.D. Vance standen schweigend an Trumps Seite, als dieser die neuen Waffenlieferungen verkündete. Nur wenige wie Marjorie Taylor Greene halten an ihrer ursprünglichen Position fest und werfen Trump Verrat an den Wahlversprechen vor. Währenddessen löst Trumps Ultimatum in Moskau eine Mischung aus demonstrativer Verachtung und stiller Panik aus. Offiziell gibt man sich unbeeindruckt, doch hinter den Kulissen wächst die Nervosität angesichts einer schweren Wirtschaftskrise, die durch Zinssätze von über 20 Prozent und eine drohende Rezession befeuert wird. Führende Wirtschaftsvertreter warnen, die ökonomischen Reserven seien „erschöpft“.
Dieser erratische Stil setzt sich in der Zerstörung der außen- und sicherheitspolitischen Institutionen fort. Im Verteidigungsministerium führt Minister Pete Hegseth ein Chaos-Regime, das von ideologischen Säuberungen und bizarren Personalentscheidungen geprägt ist und die Funktionsfähigkeit des Pentagons untergräbt. Parallel dazu hat im Außenministerium unter Marco Rubio ein „befohlener Brain Drain“ stattgefunden. Über 1.300 Mitarbeiter, darunter entscheidende Experten für China und Russland, wurden in einer politisch motivierten Aktion entlassen, die Loyalität über Kompetenz stellt und institutionelles Wissen gezielt vernichtet.
Die dramatischsten Folgen zeigte die Zerschlagung der Entwicklungshilfeagentur USAID, die Elon Musk zynisch als „in den Holzspanhäcksler füttern“ beschrieb. Angetrieben von einer unerfahrenen Taskforce, führte der Feldzug gegen angebliche Verschwendung zu realer Verschwendung in Millionenhöhe, wie etwa 500 Tonnen ablaufender Hilfsgüter. Die Konsequenzen sind tödlich: Im Sudan und in Afghanistan führte der abrupte Stopp der Hilfe zu vermeidbaren Todesfällen durch fehlende Medikamente und Hunger.
Zweifrontenkrieg im eigenen Land: Der Angriff auf Migranten und kritische Stimmen
Mit der gleichen Kompromisslosigkeit führt die Regierung einen Krieg an der Heimatfront. Die Einwanderungspolitik wurde durch eine Zangenbewegung aus sichtbarer Repression und unsichtbarer Rechtsaushöhlung radikalisiert. In Metropolen wie Los Angeles patrouillieren Tausende Soldaten der Nationalgarde, um bei Razzien gegen Migranten zu helfen. Gleichzeitig wurde durch ein internes Memo das Recht auf eine Kautionsanhörung für illegal Eingereiste faktisch abgeschafft, was eine unbefristete Inhaftierung ohne richterliche Prüfung ermöglicht. Die Politik manifestiert sich in Projekten wie dem provisorischen Haftlager „Alligator Alcatraz“ in Florida, wo Häftlinge unter katastrophalen Bedingungen leben, und dem absurden Plan, die historische Gefängnisinsel Alcatraz zu reaktivieren – eine Politik, die mehr auf brutale Symbolik als auf praktische Vernunft setzt.
Die zweite Front in diesem Kulturkrieg richtet sich gegen vermeintlich linksliberale Institutionen. Mit der Streichung der Bundeszuschüsse für den öffentlichen Rundfunk (CPB) droht hunderten kleinen, lokalen Sendern in ländlichen Regionen der Kollaps. Die Ironie dabei: Dieser Schlag trifft nicht die urbanen Eliten, sondern die informatorische und kulturelle Lebensader von Trumps eigener Wählerschaft in konservativen Bundesstaaten. Der Wegfall dieser Sender bedeutet das Ende wichtiger Bildungs- und Kulturprogramme sowie des Notfallwarnsystems in Gebieten ohne verlässliches Breitbandinternet.
Wirtschaft als Waffe: Zwischen Zoll-Obsession und dem Angriff auf die Fed
Die wirtschaftspolitische Agenda der Woche wurde von zwei konfrontativen Stoßrichtungen bestimmt. Zum einen droht die Regierung mit einem pauschalen Strafzoll von 30 Prozent auf alle Importe aus der EU. Dies ist kein bloßer Bluff, sondern Teil einer Doktrin, die die durchschnittliche US-Zollrate bereits auf ein Niveau getrieben hat, das seit über einem Jahrhundert nicht mehr erreicht wurde. Die größte strategische Tragik dieser Politik liegt jedoch in ihrer Kurzsichtigkeit: Während Washington einen Handelskrieg mit seinen engsten Verbündeten führt, ignoriert es die systemische Herausforderung durch Chinas Aufstieg zur technologischen Supermacht in Schlüsselbereichen wie KI und Biotechnologie. Der transatlantische Konflikt erweist sich als fatale Ablenkung, von der am Ende nur Peking profitiert.
Zum anderen eskaliert der Angriff auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve. Präsident Trump versucht mit dem durchschaubaren Vorwand explodierender Renovierungskosten, den ihm unliebsamen Fed-Chef Jerome Powell aus dem Amt zu drängen. Sein eigentliches Ziel sind aggressiv niedrigere Zinsen, um die Konjunktur anzuheizen. Ökonomen warnen jedoch vor einem Paradoxon: Die Entlassung Powells könnte die Glaubwürdigkeit der Fed so stark erschüttern, dass die Inflationserwartungen und damit die langfristigen Zinsen steigen würden – genau das Gegenteil dessen, was Trump beabsichtigt. Es ist ein hochriskantes Spiel mit dem Feuer, das die Fundamente der globalen Finanzarchitektur ins Wanken bringen könnte.


