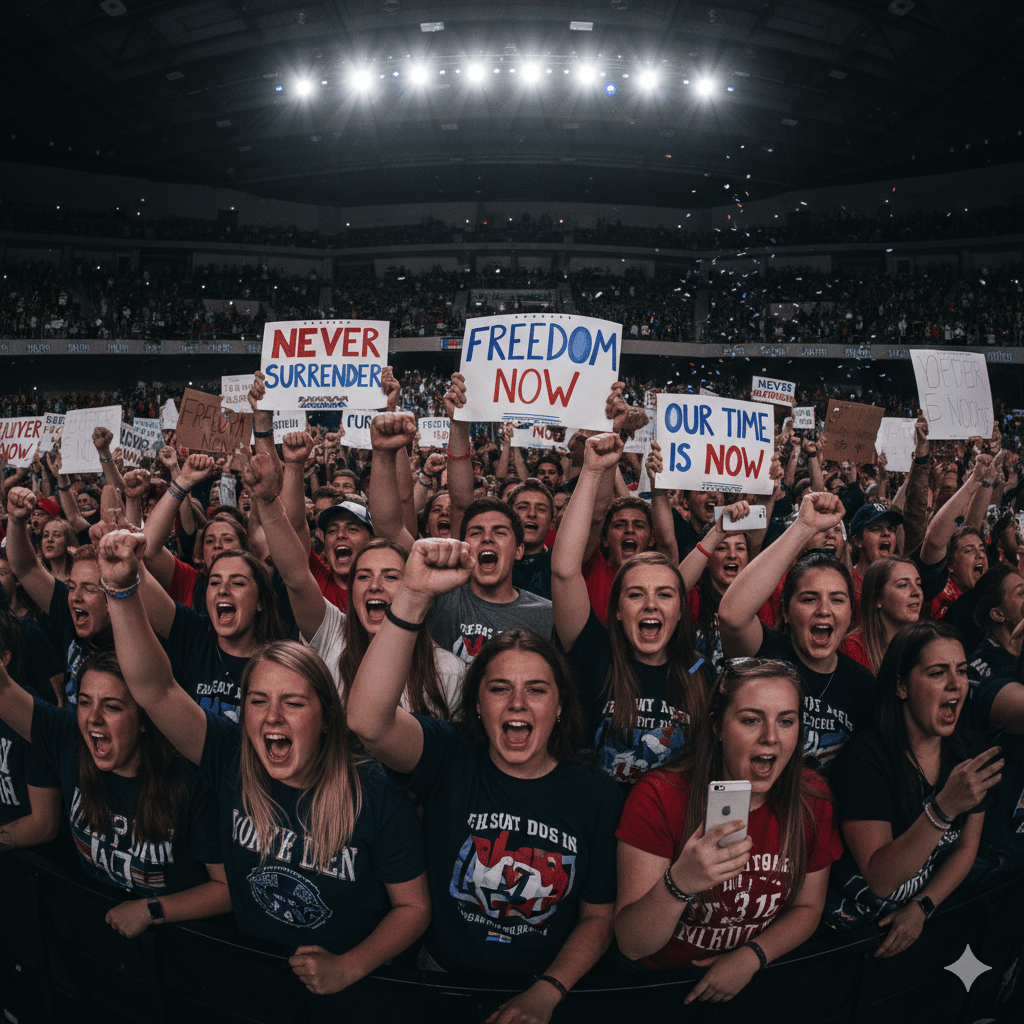Es gibt Abkommen, die auf solidem Fels gebaut sind, und es gibt solche, die auf Treibsand stehen. Das Handelsabkommen, auf das sich die Europäische Union und die USA im Spätsommer 2025 verständigt hatten, schien für einen kurzen, trügerischen Moment zumindest ein befestigter Steg zu sein, ein schmaler Pfad durch das Chaos, das Donald Trumps zweite Amtszeit über die Weltwirtschaft gebracht hat. Ein Pauschalzoll von 15 Prozent auf die meisten EU-Waren – schmerzhaft, aber vielleicht beherrschbar. Doch die Erleichterung in den europäischen Hauptstädten währte kaum länger als ein Wimpernschlag. Nur wenige Tage nach der Verkündung einer gemeinsamen Erklärung, die den fragilen Frieden festschreiben sollte, holte der amerikanische Präsident erneut die verbale Abrissbirne hervor. Auf seiner Plattform Truth Social drohte er mit „erheblichen zusätzlichen Zöllen“ und Exportstopps für Hochtechnologie. Der Adressat war unmissverständlich: Europa.
Dieser Vorfall ist mehr als nur eine weitere Volte in der erratischen Handelspolitik Washingtons. Er legt den Kern eines Konflikts frei, der weit über Zollsätze und Handelsbilanzen hinausreicht. Wir werden Zeugen eines fundamentalen Angriffs auf die Idee einer regelbasierten internationalen Ordnung, angetrieben von einer Administration, die Verträge nicht als bindende Vereinbarungen, sondern als temporäre Waffenstillstände begreift, die jederzeit gebrochen werden können. Donald Trumps Handelspolitik ist kein ungelenker Protektionismus; sie ist ein gezieltes Instrument, um die Souveränität anderer Nationen zu untergraben und die Welt nach den Interessen Amerikas neu zu formen. Anstatt die USA jedoch zu alter Dominanz zurückzuführen, beschleunigt dieser konfrontative Kurs die Fragmentierung der globalen Machtarchitektur und treibt selbst langjährige Verbündete in eine strategische Distanzierung, die eine neue, unberechenbare Weltordnung einläuten könnte.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der digitale Graben: Warum Europas Regeln für Trump ein Angriff sind
Um die Tiefe des Konflikts zu verstehen, muss man den Blick auf das digitale Schlachtfeld richten. Im Zentrum von Trumps Zorn stehen die europäischen Gesetze für digitale Dienste (DSA) und digitale Märkte (DMA). Aus Brüsseler Sicht sind dies Meilensteine der Marktregulierung im 21. Jahrhundert. Sie sollen die erstickende Marktmacht von Tech-Giganten wie Meta, Alphabet oder Apple begrenzen, den Wettbewerb fair gestalten und Bürger vor Hassrede, Desinformation und manipulativen Praktiken schützen. Es ist der Versuch, dem digitalen Raum, diesem wilden Westen der globalisierten Wirtschaft, endlich ein demokratisches Regelwerk überzustülpen.
In Washington jedoch wird dieses Vorhaben nicht als legitime Souveränitätsausübung, sondern als gezielter und diskriminierender Angriff auf amerikanische Kronjuwelen verstanden. Für Donald Trump und seine Regierung sind diese Gesetze nichts anderes als „nichttarifäre Handelshemmnisse“, die darauf abzielen, amerikanischer Technologie gezielt zu schaden. Diese Interpretation wurzelt in einer Weltsicht, in der die Macht von US-Konzernen untrennbar mit der nationalen Stärke der Vereinigten Staaten verknüpft ist. Ein Gesetz, das die Gewinne von Google oder die Reichweite von X (ehemals Twitter) einschränkt, ist in dieser Logik ein direkter Affront gegen Amerika selbst. Die US-Regierung sieht sich als Schutzpatron des Silicon Valley und betrachtet die EU-Regulierung als unzulässigen Eingriff in die Meinungsfreiheit – ein Argument, das vor allem von republikanischen Politikern wie Vizepräsident JD Vance vorgebracht wird. Dass diese Gesetze auch chinesische Firmen wie TikTok betreffen, wird dabei geflissentlich übersehen. Am Ende steht eine unüberbrückbare Kluft: Hier der europäische Anspruch auf regulatorische Autonomie, dort die amerikanische Forderung nach ungehindertem Marktzugang für seine Technologie-Champions.
Ein Pakt, der keiner ist: Das Ende der Verlässlichkeit
Die jüngsten Drohungen Trumps machen auf schmerzhafte Weise deutlich, was Beobachter seit Langem befürchten: Ein Abkommen mit dieser US-Regierung ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Die Erfahrung, dass selbst schriftlich fixierte Vereinbarungen durch einen einzigen Tweet pulverisiert werden können, hat das transatlantische Vertrauen fundamental erodiert. Für Unternehmen und Regierungen wird jede Form der langfristigen Planung zu einem Glücksspiel. Wie soll ein Automobilzulieferer Investitionen in Millionenhöhe tätigen, wenn die Zollsätze für seine Produkte von der tagesaktuellen Laune des US-Präsidenten abhängen?
Diese Unberechenbarkeit ist kein Kollateralschaden, sondern ein bewusst eingesetztes strategisches Werkzeug. Sie hält Kontrahenten und vermeintliche Partner gleichermaßen im Ungewissen und maximiert den eigenen Verhandlungsspielraum. Doch dieser kurzfristige taktische Vorteil hat einen verheerenden langfristigen Preis. Jede willkürliche Strafmaßnahme, jede gebrochene Zusage lehrt den Rest der Welt eine Lektion: Eine zu große Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten ist ein strategisches Risiko, das es zu minimieren gilt. Der Waffenstillstand im Handelskrieg, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mühsam ausgehandelt hatte, steht damit wieder vollständig infrage. Die bittere Erkenntnis in Brüssel lautet, dass man diesen Präsidenten nicht durch Verträge zähmen kann.
Die Karosserie knirscht: Wie kleine Zulieferer unter die Räder geraten
Nirgendwo sind die realen Konsequenzen dieser Politik so greifbar wie in den Werkshallen der globalen Automobilindustrie. Während Giganten wie Toyota oder Mercedes-Benz die zusätzlichen Kosten durch Zölle möglicherweise noch abfedern können, indem sie sie an die Verbraucher weitergeben oder ihre immensen Gewinne schmälern, trifft die Unsicherheit das Rückgrat der Branche mit voller Wucht: die riesigen Netzwerke Tausender kleiner und mittlerer Zulieferbetriebe in Deutschland, Japan und Südkorea. Diese Unternehmen, die alles von Kolben über Kabelbäume bis hin zu Spezialschrauben herstellen, operieren oft mit hauchdünnen Gewinnmargen. Sie sind das Fundament des verarbeitenden Gewerbes und sichern Hunderttausende von Arbeitsplätzen, oft in ländlichen Regionen.
Für sie ist der Handelskonflikt keine abstrakte politische Auseinandersetzung, sondern eine existenzielle Bedrohung. Schon jetzt sind die Auswirkungen messbar. In Japan sind Wert und Volumen der in die USA exportierten Autoteile seit Inkrafttreten der Zölle monatlich gesunken. Eine Umfrage in Südkorea ergab, dass 81 Prozent der Automobil- und Zulieferfirmen Gewinneinbußen durch die Zölle erwarten. Die deutsche Autoindustrie hat bereits Milliarden verloren. Die Zölle wirken wie ein Brandbeschleuniger in einer ohnehin schon angespannten Situation, in der die Branche durch den Wandel zur Elektromobilität und den wachsenden Wettbewerb aus China unter massivem Druck steht. Die Furcht vor einer Aushöhlung der heimischen Industrie durch die Abwanderung von Produktionsstätten in die USA ist allgegenwärtig.
Die Kunst des Überlebens: Wenn alte Freunde zu Risiken werden
Die Reaktion auf den amerikanischen Druck fällt je nach Weltregion unterschiedlich aus. Während Europa noch zwischen Widerstand und Anpassung schwankt, zeichnet sich im globalen Süden eine neue, pragmatische Strategie ab: das sogenannte „strategische Hedging“. Länder wie Brasilien und Indien, die ebenfalls mit massiven Zöllen belegt wurden, weigern sich, den Forderungen Washingtons nachzugeben. Stattdessen aktivieren sie alternative Partnerschaften in Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Südostasien, die sie über Jahre hinweg aufgebaut haben.
Man kann sich das wie eine geopolitische Version einer Anlagestrategie vorstellen: So wie Investoren ihr Risiko auf verschiedene Aktien verteilen, streuen diese Nationen ihre Abhängigkeiten auf verschiedene internationale Beziehungen. Das Ziel ist nicht die Autarkie, sondern der Erhalt der eigenen Handlungsfreiheit. Wenn es Alternativen zum riesigen amerikanischen Markt gibt, kann kein einzelner Partner die Bedingungen diktieren. Dieser Ansatz entspringt einem tiefen Misstrauen gegenüber der amerikanischen Macht, das sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Diese Länder fühlen sich in ihrer Skepsis nun bestätigt und demonstrieren, dass Widerstand gegen den wirtschaftlichen Zwang der USA möglich ist, wenn man die Grundlagen dafür rechtzeitig gelegt hat. Ihre Resistenz ist nicht als platter Anti-Amerikanismus formuliert, sondern als Verteidigung der nationalen Souveränität – ein Vorbild für viele andere Schwellenländer von Indonesien bis Südafrika.
Energie als Waffe: Der faule Kompromiss beim Klimaschutz
Trumps handelspolitischer Feldzug beschränkt sich jedoch nicht auf digitale Güter und Autos. Mit derselben Aggressivität versucht die Administration, ihre fossile Energieagenda weltweit durchzusetzen und andere Nationen zur Abkehr von ihren Klimazielen zu zwingen. Besonders die Windenergie ist dem Präsidenten ein Dorn im Auge. Er nutzt das gesamte Arsenal der größten Volkswirtschaft der Welt – von Zöllen über Visabeschränkungen bis hin zu Hafengebühren –, um den globalen Verbrauch von Öl, Gas und Kohle zu steigern.
Für die Europäische Union ergibt sich daraus ein dramatischer Zielkonflikt. Um einen umfassenden Handelskrieg abzuwenden, hat sie sich in dem Handelsabkommen unter anderem verpflichtet, über drei Jahre amerikanisches Öl und Gas im Wert von 750 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Diese gewaltige Summe steht in direktem Widerspruch zu den ambitionierten Plänen der EU, den Verbrauch fossiler Brennstoffe drastisch zu reduzieren, um die Klimakrise zu bekämpfen. Es ist ein Pakt mit dem Teufel, bei dem kurzfristige wirtschaftliche Schadensbegrenzung mit langfristigen ökologischen Notwendigkeiten erkauft wird. Die USA drängen Europa in eine energiepolitische Schizophrenie: Man soll gleichzeitig Vorreiter beim Klimaschutz und Großabnehmer amerikanischer fossiler Energien sein. Dies offenbart die innenpolitischen Triebfedern von Trumps Politik: das Ziel der „Energiedominanz Amerikas“ und die Sicherung der nationalen Wirtschaft um jeden Preis, selbst wenn dafür globale Klimaziele geopfert werden müssen.
Brüssels Zwickmühle: Kämpfen, kapitulieren oder clever sein?
Angesichts dieser vielschichtigen Konfrontation steckt die Europäische Union in einer Zwickmühle. Einerseits betonen Kommissionsvertreter immer wieder, dass die Souveränität der EU, eigene Gesetze zu erlassen, nicht verhandelbar sei. Ein Einknicken vor den amerikanischen Drohungen käme einer politischen Kapitulation gleich und würde es den USA erlauben, die Regeln für Europa zu schreiben. Andererseits ist die Verhandlungsposition der Europäer schwach, und die Bereitschaft zu einer weiteren Eskalation ist gering. Die EU hat bereits erhebliche Zugeständnisse gemacht, indem sie höhere Zölle auf wichtige Exportgüter von Autos bis Medikamenten akzeptierte.
Die Abhängigkeit von den USA, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, bleibt trotz aller Diversifizierungsbemühungen hoch. Als langfristige Antwort auf diese Erpressbarkeit fordern Experten daher eine Art „De-Risking“ auch gegenüber den USA. Die EU müsse ihre Abhängigkeit in Schlüsselbereichen wie Software, Cloud-Diensten und Zahlungssystemen verringern, indem sie eigene europäische Lösungen fördert. Doch solche Strategien brauchen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um zu wirken. Kurzfristig bleibt Brüssel nur die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen: einem potenziell verheerenden Handelskrieg oder einem faulen Frieden, der die eigenen Prinzipien aushöhlt.
Die Welt nach dem Beben: Beschleunigter Abstieg statt neuer Dominanz?
Was bleibt, ist das Bild einer Welt im Umbruch. Donald Trumps Politik der handelspolitischen Konfrontation wird ihr erklärtes Ziel, die amerikanische Dominanz wiederherzustellen, ironischerweise verfehlen. Stattdessen beschleunigt sie den relativen Abstieg der USA, indem sie der Welt täglich vor Augen führt, dass man sich auf die einstige Führungsmacht des Westens nicht mehr verlassen kann. Immer mehr Nationen werden nach Alternativen suchen, selbst wenn diese weniger effizient sind – denn Autonomie wird wichtiger als Effizienz, wenn man dem dominanten Partner nicht mehr trauen kann.
Das Ergebnis wird keine neue, stabile Weltordnung sein, sondern eine Art „gemanagtes Durcheinander“ – eine Rückkehr zur unübersichtlichen Multipolarität des frühen 20. Jahrhunderts mit vielen Machtzentren und schwachen internationalen Institutionen. Diese fragmentierte Welt dient niemandes Interessen. Sie wird ärmer, unsicherer und konfliktanfälliger sein. Die USA könnten noch immer auf Diplomatie statt auf Zwang setzen, und aufstrebende Mächte wie Brasilien und Indien könnten ihre Absicherungsstrategien mit Kooperation in gemeinsamen Interessensfeldern ausbalancieren. Doch das erfordert eine politische Führung, die erkennt, dass die alten Regeln nicht mehr gelten und neue geschrieben werden müssen. Die Frage ist nicht mehr, ob die alte Ordnung gerettet werden kann. Sie kann es nicht. Die Frage ist, ob es gelingt, aus den Trümmern ein neues, halbwegs stabiles Regelwerk zu errichten – oder ob die Welt blind ins Chaos stolpert.