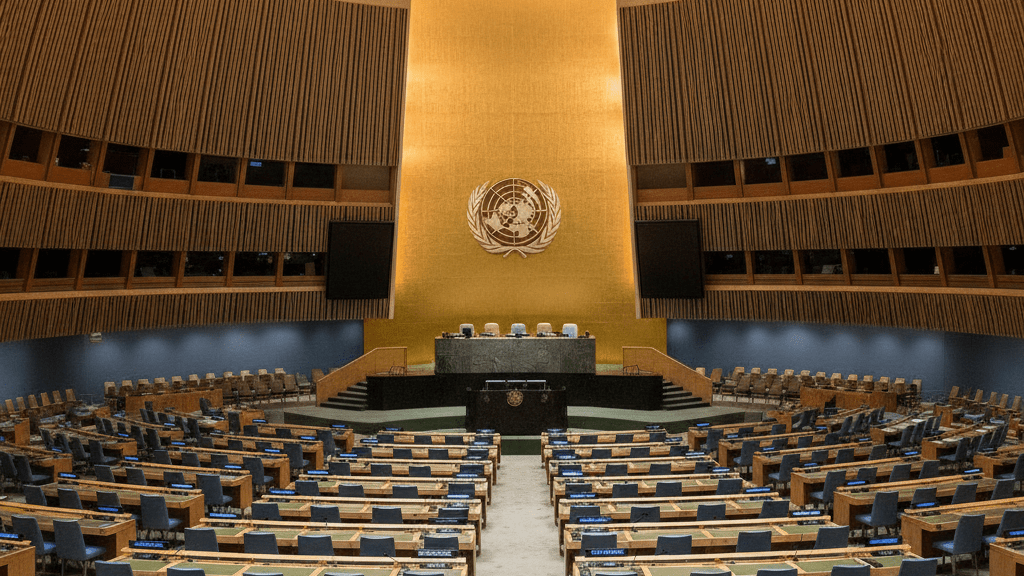
Die Szenerie im großen Saal der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist stets dieselbe, ein Ritual der Weltgemeinschaft, das Stabilität und Ordnung suggeriert. Doch als Donald Trump am 23. September 2025 das Podium betrat, war die vertraute Kulisse nur noch die Fassade für eine tektonische Verschiebung. Seine Rede war weit mehr als die bekannte Polemik eines Präsidenten, der den Multilateralismus verachtet; sie war die Vollstreckung eines lange angekündigten Urteils über eine Weltordnung, die nach 1945 unter amerikanischer Führung geschaffen wurde und nun von ebenjener Führung gezielt erodiert wird. Was die Welt an diesem Tag erlebte, war nicht bloß die Wiederholung der „America First“-Doktrin aus der ersten Amtszeit. Die zentrale, beunruhigende These, die sich aus Trumps Auftritt und den damit verbundenen politischen Manövern ergibt, lautet: Wir sind Zeugen einer planvollen Zerstörung, bei der die rhetorische Abrissbirne und die finanzielle Austrocknung als präzise aufeinander abgestimmte Werkzeuge dienen, um die Vereinten Nationen in die Bedeutungslosigkeit zu drängen und einem neuen Zeitalter des reinen Machtprinzips den Weg zu ebnen.
Die Methode hinter dem Spektakel
Wer Trumps Auftritt lediglich als eine weitere exzentrische Darbietung für seine innenpolitische Basis abtut, verkennt den strategischen Kern seines Handelns. Die schrille Rhetorik, die Beschwerden über einen defekten Teleprompter oder eine steckengebliebene Rolltreppe – all dies sind bewusst inszenierte Nebelkerzen, die von der eigentlichen Substanz seiner Politik ablenken sollen. Sie dienen dem Narrativ des pragmatischen Geschäftsmannes, der auf eine dysfunktionale, bürokratische Organisation trifft und deren Ineffizienz verspottet. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich eine knallharte Strategie der Aushöhlung. Die eigentliche Waffe im Arsenal der Trump-Administration ist nicht das Wort, sondern der Entzug von Geld und Legitimität.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wurden Zahlungen an die Vereinten Nationen in Milliardenhöhe zurückgehalten. Dies ist kein administratives Versehen, sondern ein politisches Instrument. Die Kürzungen treffen das Herz der Organisation: Friedensmissionen, humanitäre Hilfsprogramme wie das Welternährungsprogramm der UN und die Flüchtlingshilfe. Die Folge ist eine hausgemachte Haushaltskrise, die bereits jetzt zu massivem Stellenabbau und zur drastischen Reduzierung von Programmen zwingt. Wenn der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, vor Kürzungen warnt, die für viele Menschen einem Todesurteil gleichkommen, ist das keine Übertreibung, sondern die direkte Konsequenz amerikanischer Politik. Die USA, einst der größte Beitragszahler und Architekt des Systems, agieren nun als dessen aktivster Saboteur. Der Rückzug aus zentralen Gremien wie dem UN-Menschenrechtsrat oder der Weltgesundheitsorganisation ist dabei nur die logische Fortsetzung dieser Politik der Delegitimierung.
Der Mythos des globalen Friedensstifters
In einem bemerkenswerten Akt politischer Chuzpe inszeniert sich Trump inmitten dieses Zerstörungswerks als der einzige wahre Friedensstifter der Welt. Seine wiederholte Behauptung, sieben Kriege beendet zu haben, ist zu einem zentralen Element seiner politischen Legendenbildung geworden, gezielt eingesetzt für sein heimisches Publikum und die offene Ambition, den Friedensnobelpreis zu erhalten. Doch ein genauerer Blick auf diese angeblichen Erfolge entlarvt ein Muster aus Übertreibung, Umdeutung und schlichter Falschdarstellung.
Die Realität vor Ort spricht eine andere Sprache. So erklärte der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi, am Rande der Generalversammlung unmissverständlich, dass das von den USA vermittelte Abkommen mit Ruanda keineswegs zu einem Ende der Kämpfe geführt habe. Ähnlich verhält es sich im Kaukasus, wo das Abkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan von Experten eher als wirtschaftliche Partnerschaft denn als umfassender Friedensvertrag gewertet wird, zumal zentrale territoriale Streitfragen ungelöst bleiben. In den beiden Konflikten, die die Welt am meisten beschäftigen – der Krieg in der Ukraine und der verheerende Konflikt in Gaza –, ist von einem Erfolg Trumps noch weniger zu erkennen. Seine Bemühungen um eine Lösung in der Ukraine sind nach einem Treffen mit Wladimir Putin weitgehend zum Erliegen gekommen, während der Krieg mit unverminderter Härte andauert. In Gaza wiederum wächst seine Frustration über die Eskalationsstrategie Israels, ohne dass eine tragfähige Lösung in Sicht wäre. Diese Diskrepanz zwischen Selbstinszenierung und Realität ist kein Zufall; sie ist das Wesen einer Politik, die den Anschein des Erfolgs über dessen Substanz stellt.
Die ideologischen Kriegsschauplätze der neuen Weltordnung
Trumps Generalangriff auf die multilaterale Ordnung konzentriert sich auf zwei zentrale ideologische Schlachtfelder: den Klimawandel und die Migration. Hier wird der Bruch mit dem globalen Konsens am radikalsten vollzogen. Seine Brandmarkung des Klimawandels als „weltweit größten Schwindel aller Zeiten“ ist nicht nur eine Absage an wissenschaftliche Fakten, sondern eine Kriegserklärung an das Pariser Klimaabkommen und jede Form internationaler Umweltpolitik. Indem er grüne Politik als „grüne Abzocke“ diffamiert, die unweigerlich in den Bankrott führe, schafft er ein Feindbild, das perfekt in sein Narrativ des nationalen Eigeninteresses gegen eine „globalistische“ Agenda passt.
Sein vergiftetes Lob für Deutschland, das unter der neuen Führung von Bundeskanzler Friedrich Merz angeblich den „kranken Weg“ der grünen Politik verlassen habe und zu fossilen Brennstoffen und Kernenergie zurückgekehrt sei, entbehrt dabei jeder faktischen Grundlage. Es dient allein dem Zweck, eine angebliche Bestätigung seiner Weltsicht zu konstruieren. Ebenso faktenwidrig ist seine Behauptung, China würde keine Windkraftanlagen bauen, obwohl das Land weltweit führend in der Erzeugung von Windenergie ist. Fakten spielen in dieser Auseinandersetzung jedoch eine untergeordnete Rolle; es geht um die Zerstörung einer gemeinsamen Problemwahrnehmung als Voraussetzung für globale Lösungen.
Noch apokalyptischer fällt seine Rhetorik beim Thema Migration aus. Er zeichnet das Bild eines von „illegalen Migranten überrannten“ Europas, das kurz vor dem „Untergang der westlichen Zivilisation“ stehe. Diese dramatische Wortwahl zielt direkt auf die Ängste seiner Wählerschaft und bedient ein isolationistisches und fremdenfeindliches Weltbild. Er erklärt das „Experiment der offenen Grenzen“ für gescheitert und fordert dessen sofortiges Ende. Damit negiert er nicht nur die völkerrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Flüchtlingsschutzes, sondern stellt Migration als gezielten Angriff auf die nationale Souveränität dar.
Das Dilemma der Verbündeten im transatlantischen Vakuum
Für die traditionellen Verbündeten der USA, insbesondere in Europa, schafft diese Politik ein kaum lösbares Dilemma. Sie sind gefangen zwischen der sicherheitspolitischen Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten und der frontalen Konfrontation durch deren Präsidenten. Die Reaktionen auf Trumps Rede spiegeln diese Zerrissenheit wider. Die Präsidentin der Generalversammlung, Annalena Baerbock, reagierte auf Trumps Klage über den Teleprompter mit einer subtilen, ironischen Spitze – „Die Teleprompter funktionieren gut“ –, ein kleiner Akt des passiven Widerstands, während sie seine Tiraden gegen die deutsche Energiepolitik schweigend ertragen musste.
Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nutzte seine Rede für eine kaum verhüllte Kritik an Trumps unilateralen Sanktionen und dem Druck auf die brasilianische Justiz. Doch selbst diese kritischen Stimmen können nicht überdecken, dass es keine geschlossene Gegenstrategie gibt. Trump spielt die Verbündeten gezielt gegeneinander aus. Er fordert von Europa eine harte Haltung gegenüber Russland und die sofortige Einstellung aller Energieimporte, während er dieselben europäischen Nationen gleichzeitig mit Strafzöllen überzieht und ihre Politik öffentlich herabwürdigt. Dieser Widerspruch zwischen der Forderung nach Kooperation und der gleichzeitigen Bestrafung ist ein zentrales Merkmal seiner Politik. Er will keine Partner auf Augenhöhe, sondern Vasallen, die sich seinen Bedingungen unterwerfen. Der Streit um die Anerkennung eines palästinensischen Staates, bei dem enge Verbündete wie Großbritannien, Frankreich und Kanada einen anderen Kurs als die USA einschlagen, hat das Potenzial, diesen Riss im transatlantischen Bündnis weiter zu vertiefen und es an einen kritischen Punkt zu führen.
Chinas Aufstieg im Schatten des amerikanischen Rückzugs
Die Natur und die Politik verabscheuen ein Vakuum. Während die USA sich von den Institutionen zurückziehen, die sie einst geformt haben, hinterlassen sie eine Lücke, die andere Mächte nur zu gerne füllen. An vorderster Front steht China, das sich zunehmend als verantwortungsbewusster Hüter der internationalen Ordnung inszeniert. Pekings Diplomaten nutzen die amerikanische Abkehr geschickt, um sich als Verfechter des Multilateralismus zu präsentieren.
Dieser Wandel manifestiert sich bereits in konkreten Handlungen. China verstärkt sein Engagement in UN-Friedensmissionen und erhöht seine Beiträge zu Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation, um die von den USA hinterlassenen finanziellen Lücken zu schließen. Dies ist mehr als nur eine symbolische Geste. Es ist ein langfristig angelegter strategischer Schachzug, um Einfluss und Gestaltungsmacht innerhalb des UN-Systems zu gewinnen. Die Ironie der Geschichte könnte kaum größer sein: Die von den USA dominierte Weltordnung wird nicht durch einen frontalen Angriff eines Rivalen, sondern durch den selbstgewählten Rückzug ihres Schöpfers ausgehöhlt, was dem Rivalen die Tür öffnet. Analysten warnen daher, dass Trumps „America First“-Politik langfristig nicht zu einer Stärkung, sondern zu einer dramatischen Schwächung des globalen Einflusses der USA führen könnte.
Die Inszenierung der Macht und die Leere der Bühne
Am Ende bleibt der Eindruck einer perfekt inszenierten Show, die jedoch auf einer zunehmend leeren Bühne stattfindet. Als Trump 2018 in seiner ersten Amtszeit vor der Generalversammlung mit seinen Erfolgen prahlte, erntete er noch Gelächter. Dieses Mal herrschte im Saal weitgehend Stille. Das Lachen ist der Welt vergangen, weil die Konsequenzen von Trumps Politik nun für alle spürbar sind. Die Organisation, die er verhöhnt, leidet unter einer existenziellen Krise. Ihre Unfähigkeit, Kriege wie in der Ukraine zu beenden, ist auch eine Folge der Blockadehaltung von Vetomächten wie Russland im Sicherheitsrat – eine strukturelle Schwäche, die Trump für seine Fundamentalkritik instrumentalisiert.
Seine Rede vor den Vereinten Nationen war somit keine Anomalie, sondern eine präzise Zustandsbeschreibung seiner Präsidentschaft und ihrer globalen Auswirkungen. Es ist die Proklamation einer neuen Ära, in der internationale Verträge, gemeinsame Werte und diplomatische Prozesse einer rücksichtslosen Interessenpolitik weichen müssen. Die Vereinten Nationen wurden, wie es einer ihrer frühen Generalsekretäre formulierte, nicht geschaffen, um die Menschheit in den Himmel zu führen, sondern um sie vor der Hölle zu bewahren. Donald Trump scheint entschlossen zu sein, dieses letzte Sicherheitsnetz eigenhändig zu demontieren. Die Frage, die nach diesem denkwürdigen Tag im Raum steht, ist nicht mehr, ob die alte Ordnung überleben kann, sondern was an ihre Stelle treten wird.


