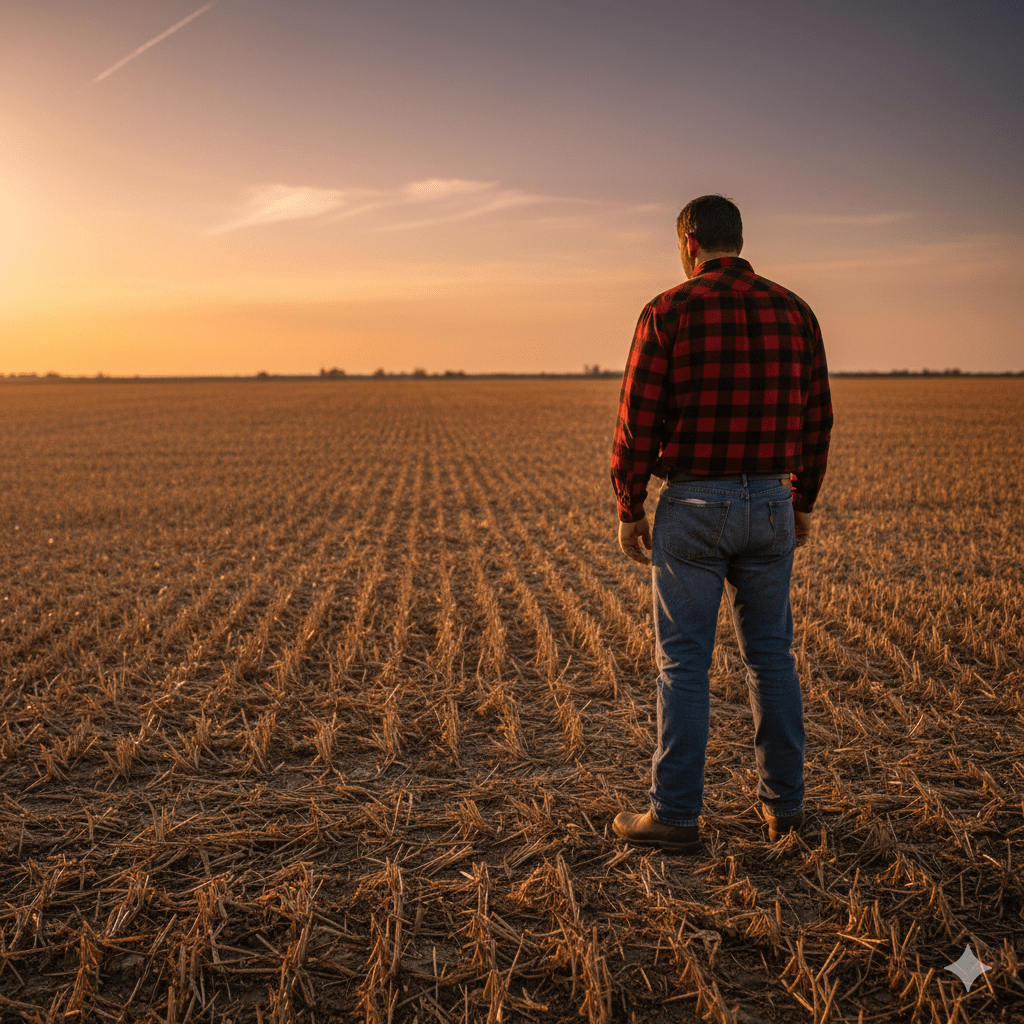Ein juristischer Paukenschlag, der vor allem ein politisches Manöver ist: Donald Trump hat mit einer Verleumdungsklage in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar das Wall Street Journal, dessen Mutterkonzern News Corp und Medienmogul Rupert Murdoch ins Visier genommen. Der Zorn des Präsidenten entzündete sich an einem Bericht über einen mutmaßlich von ihm stammenden, anzüglichen Geburtstagsgruß an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aus dem Jahr 2003. Eine handschriftliche Zeichnung einer nackten Frau, so die Zeitung, habe eine pikante Botschaft umrahmt: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein“. Trumps Reaktion ist eine Mischung aus wütendem Dementi und strategischem Kalkül. Doch bei genauerer Betrachtung ist die Klage weit mehr als der Versuch einer juristischen Ehrenrettung. Sie entpuppt sich als ein komplexes Schauspiel, das darauf abzielt, von eigenen Widersprüchen abzulenken, den Druck der eigenen Basis zu kanalisieren und eine langjährige Kampagne gegen kritische Medien fortzusetzen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die brüchige Verteidigungslinie des Präsidenten
Das Fundament von Trumps Verteidigung ist ebenso kategorisch wie brüchig. Er bestreitet nicht nur die Urheberschaft des Briefes, sondern behauptet vehement: „Ich zeichne keine Bilder“. Diese absolute Aussage sollte seine Distanz zu dem anstößigen Fundstück zementieren, doch sie wird durch seine eigene Vergangenheit konterkariert. Wie aus den vorgelegten Berichten hervorgeht, hat Trump über Jahre hinweg sehr wohl gezeichnet. Immer wieder spendete er mit einem dicken, schwarzen Filzstift angefertigte Skizzen von Gebäuden und Skylines für wohltätige Zwecke, die anschließend für Tausende von Dollar versteigert wurden. In einem seiner Bücher beschrieb er diese Tätigkeit sogar selbst. Die stilistische Ähnlichkeit – insbesondere die Verwendung eines dicken Markers – zu der im Wall Street Journal beschriebenen Zeichnung ist frappierend. Diese offensichtliche Diskrepanz zwischen seiner Behauptung und den belegten Fakten untergräbt seine Glaubwürdigkeit im Kern und wirft die Frage auf, warum er eine so leicht zu widerlegende Verteidigungslinie wählt. Die Antwort liegt vermutlich weniger in der juristischen als in der politischen Arena.
Ein Ablenkungsmanöver mit doppeltem Boden
Die Klage gegen das, was Trump eine „Müllzeitung“ nennt, kommt zu einem für ihn politisch heiklen Zeitpunkt. Seit Längerem steht der Präsident unter massivem Druck aus den Reihen seiner treuesten Anhänger. Diese fordern die vollständige Offenlegung der Ermittlungsakten im Fall Epstein und fühlen sich von der bisherigen Zurückhaltung der Regierung betrogen. Sie hatten darauf vertraut, dass Trump sein Versprechen einlöst, die „korrupte Elite“ zu entlarven, die sie hinter den Verbrechen Epsteins vermuten. Die Veröffentlichung des Artikels im Wall Street Journal bot Trump nun die perfekte Gelegenheit für ein Ablenkungsmanöver. Zeitgleich mit seiner öffentlichen Drohung, die Zeitung zu verklagen, wies er das Justizministerium an, die Freigabe von Unterlagen aus dem Epstein-Fall zu beantragen. Auf den ersten Blick wirkt dies wie ein Entgegenkommen gegenüber seiner Basis. Doch bei genauerer Betrachtung handelt es sich um eine scheinbare Transparenzoffensive. Freigegeben werden sollen lediglich die Protokolle der Grand Jury, nicht aber die gesamten Ermittlungsakten, die seine Anhänger fordern. Trump liefert damit nur einen Bruchteil des Verlangten und kann sich gleichzeitig als Opfer einer Medienkampagne inszenieren, der trotz allem für Aufklärung kämpft.
Die Klage selbst folgt einem erprobten Muster in Trumps Arsenal gegen unliebsame Berichterstattung. Während viele seiner früheren Klagen gegen Medienhäuser abgewiesen wurden, konnte er zuletzt beachtliche außergerichtliche Einigungen mit ABC und Paramount erzielen. Diese Erfolge erhöhen den Druck auf News Corp, denn sie zeigen, dass eine Klage für das betroffene Unternehmen teuer und langwierig werden kann, unabhängig von ihrem endgültigen Ausgang. Das Wall Street Journal zeigt sich indes unbeeindruckt und kündigte an, die eigene, sorgfältige Berichterstattung „energisch verteidigen“ zu wollen. Es zeichnet sich ein Kampf zweier unnachgiebiger Gegner ab. Indem Trump diesen Kampf nicht nur für sich, sondern im Namen „aller Amerikaner“ gegen die „Fake News Medien“ zu führen vorgibt, stilisiert er einen persönlichen Rechtsstreit zu einem populistischen Kreuzzug. Es geht nicht mehr um einen möglicherweise kompromittierenden Brief, sondern um einen angeblichen Angriff auf die Pressefreiheit, den er im Namen des Volkes abwehrt. Am Ende wird die juristische Auseinandersetzung wohl von einer zentralen Frage abhängen: Kann die Echtheit des Briefes zweifelsfrei bewiesen oder widerlegt werden? Doch politisch hat Trump sein Ziel bereits erreicht: Er hat die Agenda bestimmt, seine Gegner attackiert und seine Anhänger mit einer neuen Erzählung von Kampf und Verrat versorgt.