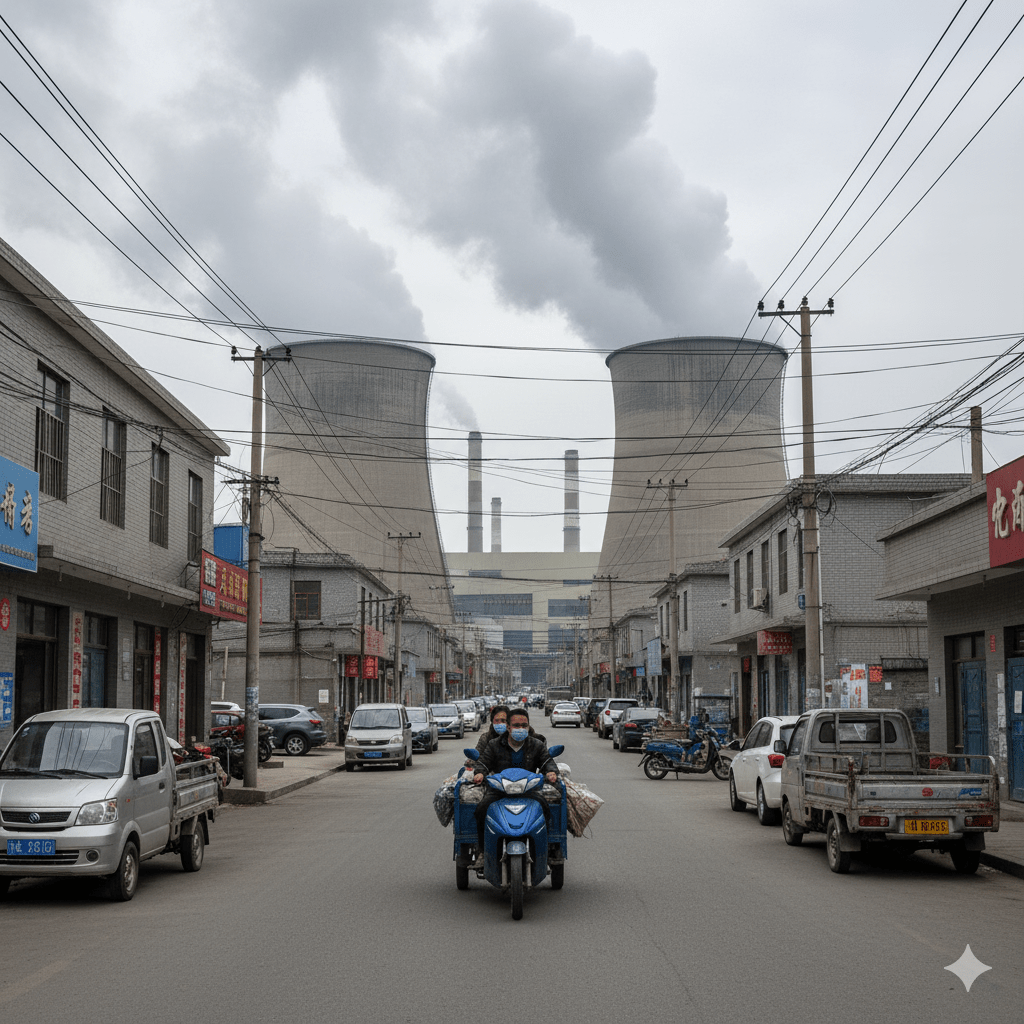Ein einzelner, gewalttätiger Vorfall, ein blutverschmiertes Gesicht auf einem Foto, das in den sozialen Medien kursiert – mehr braucht es manchmal nicht, um ein politisches Feuer zu entfachen, das schon lange unter der Oberfläche schwelt. Der brutale versuchte Raubüberfall auf Edward Coristine, einen ehemaligen Mitarbeiter der Regierung, in den Straßen von Washington, D.C., war genau dieser Funke. Für Präsident Donald Trump war es nicht nur ein Verbrechen, sondern eine willkommene Gelegenheit. Es war der dramaturgische Höhepunkt, den er brauchte, um seine seit Langem gehegten Pläne für die Hauptstadt der Nation mit neuer Wucht voranzutreiben: die schrittweise Demontage ihrer Autonomie und die Inszenierung einer föderalen Machtübernahme. Was wir derzeit in Washington erleben, ist weit mehr als ein Streit über Kriminalitätsstatistiken. Es ist ein politisches Schauspiel, eine Machtdemonstration, bei der die Stadt selbst zur Bühne für ein viel größeres Stück wird: den Konflikt zwischen föderaler Autorität und lokaler Selbstbestimmung, angetrieben von einer sehr persönlichen Agenda des Präsidenten.
Im Krieg der Narrative: Zwei Versionen einer Stadt
Die Auseinandersetzung um die Zukunft Washingtons wird an vorderster Front mit Zahlen und Erzählungen geführt, und die beiden Versionen der Realität könnten unterschiedlicher nicht sein. Im Universum des Weißen Hauses ist die Hauptstadt ein „schmutziger, von Kriminalität heimgesuchter Todeskäfig“, ein Ort des Verfalls, an dem die liberale Stadtregierung versagt habe. Trump zeichnet mit düsteren Pinselstrichen das Bild einer Stadt am Rande des Zusammenbruchs und nutzt den Angriff auf Coristine als ultimativen Beweis dafür, dass die Kriminalität „außer Kontrolle“ sei. Seine Lösung: eine massive Intervention des Bundes.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch ein Blick in die offiziellen Kriminalitätsstatistiken der städtischen Polizei, des Metropolitan Police Department (MPD), erzählt eine völlig andere Geschichte. Diese Daten malen das Bild eines signifikanten Erfolgs. Schon seit dem Vorjahr ist die Gewaltkriminalität in D.C. rückläufig, ein Trend, der sich auch auf nationaler Ebene zeigt. Konkret sind die Zahlen für das laufende Jahr beeindruckend: Angriffe mit einer gefährlichen Waffe sind um 19 Prozent und Raubüberfälle sogar um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Auch die Zahl der Tötungsdelikte ist zurückgegangen. Ein hochrangiger Beamter des MPD, der anonym bleiben möchte, führt diesen Erfolg unmissverständlich auf die „harte Arbeit und das Engagement des MPD“ zurück und betont, dass die jüngsten Maßnahmen der Bundesbehörden damit „wenig zu tun“ hätten. Hier prallen zwei unvereinbare Wirklichkeiten aufeinander: die politisch konstruierte Katastrophe des Präsidenten und der statistisch belegte Erfolg der lokalen Polizei.
Operation „Sicher und Schön“: Politische Kosmetik statt Verbrechensbekämpfung?
Das zentrale Instrument von Trumps Agenda ist die im März per Exekutivanordnung ins Leben gerufene „D.C. Safe and Beautiful Task Force“. Offiziell soll sie die Lebensqualität in der Hauptstadt verbessern. Doch die konkreten Maßnahmen werfen die Frage auf, ob es hier wirklich um die Bekämpfung schwerer Gewaltverbrechen geht oder vielmehr um eine hochgradig sichtbare, fast theatralische Form der Ordnungsstiftung. Die Aktionen konzentrieren sich auffällig auf sogenannte „Quality of Life“-Delikte. So wurden in Parks auf Bundesgebiet, wie dem Logan Circle, Menschen für das Rauchen eines Marihuana-Joints oder den Besitz offener Alkoholbehälter verhaftet. Die US Park Police hat ihre Verhaftungen im ersten Halbjahr um 37 Prozent gesteigert.
Gleichzeitig wurde die Räumung von Obdachlosencamps, die nun „proaktiv“ von der Nationalparkverwaltung verfolgt wird, massiv intensiviert. Seit Erlass der Verordnung wurden 64 solcher Lager geräumt. Auch die Entfernung von Graffiti wird nun mit einem GIS-System akribisch verfolgt und koordiniert. Diese Strategie erinnert an die „Broken-Windows“-Theorie, bei der die Beseitigung kleinerer Missstände die Entstehung größerer Kriminalität verhindern soll. Kritiker sehen darin jedoch eine reine Ablenkung und eine Kriminalisierung von Armut und nicht-gewalttätigem Verhalten, während die wahren Ursachen der Kriminalität unberührt bleiben. Es entsteht der Eindruck einer politischen Säuberungsaktion, die mehr auf ein sauberes Erscheinungsbild für Touristen und Politiker abzielt als auf die nachhaltige Sicherheit der Anwohner.
Der Drahtseilakt der Bürgermeisterin: Zwischen Kooperation und Kapitulation
In diesem Spannungsfeld bewegt sich D.C.s Bürgermeisterin Muriel E. Bowser auf einem schmalen Grat. Ihre Position ist ein diplomatischer Drahtseilakt ohne Netz und doppelten Boden. Einerseits kann sie die verstärkte föderale Präsenz nicht einfach ablehnen. Sie begrüßt öffentlich die „engere Partnerschaft mit den Bundesbehörden“ und die „Zusammenarbeit“, um die Kriminalität einzudämmen. Das Weiße Haus beschreibt die Beziehung als „respektvoll und hochproduktiv“. Diese Kooperation ist ein pragmatischer Schritt, um Handlungsfähigkeit zu signalisieren und möglicherweise föderale Gelder zu sichern.
Andererseits ist der Preis für diese Zusammenarbeit hoch. Die wiederholten Drohungen Trumps, die Stadt zu „übernehmen“, schweben wie ein Damoklesschwert über ihr. Das sichtbarste Zeichen dieses Drucks war die Entscheidung der Bürgermeisterin, den Black Lives Matter Plaza entfernen zu lassen – ein starkes Symbol der Proteste nach dem Tod von George Floyd. Bowser deutete an, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die Bundesmittel nicht zu gefährden. Es ist ein ständiges Abwägen zwischen dem Schutz der hart erkämpften städtischen Autonomie und dem politischen Überleben in einer Umgebung, in der der Präsident die Regeln jederzeit ändern kann.
Das Herzstück der Autonomie: Die unsichere Zukunft der „Home Rule“
Der Kern des Konflikts dreht sich um ein juristisches und historisches Konzept: den „Home Rule Act“ von 1973. Dieses Gesetz ist das Herzstück der städtischen Seele Washingtons. Es beendete eine fast hundertjährige Ära, in der die Stadt von vom Präsidenten ernannten, nicht gewählten Funktionären regiert wurde, und gab den Einwohnern das Recht, ihren eigenen Bürgermeister und Stadtrat zu wählen. Es ist das Symbol für die demokratische Selbstbestimmung der mehrheitlich afroamerikanischen Bevölkerung der Stadt, das nach einem langen Kampf errungen wurde.
Eine vollständige Rücknahme dieses Gesetzes wäre für Trump jedoch kein Spaziergang. Der direkteste Weg führt über den Kongress, der laut Verfassung die letzte Autorität über den District hat. Doch politisch ist dies eine hohe Hürde. Die Republikaner verfügen im Senat nicht über eine filibustersichere Mehrheit, was den Demokraten die Möglichkeit gäbe, ein solches Gesetz zu blockieren. Dennoch ist die Drohung real. Es gibt bereits Gesetzesinitiativen von republikanischen Abgeordneten, die genau dies fordern. Der Kampf um die Home Rule ist somit mehr als ein juristisches Gerangel; es ist ein Kampf um die demokratische Identität der Hauptstadt.
Macht ohne Übernahme: Trumps Werkzeugkasten gegen die Stadt
Auch ohne die komplette Aufhebung der Home Rule verfügt der Präsident über einen gut gefüllten Werkzeugkasten, um seinen Willen in D.C. durchzusetzen. Diese Machtbefugnisse heben die Stadt von allen anderen Bundesstaaten ab und machen sie besonders verwundbar. So kann der Präsident beispielsweise die Nationalgarde von D.C. ohne Zustimmung der lokalen Regierung mobilisieren und einsetzen – ein Recht, das in den Bundesstaaten den Gouverneuren zusteht. Trump hat diese Macht bereits während der Proteste im Jahr 2020 genutzt, als Militärhubschrauber über der Stadt kreisten.
Noch direkter ist die im Home Rule Act selbst verankerte Notfallklausel: Sie erlaubt dem Präsidenten, unter „besonderen Notfallbedingungen“ die vorübergehende Kontrolle über die städtische Polizei zu übernehmen. Dies wäre eine beispiellose Machtausübung über eine amerikanische Großstadt, die Trump bereits 2020 angedroht hatte. Diese Instrumente ermöglichen es ihm, die städtische Autonomie zu untergraben und eine föderale Kontrolle de facto auszuüben, selbst wenn er sie de jure nicht vollständig besitzt.
Ein Chor der Reaktionen: Die gespaltene Stimme der Stadt
Die Reaktionen auf Trumps Vorgehen innerhalb der Stadt sind so vielfältig wie die Stadt selbst. Die Polizeigewerkschaft von D.C. nutzt die Gelegenheit, um mit alten politischen Gegnern im Stadtrat abzurechnen. Sie beschuldigt „radikale“ Ratsmitglieder, durch eine zu liberale Politik erst die Grundlage für Trumps Drohungen geschaffen zu haben. Trumps neu ernannte Bundesstaatsanwältin für D.C., Jeanine Pirro, gibt sich als verlängerter Arm des Präsidenten und kündigt an, „mit aller Härte gegen die Kriminalität zu kämpfen“.
Ganz anders klingen die Stimmen vieler Bürger, die in den Online-Kommentaren der Zeitungsartikel zu Wort kommen. Dort herrschen Skepsis und Kritik vor. Viele sehen in Trumps Handeln einen autoritären Machtmissbrauch und eine Missachtung demokratischer Normen und Gesetze. Sie fürchten eine politisch motivierte Machtübernahme, die wenig mit echter Sicherheit zu tun hat. Der Generalstaatsanwalt von D.C., Brian Schwalb, der für die meisten Jugendstrafsachen zuständig ist, bezeichnet den auslösenden Vorfall zwar als „entsetzlich“, betont aber auch, dass sein Büro im Rahmen der Gesetze handeln und bei ausreichenden Beweisen Anklage erheben werde.
Am Ende bleibt ein tief gespaltenes Bild. Der Kampf um Washington, D.C. wird nicht auf den Straßen mit Polizeisirenen entschieden, sondern in den Korridoren der Macht, in den Medien und in den Köpfen der Menschen. Es ist eine Auseinandersetzung darüber, wem eine Stadt gehört, wer ihre Geschichte erzählen darf und wer über ihre Zukunft bestimmt. Präsident Trump hat die Hauptstadt zu seiner persönlichen Bühne gemacht, um eine Show von Recht und Ordnung aufzuführen. Die Frage, die über den Dächern von D.C. schwebt, ist, ob es sich dabei nur um den ersten Akt eines noch viel größeren Dramas handelt.