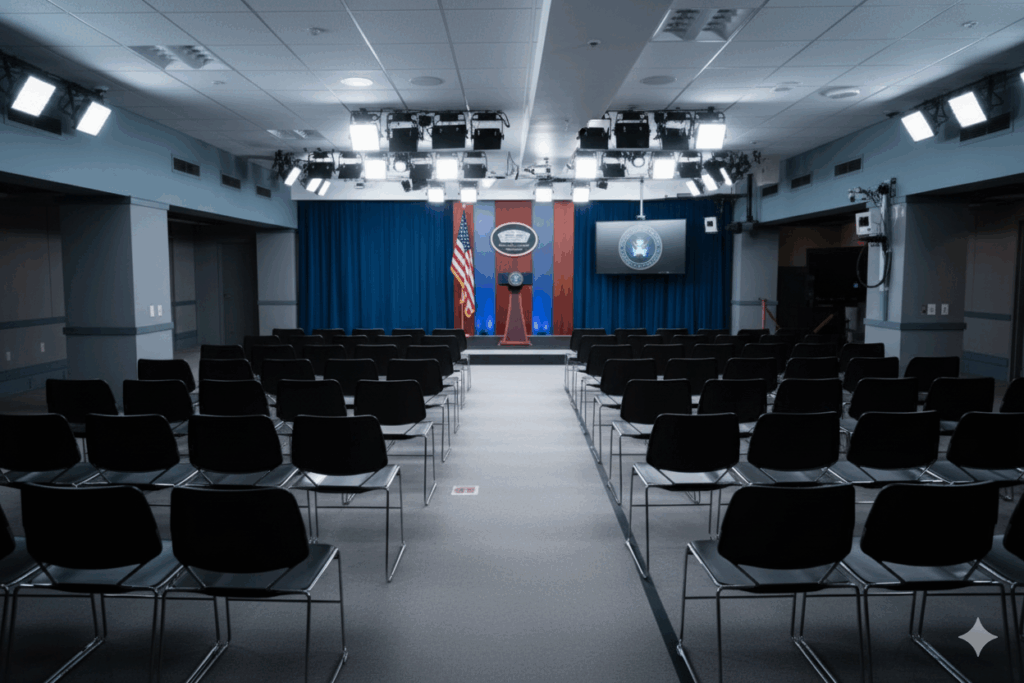Ein politischer Showdown mit weitreichenden Folgen bahnt sich im US-Senat an: In dieser Woche steht eine Abstimmung über einen von der Trump-Regierung forcierten Vorschlag an, der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die finanzielle Lebensader durchtrennen könnte. Es geht um mehr als 500 Millionen US-Dollar jährlich, die über die Corporation for Public Broadcasting (CPB) an hunderte von Fernseh- und Radiostationen im ganzen Land verteilt werden. Vordergründig als Sparmaßnahme im Bundeshaushalt deklariert, entpuppt sich der Vorstoß bei genauerer Betrachtung als ein gezielter politischer Angriff. Dessen verheerendste Konsequenzen würden jedoch nicht die prominenten nationalen Marken wie NPR oder PBS treffen, die nur zu einem geringen Teil direkt von diesen Geldern abhängen. Vielmehr droht hunderten kleinen, lokalen Sendern in den ländlichen und oft strukturschwachen Regionen Amerikas der endgültige Kollaps. Damit steht nicht weniger auf dem Spiel als die informationelle und kulturelle Grundversorgung von Millionen von Bürgern, die weit abseits der urbanen Machtzentren leben.
Die Anatomie einer gezielten Schwächung
Die existenzielle Bedrohung für die lokalen Sender resultiert direkt aus ihrer spezifischen Finanzierungsstruktur. Während die nationalen Flaggschiffe NPR und PBS ihre Einnahmen breit diversifiziert haben, sind viele kleine Stationen in hohem Maße von den Zuwendungen der CPB abhängig. In Bundesstaaten wie South Dakota oder Alaska machen diese Gelder oft mehr als die Hälfte des gesamten Budgets aus. Für einige Sender in den entlegensten Winkeln Alaskas beträgt die Abhängigkeit sogar bis zu 95 Prozent. Paula Kerger, die Chefin von PBS, bestätigt, dass für eine Station im ländlichen Kansas 54 Prozent der Mittel aus der Bundesförderung stammen, was die Lage für sie zu einer „existenziellen“ Frage macht.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die CPB agiert als eine Art Verteilerorganisation, die vom Bund bereitgestellte Mittel nach einer Formel weitergibt, die bewusst Regionen mit weniger Spendern und Sponsoren stärker berücksichtigt. Ein Stopp dieser Zahlungen, der bei einer Verabschiedung des Gesetzes bereits im Oktober wirksam würde, würde diesen Sendern schlagartig den Boden unter den Füßen wegziehen. Zwar würden auch NPR und PBS die Auswirkungen spüren, da sie indirekt von den Gebühren ihrer Mitgliedsstationen profitieren, doch ihr Überleben steht nicht infrage. Die wahre Tragödie würde sich in der Fläche abspielen: Ein interner Bericht von NPR aus dem Jahr 2011 prognostizierte, dass bei einem Wegfall der Bundesmittel bis zu 18 Prozent der rund 1.000 Mitgliedsstationen schließen müssten, vor allem im Mittleren Westen, im Süden und Westen. Bis zu 30 Prozent der Hörer könnten den Zugang zu NPR-Programmen verlieren.
Mehr als nur Nachrichten: Was auf dem Spiel steht
Die Bedeutung dieser lokalen Sender geht weit über die reine Nachrichtenvermittlung hinaus. Sie sind oft ein unverzichtbarer Teil des sozialen und kulturellen Gefüges ihrer Gemeinden. So würden mit den Sendern auch wertvolle Bildungsprogramme für Kinder verschwinden. Sendungen wie „Molly of Denali“ oder „Daniel Tiger’s Neighborhood“ dienen als Grundlage für Lernpartnerschaften mit lokalen Schulen. Paula Kerger betont, dass die Hälfte aller Kinder in den USA keine Vorschule besucht, weshalb Formate wie „Sesame Street“ ursprünglich geschaffen wurden, um diese Lücke zu füllen.
Darüber hinaus produzieren die Stationen mit den Fördergeldern Inhalte, die auf dem kommerziellen Markt keine Chance hätten. Dazu zählen aufwendige Dokumentationen über die lokale Geschichte, die Übertragung von Debatten mit regionalen Politikern oder die Berichterstattung über den High-School-Sport, wie es das Beispiel von South Dakota Public Broadcasting zeigt. Die Herstellung solcher originären lokalen Inhalte ist deutlich kostspieliger als der Einkauf von nationalen Programmen. In vielen ländlichen Regionen ohne flächendeckenden Breitbandzugang sind die Rundfunksender zudem ein essenzieller Bestandteil des nationalen Notfallwarnsystems. All diese Dienstleistungen, die von Befürwortern als lebenswichtig beschrieben werden, stünden bei einem Finanzierungsstopp vor dem Aus.
Ein ideologischer Kampf mit parteiinternen Rissen
Die Argumente der Befürworter der Mittelstreichung sind primär ideologischer Natur. Kritiker werfen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit langem eine linksliberale Voreingenommenheit vor, die nicht mit Steuergeldern unterstützt werden dürfe. Ein ehemaliger NPR-Redakteur untermauerte diese Kritik mit dem Vorwurf, die Journalisten des Senders hätten sich einer „progressiven Weltanschauung“ verschrieben. Republikanische Abgeordnete wie Marjorie Taylor Greene argumentieren zudem, dass die flächendeckende Verbreitung des Internets die Nachrichtenversorgung durch ländliche Sender zunehmend überflüssig mache. Andere Kritiker stören sich an Inhalten, die sich ihrer Meinung nach zu stark auf Themen wie Rasse und Geschlecht konzentrieren.
Dieser ideologische Feldzug wird von Präsident Trump persönlich mit Nachdruck vorangetrieben. Er hat republikanischen Abgeordneten, die sich den Kürzungen widersetzen, offen mit dem Entzug seiner Unterstützung gedroht. Trotz dieses Drucks zeigen sich Risse in der republikanischen Front im Senat. Diese parteiinternen Spannungen beschränken sich dabei nicht nur auf die Medienpolitik, denn der Kürzungsantrag ist weitreichender, als es die Debatte um NPR und PBS vermuten lässt. Das gesamte Paket zielt auf die Streichung von über 9 Milliarden US-Dollar ab und nimmt neben dem Rundfunk auch massiv Programme der Auslandshilfe ins Visier. So sollen auch Mittel für das von Präsident George W. Bush ins Leben gerufene HIV/AIDS-Hilfsprogramm PEPFAR gestrichen werden – ein Programm, dem das Außenministerium die Rettung von 26 Millionen Menschenleben seit 2003 zuschreibt. Führende Republikaner wie Senatorin Susan Collins kritisierten diese spezifische Kürzung als „außerordentlich unklug und kurzsichtig“. Weitere geplante Einschnitte betreffen die Flüchtlingshilfe, Demokratieförderung und Gelder für die Vereinten Nationen. Die Regierung selbst bezeichnete einige dieser Ausgaben als „geradezu komisch verschwenderisch“. Dieser breitere Kontext zeigt, dass die Medien nur ein Ziel in einer größeren Kampagne sind und erklärt die Bedenken von Senatoren, deren Heimatstaaten von den verschiedenen Kürzungen besonders betroffen wären.
Ein Abwehrkampf an allen Fronten
Angesichts dieser existenziellen Bedrohung haben die öffentlich-rechtlichen Anstalten einen umfassenden und vielschichtigen Abwehrkampf organisiert. Paula Kerger beschreibt die Situation als Angriff von „allen Seiten“, der weit über den aktuellen Kürzungsantrag hinausgeht und auch Anfragen der Kommunikationsbehörde FCC, die Streichung anderer Fördertöpfe und eine präsidiale Anordnung umfasst, die jegliche Bundeszahlungen an PBS und NPR für illegal erklärt.
Die Verteidigungsstrategie ist entsprechend breit angelegt. Ein zentrales Element ist das direkte Lobbying durch die Leiter der lokalen Stationen. Diese gelten in Washington oft als weniger parteiisch als die nationalen Führungsebenen und haben häufig persönliche Beziehungen zu ihren Abgeordneten. So suchte der Chef von Alaska Public Media das Gespräch mit Senatorin Murkowski an einem Pasta-Stand auf einem Wochenmarkt, während seine Kollegin aus South Dakota ihren Senator im State Capitol traf. Parallel dazu laufen landesweite öffentliche Kampagnen. Berühmtheiten wie der Filmemacher Ken Burns und Pop-ups auf den Websites von NPR und PBS rufen die Bevölkerung dazu auf, ihre Senatoren zu kontaktieren. Als letztes Mittel hat PBS die Regierung sogar verklagt, um sich gegen die präsidiale Anordnung zur Wehr zu setzen – ein Schritt, der laut Kerger ein „sehr trauriger Tag“ war, aber als alternativlos erachtet wurde.
Die Dringlichkeit und die Schärfe der Auseinandersetzung werden durch das genutzte Gesetzesinstrument zusätzlich befeuert. Das angewandte „Rescission“-Verfahren stammt aus dem „Impoundment Control Act“ von 1974. Es erlaubt der Regierung, bereits vom Kongress bewilligte Gelder vorübergehend einzubehalten, setzt aber eine strikte Frist – im vorliegenden Fall Freitag um Mitternacht –, bis zu der der Kongress den Kürzungen zustimmen muss. Geschieht dies nicht, müssen die Mittel freigegeben werden. Dieser Mechanismus ist politisch brisant, da er dem Senat ermöglicht, die Kürzungen mit einer einfachen Mehrheit zu verabschieden und so einen wahrscheinlichen Filibuster der Demokraten zu umgehen, für den 60 Stimmen nötig wären. Es wäre das erste Mal seit der Clinton-Regierung, dass ein vom Präsidenten beantragtes Rescission-Paket erfolgreich ist. Ein früherer Versuch der Trump-Regierung scheiterte bereits 2018 am Widerstand zweier republikanischer Senatoren.
Sollte der Vorstoß der Regierung erfolgreich sein, sind die Alternativen für die betroffenen Sender rar. Zwar gibt es Überlegungen zu philanthropischen Rettungsaktionen, ähnlich wie bei Lokalzeitungen. Doch die Hürden sind immens. Zum einen stehen finanzstarke Investoren bereit, die weniger am Programm als an den wertvollen Sendelizenzen für zukünftige Frequenzauktionen interessiert sind. Zum anderen wäre der finanzielle Bedarf gigantisch: Experten schätzen, dass ein Stiftungsvermögen von rund 20 Milliarden US-Dollar nötig wäre, um eine nachhaltige journalistische Versorgung in den USA zu sichern. Die Schließung der lokalen Sender würde Informationswüsten schaffen, die kurzfristig wohl nicht wiederbelebt werden könnten. Einmal verlorene Sendelizenzen sind, anders als eine eingestellte Zeitung, für immer verloren. Die Abstimmung in dieser Woche entscheidet also nicht nur über einen Posten im Bundesbudget. Sie entscheidet darüber, ob in weiten Teilen Amerikas bald die Lichter ausgehen – und damit auch die lokalen Stimmen für immer verstummen.