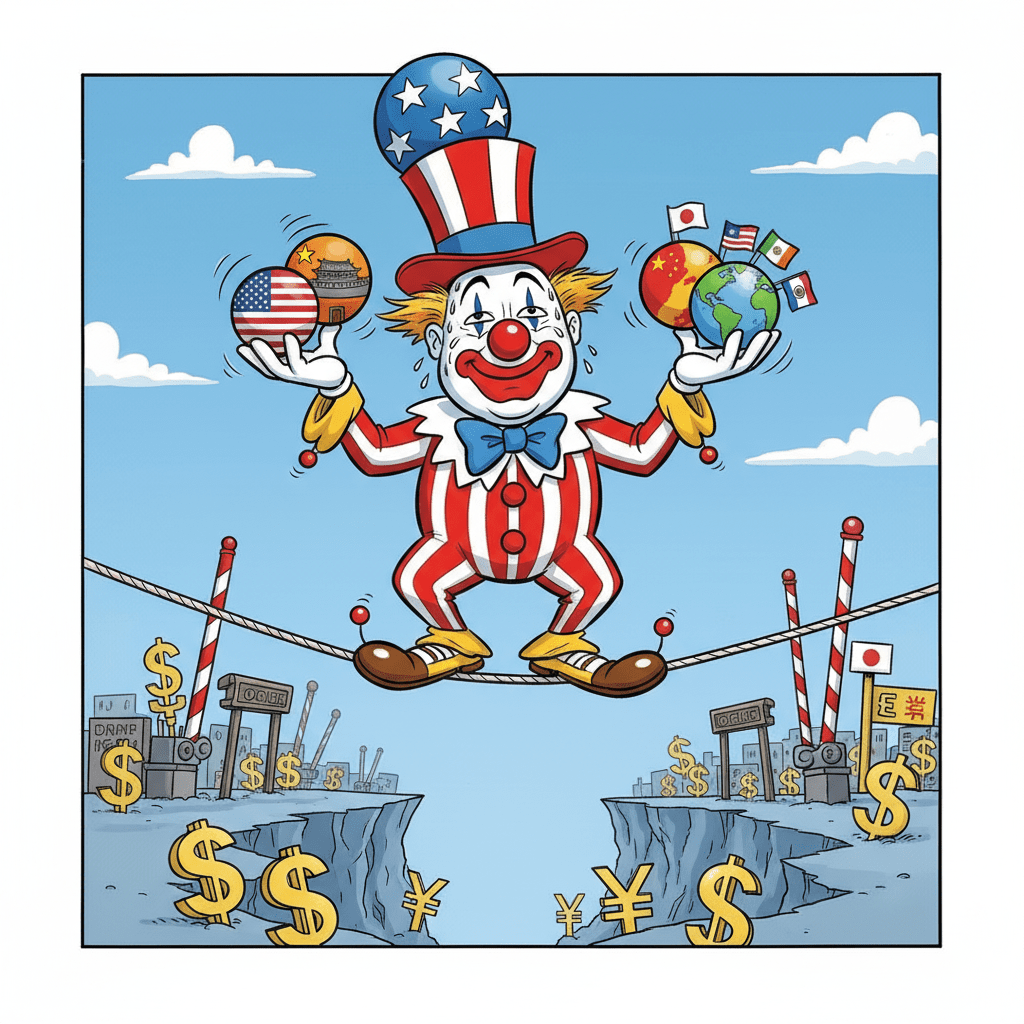Der Lärm der Artillerie an der festgefahrenen Front mag leiser geworden sein, doch der Krieg in der Ukraine ist keineswegs erstarrt. Er hat lediglich die Arena gewechselt. Aus dem blutigen Patt in den Schützengräben ist ein strategischer, kühler Krieg der Kilowattstunden, Pipelines und Sanktionslisten geworden. Diese neue Phase des Konflikts wird an drei Fronten gleichzeitig geführt: mit ukrainischen Drohnen, die tief ins russische Hinterland vorstoßen, um das Herz der Ölwirtschaft zu treffen; mit massiven neuen US-Sanktionen, die erstmals direkt auf die Giganten Rosneft und Lukoil zielen; und mit Russlands Vergeltungsschlägen gegen die ukrainische Strom- und Gasinfrastruktur.
Doch dieser eskalierende Energiekrieg ist nur die eine Hälfte der Geschichte. Parallel dazu führt der Kreml einen zweiten, stilleren Krieg – nach innen. Es ist eine Schlacht gegen die eigene Zivilwirtschaft, die durch eine drakonische Zinspolitik gezielt abgewürgt wird, um Ressourcen für die Rüstung freizuschaufeln. Und es ist ein Krieg gegen jede Form von abweichender Meinung, in dem Bürger für absurdeste Anlässe zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt und in Gefängnissen systematisch zermürbt werden.
Die russische Wirtschaft steht nicht vor einem plötzlichen Kollaps. Was wir erleben, ist etwas Komplexeres: eine schmerzhafte, staatlich erzwungene Metamorphose. Es ist die rücksichtslose Transformation eines Landes in eine reine Kriegswirtschaft, die ihre zivilen Sektoren und ihre Bürgerrechte bewusst opfert. Die entscheidende Frage ist, wessen Infrastruktur und wessen Gesellschaft diesem Zermürbungstest länger standhalten wird.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der neue Schlagabtausch: Ein Krieg der Kilowattstunden und Barrels
Nachdem monatelange diplomatische Vorstöße der Trump-Regierung gescheitert sind und die Frontlinie sich kaum bewegt, ist der Energiekrieg zum primären strategischen Hebel geworden. Die Ukraine, frustriert über westliche Bedenken und Beschränkungen, setzt auf eigene Waffensysteme, um den Krieg dorthin zu tragen, wo er finanziert wird. Kiew nennt seine Drohnenangriffe auf Dutzende russische Raffinerien „Langstrecken-Sanktionen“. Ihre Wirksamkeit ist verblüffend: Sie zielen nicht primär auf die Staatseinnahmen – der Rohölexport läuft weiter –, sondern auf den Alltag der russischen Bevölkerung.
Die Angriffe haben bereits bis zu einem Drittel der russischen Raffinerie-Kapazitäten lahmgelegt und akute Benzinknappheit in mehreren Regionen ausgelöst. Auf der Krim wurden Abgaben rationiert, Tankstellen schließen. Die Attacken sind chirurgisch präzise, denn Raffinerien sind hochempfindlich, voller brennbarer Flüssigkeiten und, anders als Militäranlagen, kaum durch Luftabwehr geschützt. Die Reparatur wird durch Sanktionen, die den Import westlicher Ersatzteile blockieren, massiv erschwert.
Russlands Antwort ist brutal und zielt auf die Lebensfähigkeit der Ukraine selbst. Mit dem Winter vor der Tür hat Moskau seine Angriffe auf das ukrainische Energiesystem ausgeweitet und zielt nun verstärkt auf die Gas-Infrastruktur. Dies bedroht die Heizsysteme des Landes. Schätzungen zufolge sind bereits 60 Prozent der Gasproduktionskapazität und wichtige Kompressorstationen ausgefallen. In Kiew und anderen Städten wird der Beginn der Heizsaison hinausgezögert, während das Land verzweifelt versucht, Gasimporte zu finanzieren. Es ist ein direkter Angriff auf die Zivilbevölkerung, der sie in Kälte und Dunkelheit stürzen soll.
Amerikas später Hammer: Der Angriff auf Russlands ökonomische Lunge
In diese volatile Lage platzt die Ankündigung der US-Regierung, die beiden größten russischen Ölkonzerne, Rosneft und Lukoil, mit umfassenden Sanktionen zu belegen. Nach Monaten der Drohungen und gescheiterter Gipfeltreffen ist dies ein drastischer Schritt. Analysten sehen darin eine direkte Reaktion auf Russlands Zerstörung der ukrainischen Energie-Infrastruktur.
Das Ziel ist, die „Kriegsmaschine“ an ihrer empfindlichsten Stelle zu treffen: dem Geld. Rosneft und Lukoil stehen für etwa die Hälfte der gesamten russischen Ölproduktion. Die Sanktionen schneiden sie vom globalen Finanzsystem ab und drohen jedem mit Strafen, der weiterhin russisches Öl kauft. Die Hoffnung ist, dass dies kritische Abnehmer wie Indien abschrecken könnte. Wladimir Putin wies die Sanktionen als „unfreundlichen Akt“ zurück, der seine Kriegsziele nicht ändern werde. Die Skepsis ist berechtigt. Russland hat eine beeindruckende Fähigkeit bewiesen, frühere Sanktionsrunden durch den Handel mit China und Indien sowie die Nutzung von „Schattenflotten“ und Schlupflöchern zu umgehen. Dennoch ist der Druck unverkennbar. Die Energieeinnahmen sind bereits von 1,25 Milliarden Euro pro Tag im Frühling 2022 auf rund 600 Millionen Euro pro Tag gesunken. Putin selbst räumte ein, dass die Sanktionen die Wirtschaft „verletzen“ werden.
Die innere Front: Wie der Kreml seine eigene Wirtschaft stranguliert
Es ist ein Paradoxon: Während die Schornsteine der Rüstungsbetriebe rauchen, bricht die zivile Wirtschaft darunter zusammen. Das Trugbild eines Wachstums von über vier Prozent im Jahr 2023 ist verflogen. Die Prognosen für 2025 wurden vom IWF auf magere 0,6 Prozent korrigiert.
Der wahre Feind der russischen Zivilindustrie sitzt jedoch nicht in Washington, sondern in Moskau. Die russische Zentralbank selbst dreht der zivilen Industrie den Hahn ab. Mit einem Leitzins von 17 Prozent bekämpft sie nicht nur die Inflation, sondern erwürgt gezielt die Binnennachfrage.
Die Folgen sind dramatisch. Der Automarkt ist kollabiert. Die Verkäufe brachen bis Juli um 24 Prozent ein, während Hersteller und Händler auf bis zu 500.000 unverkauften Fahrzeugen sitzen. Bei Lada, dem Flaggschiff Awtowas, wurde eine Viertagewoche eingeführt – nicht als Maßnahme der Work-Life-Balance, sondern um die gigantischen Lagerbestände abzubauen. Auch die Konzerne Gas und Kamas mussten die Arbeitszeit drosseln. Für die Bevölkerung sind Autokredite bei Zinsen von 17 Prozent unerschwinglich geworden.
Gleichzeitig steckt die Schwerindustrie in der Krise. Obwohl der Rüstungssektor Stahl benötigt, sind die Kleinserien für Panzer und Raketen kein Ersatz für die Massenproduktion im zivilen Sektor. Der Wohnungsbau, traditionell ein Hauptabnehmer, ist ebenfalls eingebrochen. Die Stahlnachfrage im Inland fiel um bis zu 15 Prozent. Westliche Märkte sind durch Sanktionen weggebrochen. Der Chef des Sewerstal-Konzerns warnte, ohne Finanzierung würden Industriekonglomerate zu „einem Haufen rostenden Metalls“. Selbst der einst profitable Bergbau blutet aus: 23 Kohleminen sind bereits bankrott, 53 weitere in Schwierigkeiten, und die Branche häufte Milliardenverluste an.
Analysten wie Janis Kluge sehen darin keinen Unfall, sondern Kalkül. Es sei der „Transformationsschmerz“ hin zu einer reinen Kriegswirtschaft. Die Zentralbank kühlt die „überhitzte“ Wirtschaft gezielt ab. Zivile Firmen, die mit den Waffenschmieden um die knappen Arbeitskräfte wetteifern, sollen bewusst aus dem Markt gedrängt werden, um Ressourcen für den Krieg freizusetzen.
Ein Staat am Limit: Defizite, Steuererhöhungen und die nackte Angst
Diese Transformation hat ihren Preis, und der Staatshaushalt zeigt die Risse. Das Versprechen von 2023, es werde keine Steuererhöhungen geben, ist Makulatur. Um das wachsende Loch im Haushalt zu stopfen – das Defizit war bereits im Sommer 2025 dreimal so hoch wie für das ganze Jahr geplant – greift der Kreml den Bürgern in die Tasche. Die Mehrwertsteuer wird von 20 auf 22 Prozent angehoben. Die „Flat Tax“ wurde durch ein progressives Steuersystem ersetzt. Die Körperschaftsteuer und eine neue Abgabe auf Internetwerbung wurden ebenfalls erhöht. Selbst putintreue Abgeordnete warnen, man schieße sich „selbst ins Bein“.
Das Regime ist nicht mehr in seiner „Komfortzone“. Es versucht, den Krieg zu finanzieren, die Sozialausgaben hoch zu halten und sinkende Einnahmen zu kompensieren – ein Spagat, der zunehmend misslingt. Die Haushaltsplanung, die für 2026 eine reale Senkung der Verteidigungsausgaben vorsieht, während der Krieg weiterläuft, wird als „nicht realistisch“ bezeichnet.
Um diese schmerzhafte Operation abzusichern, braucht der Kreml eine zweite Front: eine innere. Es ist ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung, geführt mit Paragrafen, die „Falschmeldungen“ oder die „Rechtfertigung von Terrorismus“ unter Strafe stellen. Die Geschichten dieser neuen politischen Gefangenen, von denen über 1000 seit 2022 inhaftiert wurden, lesen sich wie ein Handbuch der absurden Grausamkeit. Es sind keine prominenten Gegner; es sind gewöhnliche Bürger, die als Exempel statuiert werden. Da ist der Kommunalpolitiker Alexej Gorinow, der sieben Jahre erhielt, weil er den Krieg als Verbrechen bezeichnete. In Haft wurden ihm drei weitere Jahre hinzugefügt, weil er im Gefängniskrankenhaus mit Mitgefangenen über die Nachrichten sprach. Oder der 15-jährige Arsenij Turbin, der zu fünf Jahren verurteilt wurde, angeblich weil er online ein Formular zum Beitritt einer pro-ukrainischen Legion ausgefüllt haben soll – ein Teenager, der in der Zelle geschlagen wurde und 17 Kilo abnahm. Die 68-jährige Kinderärztin Nadeschda Bujanowa erhielt fünfeinhalb Jahre Lagerhaft. Ihr angebliches Verbrechen: Sie soll einer Kriegerwitwe gesagt haben, deren Mann sei ein „legitimes Ziel“ gewesen – eine Aussage, die sie bestreitet.
Selbst Kunst wird zum Verbrechen: Die Dramatikerin Schenja Berkowitsch und die Autorin Swetlana Petrijtschuk erhielten sechs Jahre Haft. Der offizielle Grund: ihr Theaterstück „Finist – heller Falke“ aus dem Jahr 2020. Der wahre Grund, so wird vermutet: Berkowitschs regimekritische Antikriegsgedichte. Die Schicksale des 66-jährigen, krebskranken Rentners Igor Baryschnikow und des schwerkranken Saxofonisten Andrej Schabanow zeigen die gezielte Grausamkeit des Systems. Baryschnikow erhielt siebeneinhalb Jahre für kritische Facebook-Posts über Butscha und Mariupol; eine notwendige Operation wurde ihm verweigert, und die Teilnahme an der Beerdigung seiner Mutter wurde ihm untersagt. Schabanow wurde wegen historischer Facebook-Posts zu sechs Jahren verurteilt. Im Gerichtssaal rief er: „Ich verrotte bei lebendem Leib! Man bringt mich um!“. Die notwendigen Medikamente werden ihm verweigert. Das Muster ist klar: Die Verweigerung medizinischer Hilfe ist ein systematisches Werkzeug der Zermürbung. Der Staat bestraft nicht nur den Protest, sondern die bloße Existenz von Menschen, die sich weigern, im Gleichschritt zu marschieren.
Ein Zermürbungskrieg auf allen Ebenen
Der Krieg ist in eine neue, entscheidende Phase getreten. Die Pattsituation auf dem Schlachtfeld ist einem dynamischen Zermürbungskrieg gewichen. Der Kreml hat den Einsatz verdoppelt, indem er seine Wirtschaft militarisiert und seine Gesellschaft brutal diszipliniert. Analysten der finnischen Zentralbank und auch Janis Kluge sind sich einig: Russland steht zwar vor „schwierigen Entscheidungen“, aber das Geld geht dem Kreml nicht aus. Es gibt immer noch Spielraum, mehr Ressourcen aus dem zivilen Bereich in den Militärsektor zu verschieben. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Die Frage ist, was zuerst bricht: die Fähigkeit der Ukraine, einen Winter ohne Strom und Gas zu überstehen, oder die Fähigkeit der russischen Gesellschaft, die stille Enteignung ihres Wohlstands und ihrer Freiheit zu ertragen, während ihre wirtschaftlichen Lebensadern von außen unter Beschuss geraten.