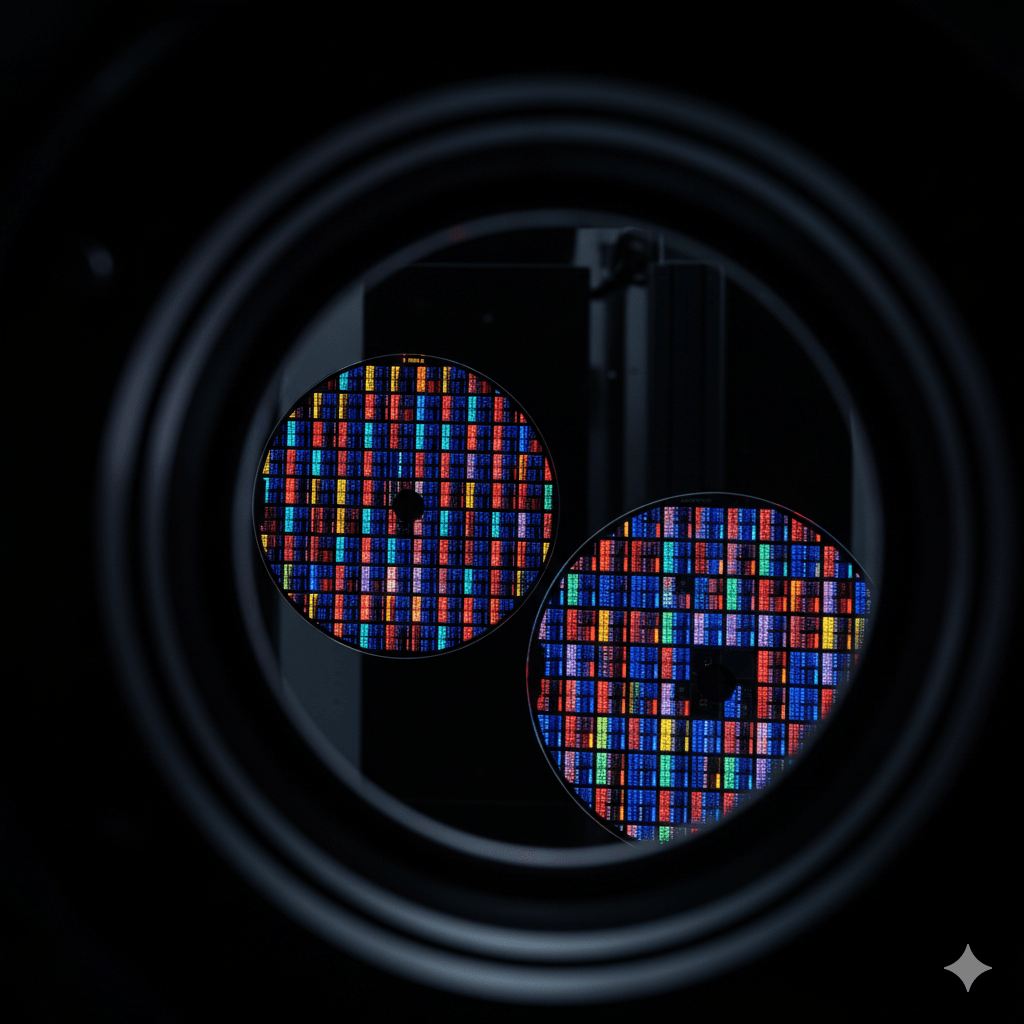Der Panamakanal, seit jeher eine Lebensader des Welthandels, ist erneut zum Schauplatz geopolitischer Spannungen geworden. Ausgelöst durch die Rhetorik und Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der offen mit der Rückeroberung der Wasserstraße liebäugelt, befindet sich Panama in einem heiklen Balanceakt: Es muss seine Souveränität verteidigen, die historischen Verflechtungen mit den USA navigieren und dem wachsenden wirtschaftlichen Engagement Chinas begegnen. Die Situation ist aufgeladen, die diplomatischen Signale widersprüchlich – und die Zukunft des Kanals ungewisser denn je.
Historische Lasten und neue Begehrlichkeiten
Die Beziehung zwischen den USA und Panama ist untrennbar mit dem Kanal verbunden, dessen Bau Anfang des 20. Jahrhunderts unter US-Regie erfolgte. Über Jahrzehnte kontrollierten die Vereinigten Staaten nicht nur die Wasserstraße selbst, sondern auch die umliegende Kanalzone – eine quasi-koloniale Enklave mit eigenen Gesetzen, segregierten Lebensbereichen und massiver Militärpräsenz. Diese Ära, geprägt von amerikanischer Dominanz, aber auch von wachsendem panamaischem Widerstand, endete formell erst mit der Übergabe des Kanals an Panama zum Jahreswechsel 1999. Die von Präsident Jimmy Carter ausgehandelten Verträge von 1977, die diesen Schritt ermöglichten, werden von Trump heute als „närrisches Geschenk“ und „großer Fehler“ gegeißelt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die US-Militärpräsenz hinterliess tiefe Spuren: Neben zahlreichen Stützpunkten diente die Zone als Trainingszentrum für lateinamerikanische Militärs – teils in Methoden wie Folter und Aufstandsbekämpfung (berüchtigt als „Mörderschule“), als Horchposten für den gesamten Kontinent und sogar als Koordinationszentrum für Operationen wie „Condor“ zur Verfolgung Oppositioneller. Auch wurden hier Chemiewaffen getestet, deren Altlasten bis heute Probleme bereiten. Diese Vergangenheit schwingt mit, wenn heute über Souveränität und Sicherheit gestritten wird. Trumps Forderung nach einer Rückkehr zur US-Kontrolle knüpft an eine imperiale Sichtweise an, die viele in Lateinamerika überwunden glaubten.
China-Phobie und wirtschaftliche Realitäten
Ein Kernargument der Trump-Administration für ihre harte Haltung ist der vermeintlich zu große Einfluss Chinas am Kanal. Trump behauptet gar fälschlicherweise, China betreibe den Kanal. Fakt ist jedoch, dass die unabhängige Panama Canal Authority (ACP) den Kanal verwaltet und betreibt. Chinesische Unternehmen, allen voran CK Hutchison aus Hongkong, betreiben (oder betrieben bis vor Kurzem) zwar wichtige Container-Terminals an beiden Enden des Kanals, doch dies bedeutet keine Kontrolle über die Wasserstraße selbst, wie Experten und panamaische Offizielle betonen. Die Sorge vor chinesischer Spionage oder der Möglichkeit einer Blockade durch die Hafenbetreiber wird von einigen US-Politikern geäußert, aber von Fachleuten als übertrieben dargestellt.
Die wirtschaftlichen Interessen sind vielschichtig. Die USA, deren Schifffahrt der größte Nutzer des Kanals ist, pochen auf günstige Konditionen und beklagen angeblich unfaire, gestiegene Gebühren. Die Kanalbehörde kontert, dass die Gebühren transparent, nicht-diskriminierend und für alle Nutzer gestiegen seien, unter anderem wegen Dürreperioden und Investitionen. China wiederum sieht Panama als wichtigen Teil seiner globalen Infrastrukturinitiative „Belt and Road“ und möchte seine Handelswege sichern. Panama selbst ist auf die Einnahmen aus dem Kanal angewiesen und versucht, Investitionen anzuziehen, ohne seine Souveränität zu kompromittieren. Der jüngste Verkauf der Hafenbeteiligungen von CK Hutchison an ein Konsortium unter Führung des US-Finanzinvestors BlackRock wird von Beobachtern als direkte Folge des US-Drucks gewertet – eine „elegante Lösung“, die Trump einen Sieg reklamieren lässt. Pikant: China reagierte auf den Deal verärgert und warf CK Hutchison vor, nationale Interessen zu verraten, was wiederum Fragen nach der Autonomie Hongkongs aufwirft.
Diplomatisches Tauziehen und widersprüchliche Signale
Panamas Regierung unter Präsident José Raúl Mulino reagiert auf die US-Forderungen mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Pragmatismus. Sie betont die Souveränität über den Kanal als unverhandelbar und weist Trumps Behauptungen zurück. Gleichzeitig zeigt man sich gesprächsbereit und kooperiert in anderen Bereichen wie der Migrationskontrolle. Jüngste Verhandlungen und Vereinbarungen sind jedoch von widersprüchlichen Darstellungen geprägt. So verkündete das US-Aussenministerium eine Einigung über Gebührenfreiheit für US-Regierungsschiffe, was die panamaische Kanalbehörde und Präsident Mulino umgehend und scharf dementierten. Panama sei zwar zu Gesprächen über Kompensationen bereit, Gebühren würden aber von der unabhängigen Behörde festgelegt. Ähnliche Unklarheiten gab es bezüglich der Stationierung von US-Truppen: Während der US-Verteidigungsminister die Möglichkeit ins Spiel brachte, Stützpunkte „wiederzubeleben“, betonte Panama, man habe lediglich zeitlich befristeten Übungen und Ausbildungen zugestimmt.
Der Konflikt um den Panamakanal ist somit weit mehr als nur ein bilaterales Problem. Er spiegelt das Ringen um Einfluss im 21. Jahrhundert wider, in dem historische Ansprüche auf neue geopolitische Realitäten treffen. Trumps Politik, getrieben von einer Mischung aus nationalistischer Nostalgie, wirtschaftlichen Interessen und einer Fixierung auf China, setzt Panama unter Druck und stellt die auf Verträgen basierende Ordnung in Frage. Während Panama versucht, seine Souveränität zu wahren und wirtschaftlich zu profitieren, nutzen die USA und China die strategische Wasserstraße als Spielfeld ihrer Rivalität. Der Ausgang dieses Ringens ist offen – doch klar ist, dass der Panamakanal seine symbolische und strategische Bedeutung so schnell nicht verlieren wird.