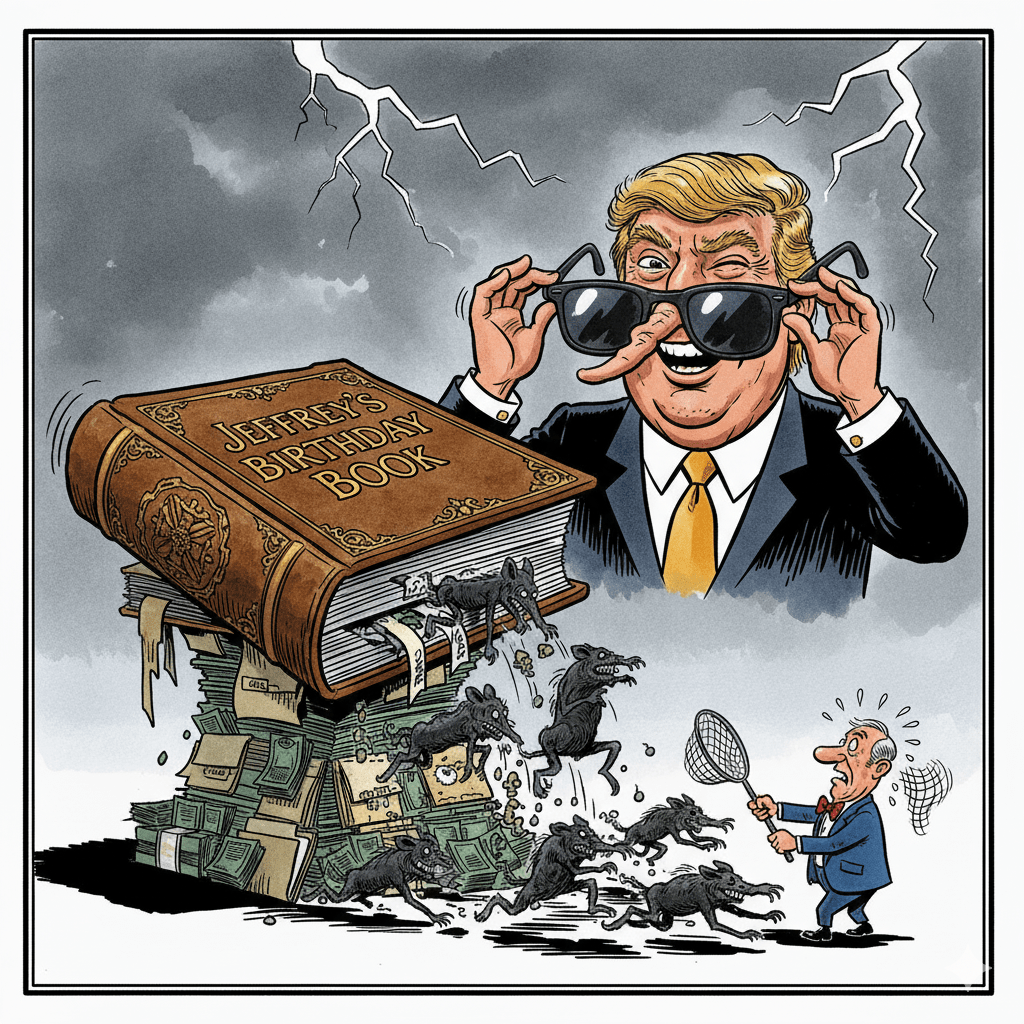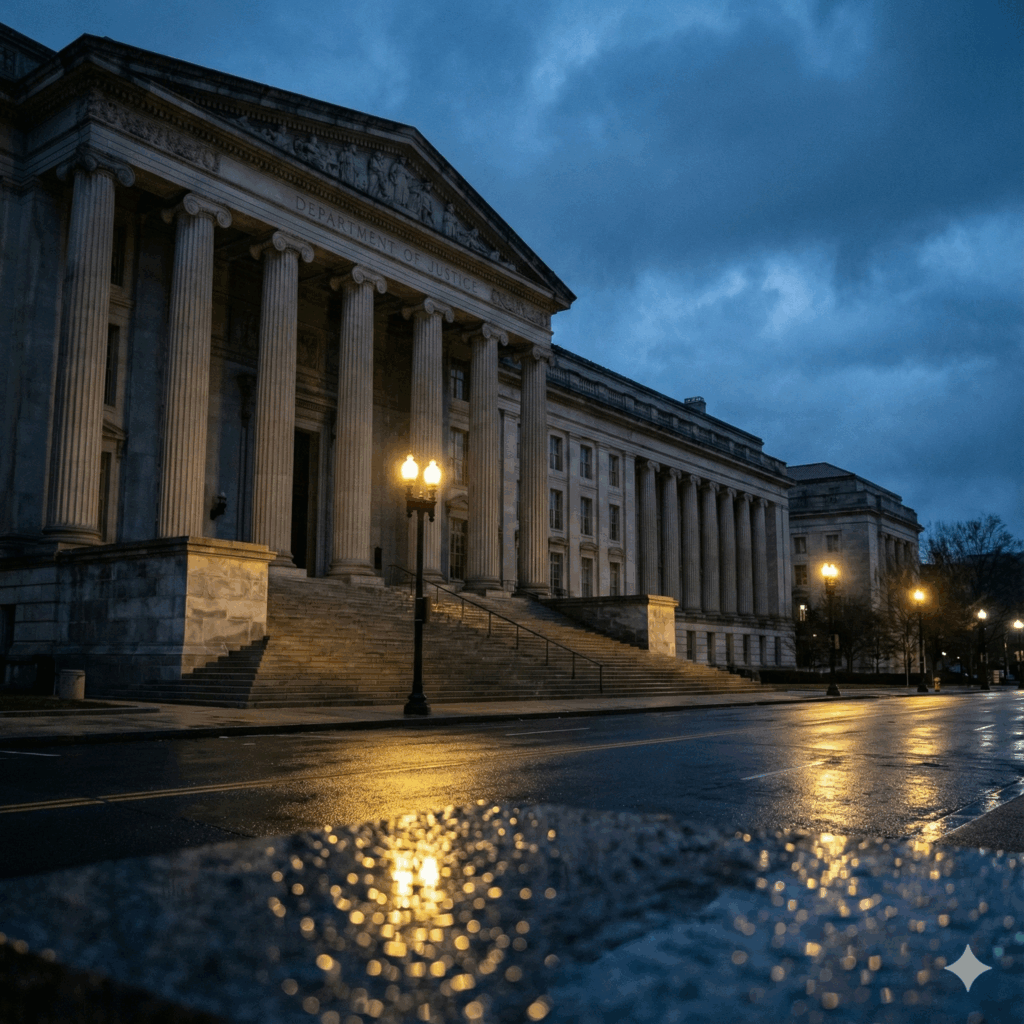Ein Funke genügt, um ein Pulverfass zur Explosion zu bringen. In Los Angeles ist dieser Funke eine Serie von aggressiven Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die eine Metropole in Aufruhr versetzen. Doch die eigentliche Explosion ist politischer Natur und zündet direkt im Weißen Haus. Mit der Anordnung, 2.000 Soldaten der Nationalgarde gegen den erklärten Willen des kalifornischen Gouverneurs zu mobilisieren, hat Präsident Donald Trump eine neue, gefährliche Stufe der Konfrontation gezündet.
Was sich in den Straßen von Paramount und Downtown L.A. abspielt – chaotische Szenen mit Tränengas, brennenden Autowracks und einem erbitterten Kampf der Narrative –, ist weit mehr als nur ein lokaler Polizeieinsatz. Es ist die sichtbare Manifestation eines fundamentalen Konflikts, den die Trump-Administration gezielt sucht: die Konfrontation mit den sogenannten „Sanctuary States“ und die ultimative Machtprobe über die Grenzen föderaler Autorität. Die Entscheidung, eine bundesstaatliche Garde zu föderalisieren, um sie im eigenen Land gegen den Willen der gewählten Führung einzusetzen, ist kein Akt der Deeskalation. Es ist eine bewusste politische Provokation, die das juristische und gesellschaftliche Gefüge der Vereinigten Staaten bis ins Mark erschüttert und die Frage aufwirft, wie weit ein Präsident gehen kann, um seinen Willen durchzusetzen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Ein präsidialer Alleingang mit Sprengkraft
Normalerweise ist der Einsatz der Nationalgarde eines Bundesstaates eine klare Angelegenheit: Der Gouverneur fordert sie an, der Gouverneur befehligt sie. Doch die Trump-Administration hat diesen etablierten Prozess gezielt umgangen. Als rechtliche Grundlage für diesen außergewöhnlichen Schritt beruft sich das Weiße Haus auf eine spezifische Klausel im US-Gesetzbuch, Titel 10, Paragraf 12406. Diese erlaubt dem Präsidenten die Föderalisierung der Garde unter bestimmten Umständen, etwa bei einer „Rebellion oder der Gefahr einer Rebellion gegen die Autorität der Regierung der Vereinigten Staaten“. Das von Trump unterzeichnete Memo konstruiert genau diesen Fall, indem es argumentiert, dass Proteste, die die Durchführung von Bundesgesetzen – in diesem Fall ICE-Operationen – behindern, eine solche Rebellion darstellen.
Juristische Experten und Kritiker sehen darin eine brandgefährliche Auslegung. Erwin Chemerinsky, Dekan der juristischen Fakultät der UC Berkeley, bezeichnete den Vorgang als „wahrhaft erschreckend“ und als den Versuch, das Militär zur Unterdrückung von Dissens im Inland zu nutzen. Die vage Formulierung des Gesetzes wird hier bis zum Äußersten gedehnt, um einen präsidialen Alleingang zu legitimieren. Historiker verweisen darauf, dass ein solcher Schritt, eine staatliche Garde ohne Anforderung des Gouverneurs zu aktivieren, extrem selten ist und zuletzt 1965 während der Bürgerrechtsbewegung erfolgte, als Präsident Lyndon B. Johnson Truppen zum Schutz von Demonstranten nach Alabama entsandte. Der entscheidende Unterschied: Damals ging es um den Schutz von Bürgerrechten, heute um die Durchsetzung einer umstrittenen Einwanderungspolitik gegen den Widerstand lokaler Behörden. Die Administration verzichtete bewusst auf die Anwendung des noch bekannteren „Insurrection Act“, den Trump während der George-Floyd-Proteste 2020 noch angedroht hatte, der aber mit einem noch größeren politischen Stigma behaftet ist.
Das Duell der Narrative: „Gesetzlosigkeit“ gegen „geplante Provokation“
Die Begründungen für den Einsatz könnten unterschiedlicher nicht sein und offenbaren einen unüberbrückbaren Graben zwischen Washington und Kalifornien. Die Trump-Administration zeichnet das Bild einer Stadt am Rande des Zusammenbruchs. Regierungsvertreter wie der Heimatschutz-Berater Stephen Miller und der Grenzschutz-Beauftragte Tom Homan sprechen von „gewalttätigen Mobs“, die Bundesbeamte angreifen, einer „Invasion illegaler Krimineller“ und Zuständen, die einer „Insurrektion“ glichen. Die Entsendung der Garde sei notwendig, um die „Gesetzlosigkeit, die man hat schwären lassen“, zu beenden und die Durchführung von Bundesrecht zu gewährleisten. In dieser Lesart sind die lokalen demokratischen Politiker schuld, da sie durch ihre „Sanctuary“-Politik die Autorität des Bundes untergraben und gewalttätige Agitatoren ermutigen würden.
Die kalifornische Seite kontert mit scharfer Kritik und wirft dem Weißen Haus vor, bewusst einen Konflikt zu inszenieren. Gouverneur Gavin Newsom verurteilte den Schritt als „absichtlich provokativ“ mit dem alleinigen Ziel, die Spannungen weiter zu eskalieren. Er und andere lokale Führer wie die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, betonten wiederholt, dass die lokalen Polizeikräfte die Lage im Griff hätten und keine Bundeshilfe notwendig oder erwünscht sei. Newsom formulierte es unmissverständlich: Die Bundesregierung mobilisiere die Garde nicht, weil es an Einsatzkräften mangele, sondern „weil sie ein Spektakel will“. Diese Aktion sei die „falsche Mission“ für die Garde und werde das Vertrauen der Öffentlichkeit nachhaltig untergraben.
Die neue Front: Razzien am Arbeitsplatz als strategische Waffe
Die Unruhen sind kein Zufall, sondern die direkte Folge einer strategischen Neuausrichtung in Trumps Einwanderungspolitik. Die Quellen beschreiben die großangelegten Razzien an Arbeitsplätzen in Los Angeles und anderen Landesteilen als eine „neue Phase“ des Vorgehens gegen illegale Einwanderung. Anstatt sich primär auf Kriminelle oder Grenzgänger zu konzentrieren, zielt die Administration nun direkt auf den Arbeitsmarkt – den Hauptanziehungspunkt für Migranten ohne Papiere. Das erklärte Ziel ist eine massive Steigerung der Verhaftungszahlen. Tom Homan kündigte an, man werde die Kontrollen an Arbeitsstätten so stark ausweiten wie nie zuvor in der Geschichte der Nation – man werde die Zone regelrecht „fluten“. Ein Beamter des Weißen Hauses, Stephen Miller, sprach gar von einem Ziel von 3.000 Verhaftungen pro Tag, eine drastische Steigerung gegenüber den bisherigen Zahlen.
Diese Strategie hat zwei Stoßrichtungen. Zum einen dient sie der Effizienz: Eine Razzia in einem Betrieb kann auf einen Schlag Dutzende Festnahmen bringen, was weitaus weniger personalintensiv ist als die Jagd auf Einzelpersonen. Zum anderen sendet sie eine unmissverständliche Botschaft an die Millionen von Einwanderern ohne Papiere, die bisher unauffällig gelebt und gearbeitet haben: Niemand ist mehr sicher. Diese Politik der Angst hat gravierende Konsequenzen für die Wirtschaft. Unternehmer, insbesondere in Branchen wie dem Baugewerbe, der Landwirtschaft oder der Gastronomie, die stark von der Arbeitskraft von Einwanderern abhängig sind, geraten in ein unlösbares Dilemma. Sie riskieren Strafverfolgung, wenn sie wissentlich Personen ohne Papiere beschäftigen, können aber auch wegen Diskriminierung belangt werden, wenn sie Arbeiter nur aufgrund eines Verdachts entlassen. Einige Arbeitgeber haben aus Angst bereits begonnen, mutmaßlich undokumentierte Mitarbeiter präventiv zu entlassen, was ganze Existenzen über Nacht zerstört.
Chaos auf den Straßen: Ein Riss zwischen den Uniformen
Die Eskalation auf politischer Ebene spiegelt sich in wachsenden Spannungen zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden vor Ort wider. Die Koordination zwischen den Bundesagenten von ICE und der lokalen Polizei des Los Angeles Police Department (LAPD) scheint komplett zusammengebrochen zu sein. Bundesbeamte warfen dem LAPD öffentlich vor, bei den Protesten am Freitag viel zu spät eingetroffen zu sein und sie über zwei Stunden lang alleingelassen zu haben, während Hunderte Demonstranten ein Bundesgebäude umzingelt hätten. ICE-Direktor Todd Lyons beschuldigte Bürgermeisterin Bass direkt, sich auf die „Seite von Chaos und Gesetzlosigkeit“ gestellt zu haben.
Die Führung des LAPD wies diese Vorwürfe scharf zurück. Polizeichef Jim McDonnell erklärte, seine Beamten seien innerhalb von 55 Minuten vor Ort gewesen, und die Verzögerung sei auf den dichten Verkehr sowie den Einsatz von „Reizstoffen“ durch die Bundesagenten zurückzuführen gewesen, der die Lage zusätzlich erschwert habe. Er betonte zudem, dass ICE die lokalen Behörden nicht im Vorfeld über die geplanten Razzien informiert habe, was eine proaktive Planung zur Vermeidung von Unruhen unmöglich gemacht habe. Dieser öffentliche Streit ist symptomatisch für einen tieferen Konflikt. Das LAPD verfolgt seit 1979 eine Politik, die es seinen Beamten verbietet, Personen anzuhalten, nur um deren Einwanderungsstatus zu überprüfen. Kaliforniens Gesetze als „Sanctuary State“ verbieten zudem den Einsatz lokaler Ressourcen zur Unterstützung von Bundes-Einwanderungsrazzien. Dieser fundamentale Dissens führt dazu, dass die Sicherheitskräfte nicht an einem Strang ziehen, sondern sich gegenseitig blockieren und beschuldigen, während die Lage auf der Straße eskaliert.
Ein gefährlicher Präzedenzfall? Historische Echos und die Angst vor mehr
Die Entscheidung, die Nationalgarde auf diese Weise einzusetzen, weckt düstere historische Erinnerungen und schürt die Angst vor einer weiteren Eskalation. Im Gegensatz zum Einsatz nach den Rodney-King-Unruhen 1992, der vom damaligen Gouverneur Pete Wilson ausdrücklich erbeten wurde, handelt es sich heute um eine Übernahme der Befehlsgewalt gegen den Willen des Staates. Während des George-Floyd-Aufstands 2020 hatte Trump zwar bereits mit einem ähnlichen Vorgehen gedroht, es aber letztlich nicht umgesetzt. Seine damalige Unzufriedenheit und die jüngste Äußerung bei einer Wahlkampfveranstaltung, dass er beim nächsten Mal „nicht warten“ werde, bis ein Gouverneur um Hilfe bittet, zeigen, dass die jetzige Aktion in Los Angeles die konsequente Umsetzung einer lange gehegten Absicht ist.
Die Rolle der 2.000 Soldaten ist laut offiziellem Memo zunächst begrenzt: Sie sollen ICE-Beamte und Bundeseigentum „temporär schützen“ und nicht direkt in die Strafverfolgung von Zivilisten eingreifen. Doch die Grenzen sind fließend und die Rhetorik der Regierung lässt Schlimmeres befürchten. Die zusätzliche Drohung von Verteidigungsminister Pete Hegseth, dass bei fortgesetzter Gewalt auch aktive Marineinfanteristen aus dem nahegelegenen Camp Pendleton mobilisiert werden könnten, die bereits in „hoher Alarmbereitschaft“ seien, ist ein klares Signal, dass die Administration bereit ist, die militärische Option weiter auszubauen.
Am Ende offenbart der Konflikt in Los Angeles eine tiefere Wahrheit über den Zustand der amerikanischen Politik. Er ist das Ergebnis einer Strategie, die politische Gegner nicht nur bekämpft, sondern deren Legitimität infrage stellt und staatliche Institutionen als Waffen im Kulturkampf einsetzt. Die Leidtragenden sind die Menschen vor Ort: die Einwanderer, die in ständiger Angst leben und von denen einige bereits ihre Arbeit verloren haben; die Ladenbesitzer, die um ihre Existenz fürchten, während vor ihrer Tür protestiert wird; und die Bürger, die Zeugen werden, wie das Vertrauen in den Staat und seine Sicherheitsorgane zerfällt. Die Bilder aus Los Angeles sind daher mehr als nur Nachrichten von einer Demonstration. Sie könnten ein Vorbote für eine Zukunft sein, in der der politische Konflikt nicht mehr nur zwischen Parteien, sondern zwischen Regierungsebenen ausgetragen wird – mit unabsehbaren Folgen für die Stabilität der gesamten Nation.