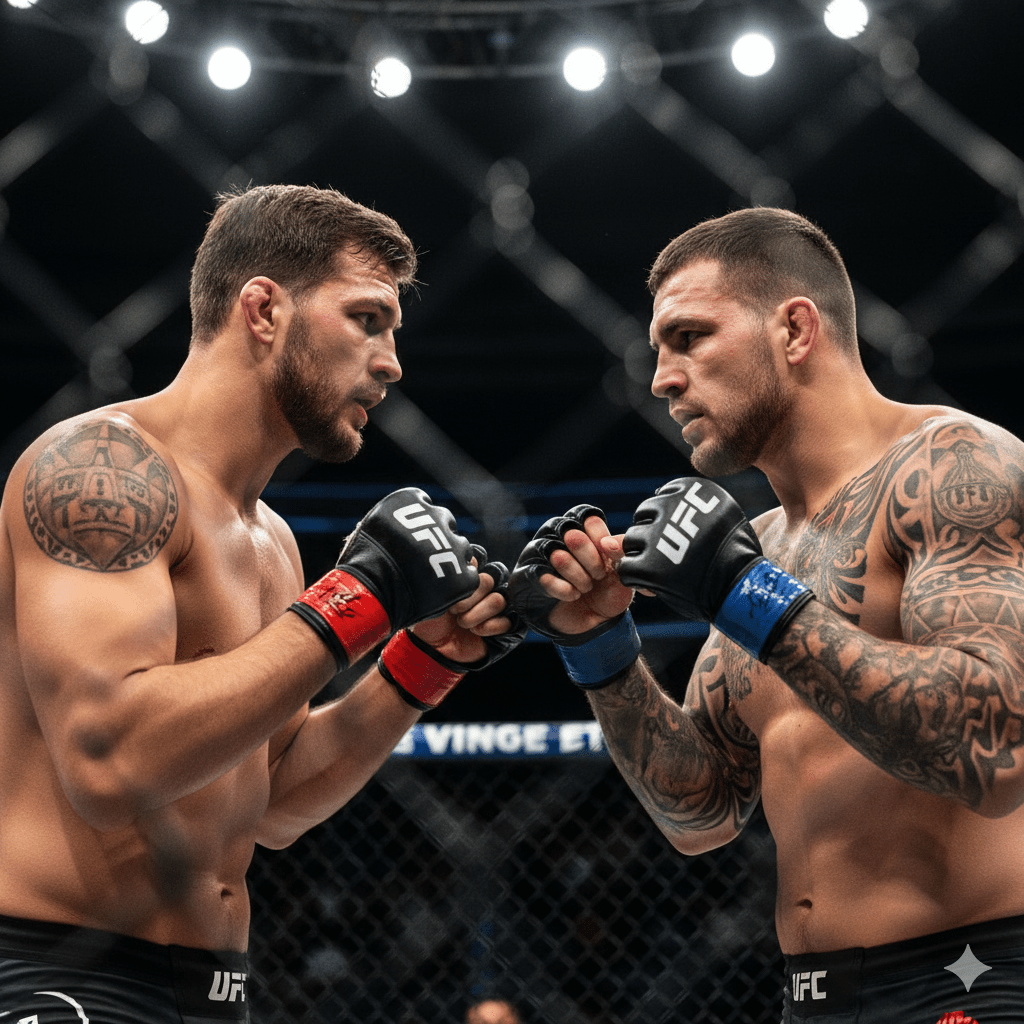Ein unilateraler Militärschlag gegen iranische Atomanlagen stellt die Nahost-Politik der Trump-Administration auf den Kopf. Während Israel einen existenziellen Sieg reklamiert, steht Washington vor den Scherben seiner Verhandlungsstrategie und dem Albtraum eines regionalen Flächenbrands, den es unter allen Umständen verhindern wollte. Die Analyse eines hochriskanten Spiels, dessen Ausgang völlig ungewiss ist.
In den frühen Morgenstunden des Freitags zerrissen Explosionen die Stille im Iran und Sirenen den Schlaf in Israel. Was sich dort abspielte, war weit mehr als nur ein weiterer Schlagabtausch in dem jahrzehntelangen Schattenkrieg zwischen den beiden Erzfeinden. Mit der Operation „Rising Lion“ startete Israel den wohl ambitioniertesten und riskantesten Militärschlag seiner jüngeren Geschichte. Das erklärte Ziel: die Zerstörung des „Herzens“ des iranischen Atomprogramms, die Liquidierung führender Militärs und Wissenschaftler und die Beseitigung dessen, was Premierminister Benjamin Netanyahu als „klare und gegenwärtige Gefahr für Israels Überleben“ bezeichnete. Doch während in Jerusalem von einem notwendigen Akt der Selbstverteidigung gegen einen drohenden „nuklearen Holocaust“ die Rede war, offenbarte der Angriff vor allem eines: eine tiefe Kluft zwischen Israel und seinem wichtigsten Verbündeten, den Vereinigten Staaten. Die unilateralen Schläge torpedierten die monatelangen, fragilen diplomatischen Bemühungen der Trump-Regierung und stürzten Washington in ein beispielloses Dilemma – gefangen zwischen Bündnistreue und der Furcht vor einem unkontrollierbaren Krieg.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Ein Alleingang mit Ansage: Warum Israel jetzt zuschlug
Die israelische Regierung ließ keinen Zweifel an der Tragweite ihres Handelns. In einer dramatischen, siebenminütigen Ansprache kurz nach Beginn der Angriffe inszenierte sich Netanyahu als entschlossener Verteidiger des jüdischen Volkes. Die Begründung für den Angriff speiste sich aus einer maximalistischen Lesart der Bedrohungslage. Jüngste Berichte der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über die stark erhöhte Produktion von fast waffenfähigem Uran durch den Iran lieferten die unmittelbare Legitimation. Demnach verfüge Teheran über fast 409 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran – genug, um es laut Experten innerhalb von Wochen auf die für eine Bombe nötigen 90 Prozent zu bringen. Netanyahu selbst sprach davon, dass der Iran Material für neun Atombomben besitze, während das iranische Regime in nur wenigen Monaten eine einsatzbereite Waffe produzieren könne.
Diese alarmistische Einschätzung steht jedoch in deutlichem Kontrast zur Analyse der amerikanischen Geheimdienste. US-Offizielle betonten noch kurz vor dem Angriff, dass ihre langjährige Bewertung unverändert sei: Der Iran habe trotz seiner fortschrittlichen Anreicherungsaktivitäten noch nicht die entscheidende politische Entscheidung getroffen, das Material tatsächlich in eine Atomwaffe umzuwandeln. Dieser fundamentale Dissens in der Gefahrenanalyse ist der Schlüssel zum Verständnis des israelischen Alleingangs. Während Washington auf eine diplomatische Lösung setzte, die das Programm eindämmen sollte, schien für Netanyahu nur die militärische Zerstörung der iranischen Fähigkeiten eine Option zu sein.
Die Entscheidung für diesen drastischen Schritt dürfte jedoch nicht nur von strategischen Erwägungen getragen sein. Netanyahu steht innenpolitisch massiv unter Druck. Er muss sich wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten, und seine rechtsextreme Koalition befand sich zuletzt wegen eines Streits über die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Männer am Rande des Zusammenbruchs. In israelischen Medien wurde offen spekuliert, dass die plötzliche Regierungskrise nur eine Verschleierungsoperation gewesen sein könnte, um Teheran in Sicherheit zu wiegen. Ein militärischer Paukenschlag gegen den Erzfeind Iran bot Netanyahu die Möglichkeit, sich als starker Führer zu präsentieren und von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken – ein Manöver, das die internationale Gemeinschaft mit großer Sorge beobachtete, zumal Israels Ansehen durch den brutalen Krieg in Gaza und Sanktionen gegen rechtsradikale Minister bereits schwer gelitten hatte.
Washingtons Dilemma: Zwischen Bündnistreue und Kriegsvermeidung
Für die Trump-Administration kam der Angriff zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Noch am Donnerstag hatte Präsident Trump die Hoffnung auf eine friedliche Lösung geäußert; für den darauffolgenden Sonntag war eine sechste Runde der direkten Atom-Gespräche zwischen den USA und dem Iran im Oman geplant. Der israelische Angriff machte diese Pläne mit einem Schlag zunichte und konfrontierte die US-Regierung mit einer Realität, die sie nicht geschaffen hatte, aber nun bewältigen muss.
Die offizielle Reaktion aus Washington war von Distanz und Schadensbegrenzung geprägt. Außenminister Marco Rubio betonte umgehend, die USA seien „nicht involviert“ gewesen und es handle sich um eine „einseitige Aktion“ Israels. Die „oberste Priorität“ der Regierung sei der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Zwar sei man von Israel vorab informiert worden, dass die Aktion aus Gründen der Selbstverteidigung als notwendig erachtet werde, doch das Ausbleiben einer klaren Unterstützungsbekundung sprach Bände. Es signalisierte einen tiefen Dissens über die Notwendigkeit und den Zeitpunkt des Angriffs.
Dieser Spagat spiegelt auch die Zerrissenheit innerhalb von Trumps politischem Umfeld wider. Während einflussreiche MAGA-Stimmen wie Jack Posobiec vor einem neuen Krieg warnten, der die Koalition des Präsidenten spalten würde, drängten Hardliner wie Rupert Murdoch und Isaac Perlmutter im Hintergrund auf eine militärische Konfrontation mit dem Iran. Trump selbst agierte widersprüchlich: Einerseits wies er seine gesamte Regierung an, mit dem Iran zu verhandeln, andererseits räumte er ein, dass Israel zuerst angreifen könnte. Diese Ambivalenz gab Netanyahu möglicherweise das Gefühl, zwar ohne explizite amerikanische Unterstützung, aber auch ohne ein klares amerikanisches Veto handeln zu können. Die USA hatten sich bereits im Vorfeld auf eine mögliche Eskalation vorbereitet, indem sie Diplomaten aus dem Irak abzogen und die Evakuierung von Militärfamilien genehmigten – deutliche Anzeichen dafür, dass man in Washington mit einer heftigen iranischen Reaktion rechnete, die auch US-Ziele einschließen könnte.
Ein Pyrrhussieg? Der ungewisse Ausgang von Netanyahus Wagnis
Die entscheidende Frage, die nun über der Region schwebt, ist, ob Israels riskanter Angriff seine strategischen Ziele überhaupt erreichen konnte. Die israelischen Streitkräfte zielten auf eine breite Palette von Zielen, darunter die zentrale Anreicherungsanlage in Natanz, Raketenbasen und Wohngebäude hochrangiger Offiziere in mehreren Städten, einschließlich Teheran. Berichte bestätigten den Tod von Revolutionsgarden-Kommandeur Hossein Salami, Armeechef Mohammad Bagheri sowie mindestens zwei Atomwissenschaftlern. Doch die langfristige Wirkung dieser Schläge ist höchst umstritten.
Die Geschichte früherer Angriffe auf das iranische Programm lehrt zur Vorsicht. Der Cyberangriff mit Stuxnet vor 15 Jahren oder die gezielten Tötungen von Wissenschaftlern in der Vergangenheit konnten die iranischen Fortschritte nur vorübergehend verlangsamen. Oft kam das Programm danach sogar noch stärker und dezentralisierter zurück. Experten warnen, dass auch der jetzige Angriff unvorhersehbare Folgen haben könnte. Das größte Risiko besteht darin, dass der Iran nun genau das tut, was Netanyahu zu verhindern suchte: sich aus dem Atomwaffensperrvertrag zurückzuziehen, sein Programm vollständig in den Untergrund verlegen und den Bau einer Bombe mit aller Macht vorantreiben.
Zudem gibt es erhebliche Zweifel an der militärischen Effektivität des Angriffs, insbesondere was die am besten geschützte iranische Atomanlage betrifft: Fordow. Diese tief in einem Berg vergrabene Anlage ist für die israelische Luftwaffe ohne spezielle bunkerbrechende Bomben, über die nur die USA verfügen, kaum zu zerstören. US-Offizielle wie der ehemalige Nahost-Koordinator Brett McGurk sind sich einig: „Wenn man Fordow nicht ausschaltet, hat man ihre Fähigkeit zur Herstellung von waffenfähigem Material nicht eliminiert“. Der Angriff könnte also einen hohen politischen Preis für einen nur begrenzten und kurzfristigen militärischen Gewinn gefordert haben.
Die unmittelbaren Folgen sind eine Region am Rande des Abgrunds. Der Iran hat mit „harter Bestrafung“ und einem „kräftigen Schlag“ gedroht. Seine Revolutionsgarden kündigten an, Israel werde für den Angriff, der mit „vollem Wissen und Unterstützung“ der USA erfolgt sei, einen „hohen Preis“ zahlen. Als Reaktion darauf haben Israel und der Iran ihre Lufträume gesperrt, Krankenhäuser in Israel verlegen Notaufnahmen in Bunker, und das Nachbarland Irak hat ebenfalls den gesamten Flugverkehr eingestellt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres und selbst Saudi-Arabien, ein regionaler Rivale des Iran, verurteilten den Angriff und riefen zu äußerster Mäßigung auf, da sich die Region keinen weiteren Konflikt leisten könne. Der israelische Schlag hat nicht nur Atomanlagen getroffen, sondern auch das fragile Gleichgewicht der Region und die letzte Hoffnung auf eine diplomatische Lösung zerstört. Für die USA bedeutet dies, dass sie nun mit den Konsequenzen einer Politik konfrontiert sind, die sie nicht wollten, deren Eskalation sie aber nun verzweifelt zu managen versuchen müssen.