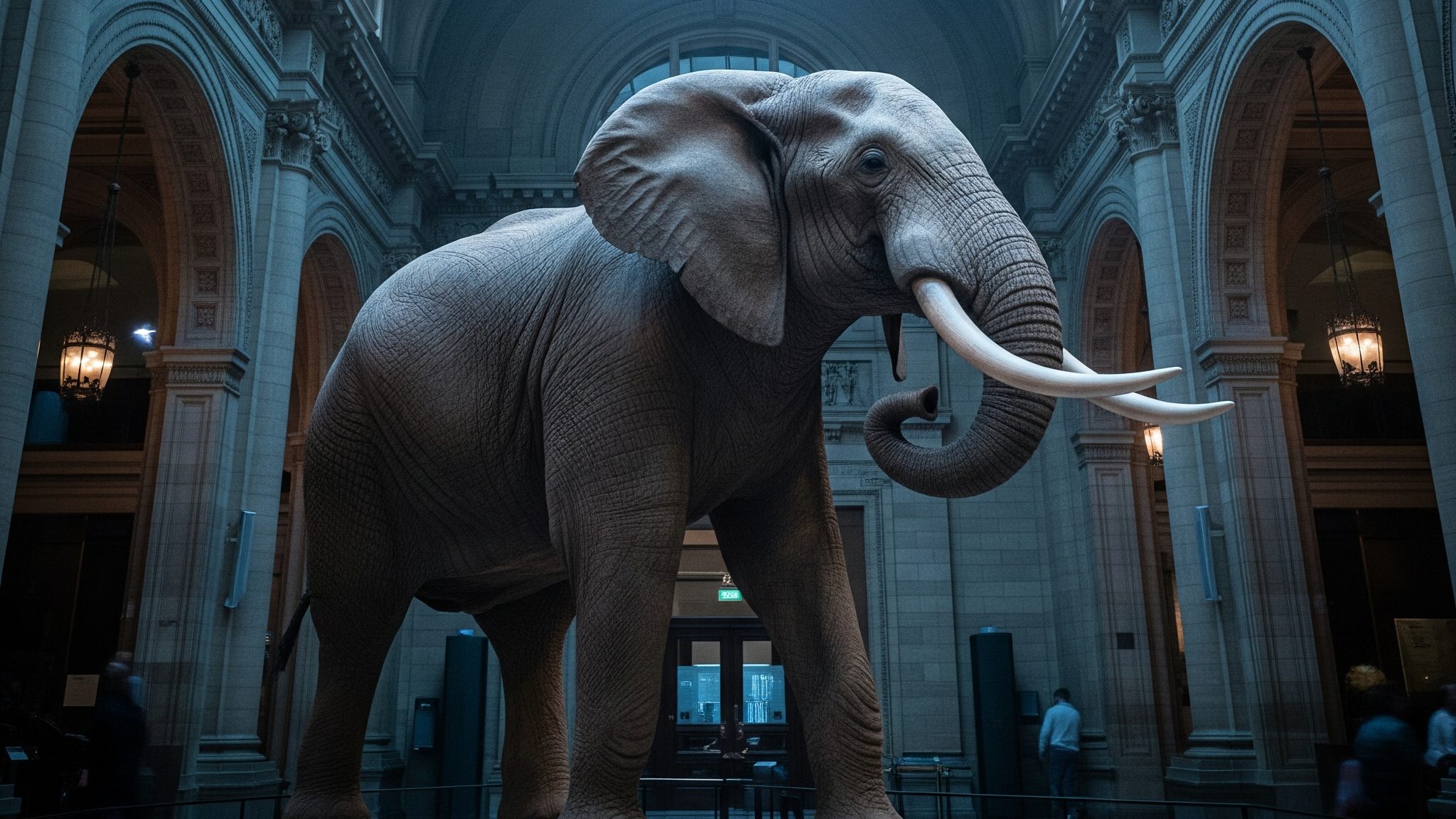
Es gibt Orte, die mehr sind als nur Gebäude aus Stein und Glas. Sie sind das kollektive Gedächtnis einer Nation, ihre Schatztruhe, ihr Gewissen. Die Smithsonian Institution in Washington D.C. ist ein solcher Ort. Sie ist das prall gefüllte Dachgeschoß Amerikas, in dem die Artefakte der Triumphe neben den Zeugnissen der Tragödien lagern. Doch nun scheint es, als hätte jemand beschlossen, diesen Dachboden nicht nur aufzuräumen, sondern ihn nach einem strengen, politischen Bauplan neu zu sortieren. Der Befehl kommt direkt aus dem Weißen Haus der zweiten Trump-Administration, und er liest sich wie das Drehbuch für eine schleichende Übernahme.
Die angekündigte, weitreichende Überprüfung der Smithsonian-Museen ist weit mehr als ein administrativer Akt. Sie ist der bisher kühnste Vorstoß in einem systematischen Versuch, die kulturelle Deutungshoheit in den USA zu erobern. Unter dem Banner einer patriotischen Erneuerung wird hier ein Angriff auf die wissenschaftliche Unabhängigkeit und die intellektuelle Freiheit geführt, der das Fundament dessen erschüttert, was eine offene Gesellschaft ausmacht: die Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion. Es ist ein Kampf um die Geschichte selbst – und er wird mit den Mitteln der Macht geführt, kurz vor dem 250. Geburtstag der Nation.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Maschinerie der Kontrolle: Ein Plan mit System
Der Vorstoß des Weißen Hauses ist keine vage Absichtserklärung, sondern ein minutiös ausgearbeiteter Fahrplan zur Disziplinierung. Ein offizielles Schreiben, unterzeichnet von hochrangigen Funktionären wie Lindsey Halligan, einer Sonderberaterin des Präsidenten, und Vince Haley, dem Direktor des innenpolitischen Rates, legt die Mechanismen offen. Es ist ein Dokument, dessen bürokratische Kühle seine explosive politische Sprengkraft kaum verbergen kann.
Der Plan sieht eine mehrstufige Überprüfung vor, beginnend mit acht der prominentesten Smithsonian-Häuser, darunter das National Museum of American History, das National Museum of African American History and Culture und das National Museum of the American Indian. Die Zeitvorgaben sind straff und unmissverständlich:
- Innerhalb von 30 Tagen müssen die Museen umfassendes Material vorlegen: Kataloge, Ausstellungsprogramme, digitale Dateien sämtlicher Wandtexte und Beschilderungen sowie die Planungen für die kommenden drei Jahre.
- Innerhalb von 75 Tagen wird eine Inventur der permanenten Sammlungen, eine Liste externer Partnerschaften und die Ergebnisse von Besucherbefragungen gefordert.
- Innerhalb von 120 Tagen erwartet die Administration bereits konkrete Ergebnisse. Museen sollen damit beginnen, „Inhaltskorrekturen umzusetzen“ und „spaltende oder ideologisch getriebene Sprache durch vereinheitlichende, historisch akkurate und konstruktive Beschreibungen“ zu ersetzen.
Parallel zu diesen administrativen Forderungen plant das Team des Weißen Hauses eigene „Beobachtungsbesuche“ und „Rundgänge“ durch die aktuellen Ausstellungen. Es ist das Bild einer lückenlosen Überwachung, die keinen Aspekt des musealen Betriebs auslässt – von der Vitrinenbeschriftung über die Online-Präsenz bis hin zur langfristigen Ausstellungsstrategie.
Schöne Worte, Harte Fronten: Der Kampf um die Deutungshoheit
Offiziell verkauft das Weiße Haus seine Initiative als partnerschaftliches Angebot zur „Unterstützung einer breiteren Vision von Exzellenz“. Man wolle keineswegs in die tägliche Arbeit der Kuratoren eingreifen, sondern lediglich dabei helfen, „das Vertrauen in unsere gemeinsamen kulturellen Institutionen wiederherzustellen“. Die Rhetorik ist voller beschwichtigender Begriffe wie „Zusammenarbeit“, „Inklusivität“ und „historische Genauigkeit“. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich eine unnachgiebige ideologische Agenda.
Die wahre Zielrichtung wird in der Anweisung deutlich, Inhalte an der Direktive des Präsidenten auszurichten, den „amerikanischen Exzeptionalismus zu feiern“ und „spaltende oder parteiische Narrative zu entfernen“. Historiker und Experten schlagen Alarm, denn sie erkennen in diesen Formulierungen einen kaum verhohlenen Versuch, eine komplexe und oft widersprüchliche Nationalgeschichte zu einer geglätteten Heldenerzählung zu vereinfachen.
Annette Gordon-Reed, Geschichtsprofessorin in Harvard, argumentiert, dass die Museen bereits einen „fantastischen Job“ machen. Die Darstellung der amerikanischen Geschichte müsse eben beides umfassen: „die Triumphe und die Tragödien“. Was aber bedeutet „spaltend“ in einem Land, dessen Geschichte von tiefen Gräben wie dem Bürgerkrieg, der Rassentrennung und den Kämpfen der Bürgerrechtsbewegung durchzogen ist? Ist die schonungslose Auseinandersetzung mit der Sklaverei bereits „ideologisch getrieben“? Fördert die Darstellung des Leids der indigenen Bevölkerung keine „Einheit“? Der Historiker Samuel J. Redman nennt die Maßnahme folgerichtig einen „Frontalangriff auf die Autonomie“ der Institution. Hier prallen zwei unvereinbare Welten aufeinander: der wissenschaftliche Anspruch auf eine vielschichtige, quellenbasierte Wahrhaftigkeit und der politische Wille zu einer simplen, erbaulichen Legende.
Ein Sturm zieht auf: Die Vorgeschichte des Konflikts
Die aktuelle Eskalation kommt nicht aus heiterem Himmel. Sie ist der vorläufige Höhepunkt eines seit Monaten schwelenden Konflikts, in dem das Weiße Haus den Druck auf das Smithsonian systematisch erhöht hat. Es ist die Geschichte einer Belagerung, bei der die Mauern der Unabhängigkeit bereits erste Risse zeigen.
Den Auftakt bildete ein Dekret des Präsidenten vom März mit dem Titel „Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte“. Darin wurde dem Smithsonian bereits vorgeworfen, unter dem Einfluss einer „spaltenden, rassenzentrierten Ideologie“ zu stehen. Es folgten Taten, die zeigten, dass es sich nicht nur um Rhetorik handelte:
- Der Fall Kim Sajet: Die Leiterin der National Portrait Gallery trat im Juni zurück, nachdem Präsident Trump verkündet hatte, sie wegen ihrer angeblichen Parteilichkeit zu entlassen. Auch wenn der Stiftungsrat des Smithsonian betonte, allein für Personalentscheidungen zuständig zu sein, war der politische Druck am Ende erfolgreich.
- Der Fall Amy Sherald: Die Künstlerin zog ihre geplante Ausstellung aus der National Portrait Gallery zurück. Sie begründete dies mit der Sorge, das Museum wolle ein Gemälde, das eine transgender Freiheitsstatue darstellt, aus der Schau entfernen oder dessen Wirkung durch eine kontextualisierende Videoinstallation abschwächen.
- Der Fall der Impeachment-Tafel: Am National Museum of American History wurde eine Informationstafel, die auf die Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump verwies, zeitweise entfernt, bevor sie nach öffentlichen Protesten wieder angebracht wurde.
Zudem schloss das Smithsonian sein Diversitätsbüro, nachdem ein präsidentielles Dekret die Finanzierung solcher Programme für alle Institutionen, die Bundesmittel erhalten, verbot. Jedes dieser Ereignisse war ein Testballon, ein Vorstoß, um die Grenzen der eigenen Macht und die Widerstandsfähigkeit der Institution auszuloten.
Das Recht des Stärkeren? Die fragile Autonomie des Smithsonian
Auf dem Papier ist das Smithsonian keine gewöhnliche Regierungsbehörde. Es wird von einem unabhängigen Stiftungsrat (Board of Regents) beaufsichtigt, dem Demokraten und Republikaner angehören, und untersteht der Kontrolle des Kongresses. Das Weiße Haus hat keine direkte Befehlsgewalt über die Inhalte oder das Personal. Doch diese formale Autonomie steht auf einem finanziell wackeligen Fundament.
Die Achillesferse der Institution ist ihr Budget. Über 62 Prozent des jährlichen Etats von mehr als einer Milliarde Dollar stammen aus Bundesmitteln – seien es direkte Zuweisungen des Kongresses, Bundeszuschüsse oder Regierungsaufträge. Dieses finanzielle Druckmittel ist die schärfste Waffe der Administration. In der Politik ist Geld oft die härteste Währung, und die Drohung, den Geldhahn zuzudrehen, schwebt unausgesprochen über jeder Konfrontation.
Die Leitung des Smithsonian befindet sich in einer prekären Zwangslage. Sie reagiert diplomatisch, betont in einem Statement ihre Verpflichtung zu „wissenschaftlicher Exzellenz“ und verspricht, „konstruktiv“ mit dem Weißen Haus zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig hatte der eigene Stiftungsrat bereits im Juni eine interne Überprüfung angeordnet, um „unvoreingenommene Inhalte“ sicherzustellen – ein Schritt, der als Versuch gewertet werden kann, der Einmischung von außen zuvorzukommen und gleichzeitig den politischen Druck zu besänftigen. Doch es scheint, als hätte man in der Führungsetage die Entschlossenheit der Administration unterschätzt, ihre Agenda mit aller Macht durchzusetzen.
Wenn Geschichte zum Schlachtfeld wird: Die Risiken für Amerikas Erbe
Was steht auf dem Spiel, wenn die Politik beginnt, die Arbeit von Historikern und Kuratoren zu zensieren? Die unmittelbare Gefahr ist eine Welle der vorauseilenden Selbstzensur. Welcher Kurator wird es noch wagen, eine Ausstellung über kontroverse Themen wie die Rassenunruhen der 1960er Jahre oder die gewaltsame Landnahme im Westen zu konzipieren, wenn er fürchten muss, dass seine Arbeit als „spaltend“ oder „unpatriotisch“ gebrandmarkt wird? Die Forderung nach einer „erhebenden“ und „konstruktiven“ Geschichtsschreibung droht, die Museen in Orte zu verwandeln, in denen unbequeme Wahrheiten keinen Platz mehr haben.
Besonders bedroht sind jene Häuser, deren Existenzzweck gerade darin besteht, die Geschichten marginalisierter Gruppen zu erzählen. Das National Museum of African American History and Culture und das National Museum of the American Indian sind explizit für die erste Phase der Überprüfung vorgesehen. Ihre Erzählungen von Unterdrückung, Widerstand und Überleben lassen sich kaum in eine ungetrübte Erfolgsgeschichte des „amerikanischen Exzeptionalismus“ pressen, ohne sie bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen.
All dies geschieht vor dem Hintergrund der nahenden 250-Jahr-Feier der Nation im kommenden Jahr. Präsident Trump hat die Feierlichkeiten zu seinem persönlichen Prestigeprojekt erklärt und eine eigene Taskforce dafür eingerichtet. Die Kontrolle über das Smithsonian ist ein entscheidender Baustein, um sicherzustellen, dass das Jubiläum nicht von kritischen Debatten über die Widersprüche der amerikanischen Geschichte überschattet wird, sondern eine große, ungestörte Feier der nationalen Größe inszeniert werden kann.
Die Auseinandersetzung um das Smithsonian ist daher mehr als nur ein kulturpolitischer Streit. Es ist ein Kampf um die Seele des nationalen Gedächtnisses. Es geht um die fundamentale Frage, ob eine Gesellschaft bereit ist, sich ihrer gesamten Geschichte zu stellen – mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Oder ob sie zulässt, dass die Vergangenheit zu einem Werkzeug der Gegenwart gemacht wird, zurechtgestutzt für die politischen Bedürfnisse der jeweils Herrschenden. Die Antwort auf diese Frage wird weit über die Mauern der Museen in Washington hinausweisen. Sie wird zeigen, wie robust die demokratischen Abwehrkräfte einer Nation im 21. Jahrhundert wirklich sind.


