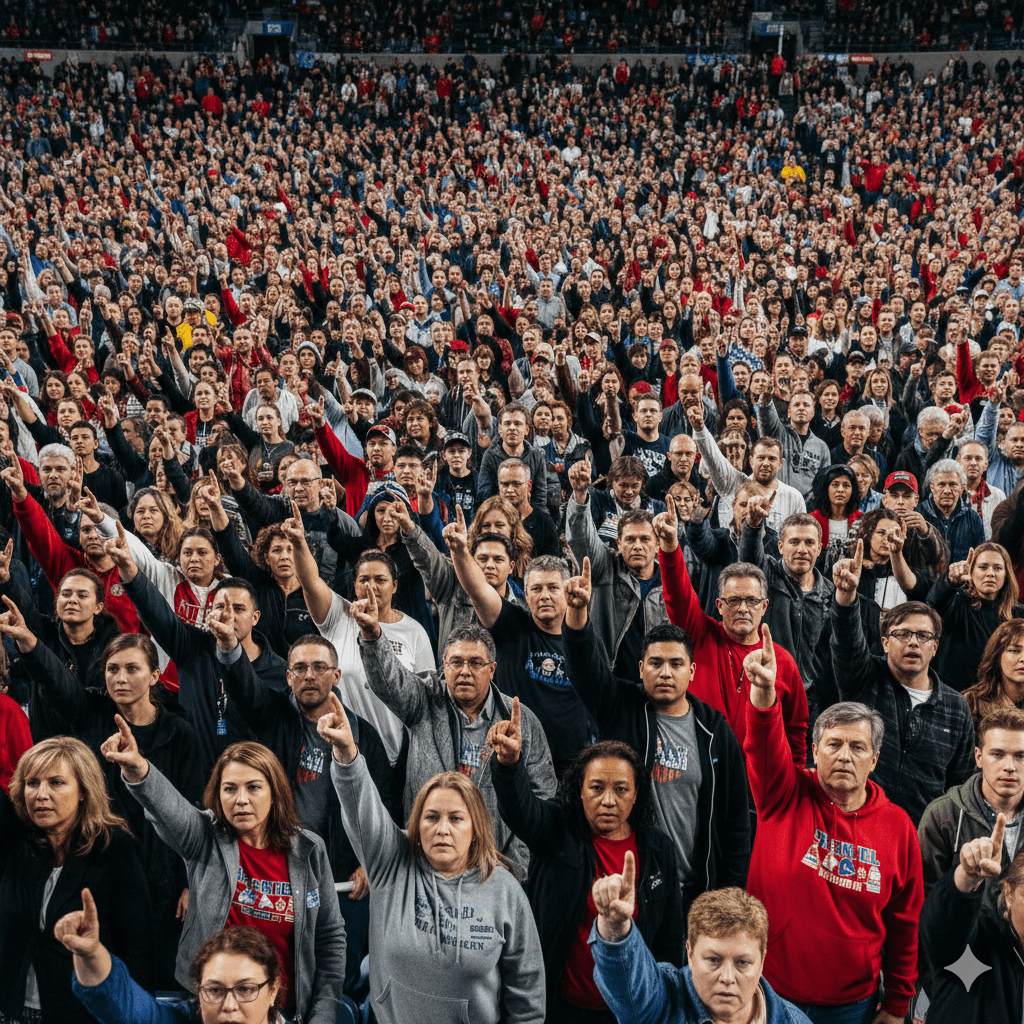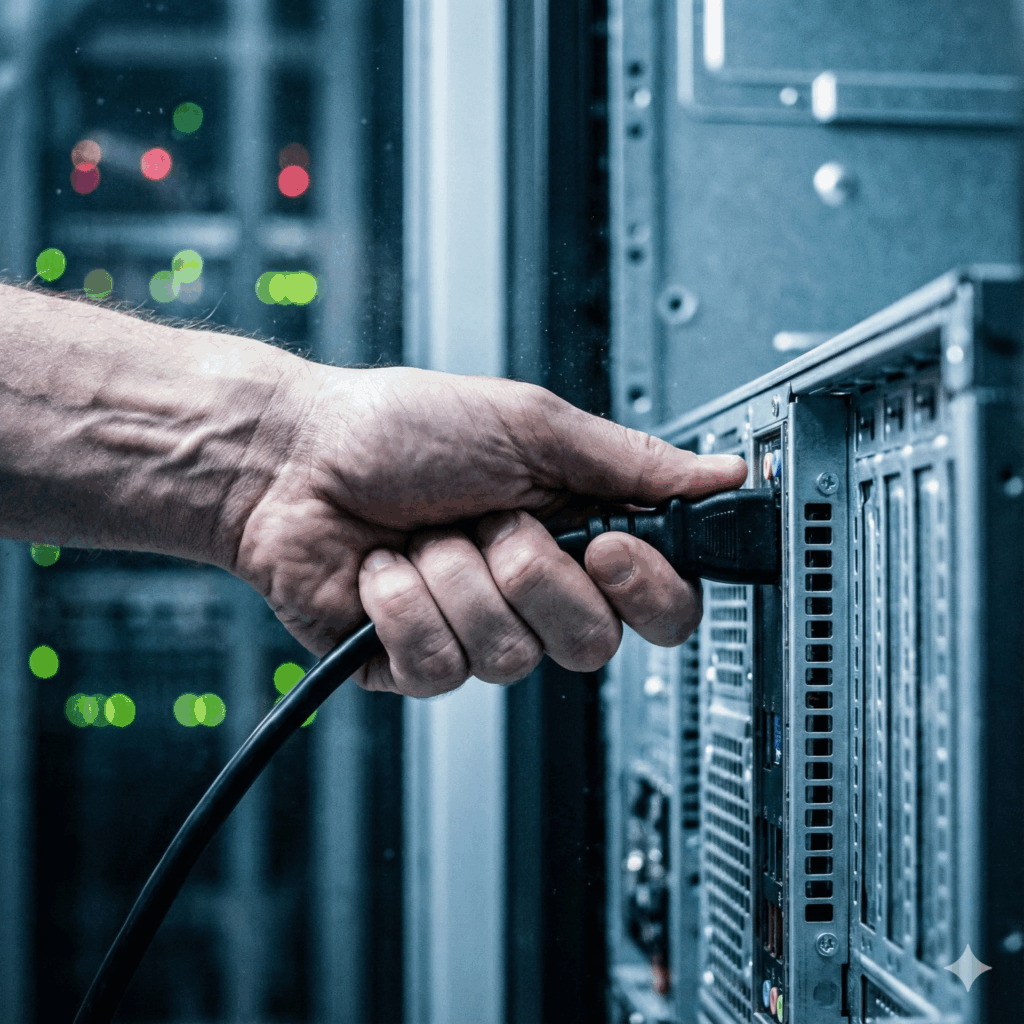In der schillernden Welt des Silicon Valley ist kaum eine Geschichte so bitter wie die eines Pioniers, der vom eigenen Fortschritt überholt wird. Genau diese Demütigung erlebt gerade Mark Zuckerberg. Sein Konzern Meta, der mit dem renommierten Forschungslabor FAIR schon 2013 in die Königsklasse der künstlichen Intelligenz aufstieg, als die heutigen Dominatoren OpenAI oder Anthropic noch nicht einmal existierten, findet sich plötzlich auf den hinteren Plätzen wieder. Die einst führende Position ist einer verzweifelten Aufholjagd gewichen. Doch anstatt sich geschlagen zu geben, reagiert Zuckerberg auf die Krise mit einer Strategie, die so typisch für ihn ist wie der Hoodie in seinen frühen Jahren: einer gewaltigen, milliardenschweren Offensive, die den Markt erschüttern und die Konkurrenz in den Schatten stellen soll.
Die Gründung der neuen „Meta Superintelligence Labs“ (MSL), eine Investition von über 14 Milliarden Dollar in das KI-Startup Scale AI und das aggressive Abwerben von dessen Gründer Alexandr Wang als neuen KI-Chef sind die Säulen dieser neuen Ära. Es ist eine Operation am offenen Herzen, die nicht nur mit aberwitzigen Summen und schillernden Namen hantiert, sondern auch die bisherige Seele von Metas KI-Strategie – die Offenheit des Open-Source-Ansatzes – infrage stellt. Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich der glanzvolle Begriff „Superintelligenz“ jedoch weniger als eine Vision für die Zukunft der Menschheit, sondern vielmehr als ein neues, martialisches Etikett für ein altes Ziel: die unangefochtene Dominanz über die Aufmerksamkeit von Milliarden von Menschen. Metas Antwort auf eine Innovationskrise ist kein kreativer Geistesblitz, sondern der Einsatz von roher finanzieller und struktureller Gewalt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Vom Pionier zum Getriebenen: Metas demütigender Wettlauf gegen die Zeit
Der Handlungsdruck, der auf Zuckerberg lastet, ist immens und hausgemacht. Die Gründung von FAIR unter der Leitung von KI-Legende Yann LeCun war 2013 ein Coup, der Metas (damals Facebook) Führungsanspruch untermauern sollte. Jahrelang produzierte das Labor bedeutende Forschungsbeiträge, doch der Konzern versäumte es, daraus konkurrenzfähige, eigenständige Produkte für den Endverbraucher zu entwickeln. Als OpenAI Ende 2022 mit ChatGPT die Welt im Sturm eroberte, stand Meta technologisch im Regen. Die hastig nachgeschobenen eigenen Modelle der Llama-Serie konnten mit der Konkurrenz von Google, Anthropic und selbst neueren Firmen wie xAI nicht mithalten.
Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit manifestierte sich auf besonders schmerzhafte Weise im April 2025. Das von Zuckerberg stolz als „Bestie“ angekündigte Modell Llama 4 konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Während eine experimentelle Variante kurzzeitig einen Spitzenplatz in einem globalen Ranking erreichte, landete die tatsächlich veröffentlichte Version abgeschlagen auf dem 32. Platz – eine öffentliche Demütigung für den Konzern. Die Kontroverse wurde noch verschärft, als externe Forscher aufdeckten, dass Meta die Benchmarks offenbar so gestaltet hatte, dass die eigenen Produkte besser aussahen, als sie waren. Diese als Täuschungsversuch wahrgenommene Taktik erzürnte Entwickler und soll auch Zuckerberg persönlich verärgert haben, der sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, die schwache Leistung seiner KI kaschieren zu wollen. In dieser Atmosphäre aus Rückstand, öffentlicher Blamage und internem Frust ist die Gründung der Superintelligence Labs nicht nur eine strategische Neuausrichtung, sondern ein Akt der Verzweiflung, um mit aller Macht zurück an die Spitze zu gelangen.
Kulturkampf im Konzern: Der mögliche Verrat an der Open-Source-Seele
Metas Offensive hat jedoch einen hohen Preis, der weit über die Dollar-Beträge hinausgeht. Sie droht, einen tiefen Graben durch die Unternehmenskultur zu ziehen und einen fundamentalen philosophischen Pfeiler einzureißen. Bislang war die Open-Source-Strategie das wichtigste Unterscheidungsmerkmal und der größte Stolz von Metas KI-Abteilung. Die freie Verfügbarkeit des Codes für Modelle wie Llama sollte Innovationen beschleunigen, Entwickler anlocken und die eigenen Systeme durch die kollektive Intelligenz der Community verbessern. KI-Chefwissenschaftler Yann LeCun prägte den Satz: „Die Plattform, die gewinnen wird, wird die offene sein“.
Doch genau diese Überzeugung steht nun zur Disposition. Innerhalb des neuen, exklusiven Superintelligenz-Labors wird ernsthaft diskutiert, das leistungsstärkste geplante Open-Source-Modell namens „Behemoth“ aufzugeben und stattdessen auf ein geschlossenes System nach dem Vorbild von OpenAI und Google zu setzen. Ein solcher Schwenk wäre mehr als eine technische Kurskorrektur; es wäre ein philosophischer Verrat an der eigenen Community und ein Bruch mit einer lang gehegten Überzeugung. Die interne Organisation spiegelt diesen potenziellen Wandel wider. Das neue Team um Alexandr Wang arbeitet in einem vom Rest des Unternehmens abgeschotteten Bereich, direkt neben Zuckerbergs Büro, was eine Aura der Exklusivität und Geheimhaltung schafft. Diese Schaffung einer elitären Zwei-Klassen-Gesellschaft innerhalb der KI-Abteilung sorgt für Unruhe. Es wird erwartet, dass nach der nächsten Aktienzuteilung im August eine Kündigungswelle von talentierten Mitarbeitern einsetzen könnte, die sich übergangen fühlen. Schon vor der Umstrukturierung beklagte ein scheidender Forscher, dass kaum jemand wirklich an die KI-Mission des Unternehmens glaube und diese vielen nicht einmal klar sei. Die neue, abgeschottete Struktur dürfte dieses Gefühl der Entfremdung weiter verstärken.
Superintelligenz für mehr Werbeklicks: Zuckerbergs pragmatische Vision
Während die Konkurrenz den Aufstieg der KI oft in quasi-religiösen oder weltverändernden Begriffen beschreibt, bleibt Mark Zuckerbergs Vision auffallend pragmatisch und erdgebunden. In seinen öffentlichen Äußerungen geht es nicht um die Erschaffung eines neuen Bewusstseins oder die Lösung der großen Menschheitsprobleme. Stattdessen konzentriert er sich auf fünf konkrete Geschäftsfelder: Werbung, Social-Media-Inhalte, Online-Handel, der Meta-KI-Assistent und Hardware wie Smart Glasses. Die „Superintelligenz“ ist in dieser Lesart kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Optimierung des Kerngeschäfts.
Zuckerberg beschreibt eine Zukunft, in der Nutzer den ganzen Tag über mit einer KI sprechen, während sie durch ihre Feeds auf dem Handy scrollen oder eine smarte Brille tragen. Das ultimative Ziel, das er Investoren präsentiert, ist die Steigerung der Verweildauer. Er verkündete bereits stolz, dass KI-basierte Empfehlungen die Nutzungszeit auf Facebook, Instagram und Threads erhöht haben. Damit wird deutlich: Die Superintelligenz soll die Nutzer vor allem noch stärker an die bestehenden Plattformen und Geräte binden. Es ist eine Vision, die weniger von futuristischem Überschwang als von knallhartem kaufmännischem Kalkül getrieben ist. Die Milliardeninvestitionen fließen nicht in die Utopie einer besseren Welt, sondern in die Perfektionierung der Aufmerksamkeitsökonomie, die Meta groß gemacht hat.
Das alte Spiel mit neuen Mitteln: Kaufen, Kopieren, Dominieren
Tatsächlich fügt sich die aktuelle Offensive nahtlos in Metas bewährtes unternehmerisches Muster ein. Der Konzern war selten der innovativste, aber fast immer der aggressivste und dominanteste Akteur. Als Instagram und WhatsApp zu potenziellen Bedrohungen heranwuchsen, wurden sie für Milliardensummen gekauft. Als TikTok den Videomarkt eroberte, kopierte Meta das Format schamlos mit Reels. Und als Twitter unter Elon Musk implodierte, startete man mit Threads eine direkte Alternative. Das Drehbuch ist immer dasselbe: Bedrohungen werden entweder assimiliert, kopiert oder mit schierer Finanzkraft marginalisiert. Die aktuelle Strategie im KI-Rennen ist nichts anderes als die Anwendung dieses Playbooks auf eine neue technologische Herausforderung. Man versucht, den Rückstand durch das massive Abwerben von Talenten und gigantische Investitionen aufzuholen, anstatt ihn durch eine überlegene eigene Innovation zu schließen.
Diese Strategie wird durch eine clever strukturierte Investition in Scale AI abgesichert, die darauf ausgelegt ist, regulatorische Hürden zu umgehen. Die Übernahme von 49 % der Anteile ist als Minderheitsbeteiligung deklariert, um eine intensive Prüfung durch die wettbewerbsskeptische Federal Trade Commission (FTC) zu vermeiden, die bereits Metas frühere Akquisitionen im Visier hat. Es ist ein Vorgehen, das an die Partnerschaften von Microsoft mit OpenAI und Amazon mit Anthropic erinnert – eine Methode, um de facto Kontrolle auszuüben, ohne einen formellen Kauf vollziehen zu müssen.
Gleichzeitig bleibt der Widerspruch bestehen, dass Meta zwar technologisch hinterherhinkt, aber aufgrund seiner schieren Größe als ein Unternehmen gilt, das „unmöglich scheitern kann“. Mit rund 3,4 Milliarden täglichen Nutzern auf seinen Plattformen und einem Quartalsgewinn von über 17 Milliarden Dollar verfügt der Konzern über eine Widerstandsfähigkeit und Ressourcen, die kein Startup aufbringen kann. Diese finanzielle und marktbeherrschende Macht ist Metas eigentliche Superkraft – eine Kraft, die auch dann wirkt, wenn die eigenen Produkte die Nutzer frustrieren. Denn während Milliarden in die Entwicklung fließen, kämpfen die User mit den bereits ausgerollten KI-Anwendungen: Chatbots, die aus dem Ruder laufen, oder die Flut an minderwertigem, KI-generiertem „Slop“, der Facebook und Instagram überschwemmt. Es ist der ultimative Ausdruck von Metas Macht: Selbst wenn die Innovation stockt und die Nutzererfahrung leidet, sorgt die schiere Größe dafür, dass das System weiterläuft. Ob sich damit aber auch die Zukunft der künstlichen Intelligenz erobern lässt, bleibt die alles entscheidende, offene Frage.