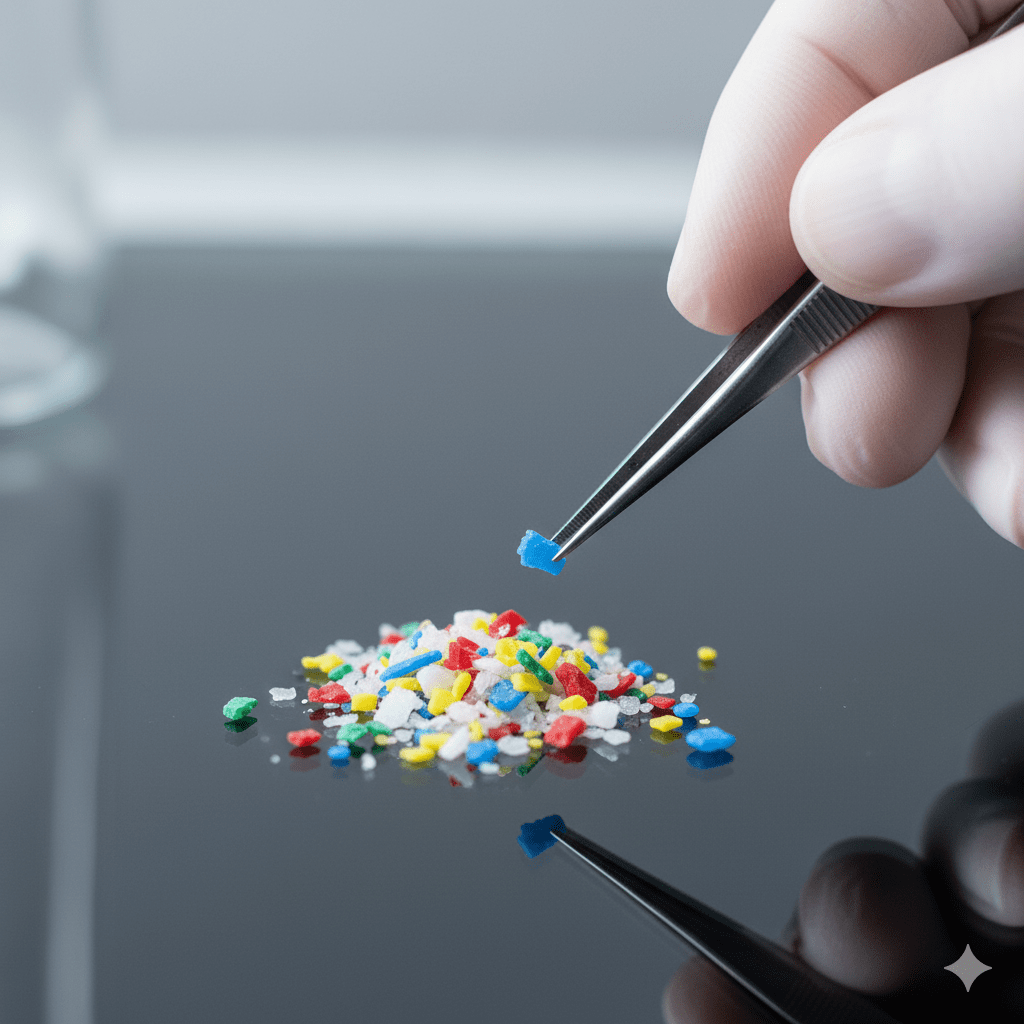Donald Trumps zweite Amtszeit markiert nicht nur eine politische Wende, sondern auch den konzertierten Versuch der MAGA-Bewegung, ihre kulturelle Identität in Washington und darüber hinaus zu definieren und durchzusetzen. Dieser Beitrag untersucht, wie die Bewegung versucht, eine distinkte kulturelle Sphäre zu schmieden – durch spezifische soziale Knotenpunkte, Modestatements und Medieninitiativen. Gleichzeitig kämpft sie mit internen Widersprüchen, der Ablehnung durch den Mainstream und der fundamentalen Frage nach ihrer Fähigkeit, effektiv zu regieren. Deutlich wird eine Entwicklung von der wahrgenommenen Isolation der ersten Amtszeit hin zu einer selbstbewussteren, sichtbareren kulturellen Präsenz, die jedoch weiterhin stark um die Person Trumps zentriert bleibt.
Butterworth’s: Der Salon der Neuen Rechten
Im Zentrum dieser kulturellen Selbstinszenierung steht das Restaurant Butterworth’s in Capitol Hill. Es fungiert nicht nur als Gaststätte, sondern als designierter sozialer und ideologischer Treffpunkt für die MAGA-Elite der zweiten Amtszeit. Beschrieben als „Hub of activity“ für Pro-Trump-Akteure und Medienfiguren und als „meeting place in the MAGA capital“, symbolisiert es einen neuen Anspruch auf Präsenz. Das Ambiente – eine Mischung aus französischem Bistro, englischer Lounge und New Orleans-Flair – mit gehobener Küche wie Knochenmark und Steak Tartare auf Vintage-Porzellan und teuren Weinen steht dabei in bewusstem Kontrast zu Trumps persönlichen Vorlieben für Hamburger und Cola Light, die hier bewusst nicht angeboten werden. Diese kuratierte Atmosphäre zieht eine spezifische Klientel an: politische Operateure wie FBI-Chef Kash Patel, Medienpersönlichkeiten wie Natalie Winters (War Room) und Raheem Kassam (Mitbesitzer, Ex-Breitbart UK), aber auch ideologische Vordenker wie Curtis Yarvin.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Dieser Treffpunkt markiert eine deutliche Abkehr von der ersten Amtszeit, die von sozialer Isolation im Trump Hotel und offener Feindseligkeit seitens der Washingtoner Bevölkerung geprägt war. Die Verlagerung nach Butterworth’s signalisiert ein neues Selbstverständnis: Man fühlt sich nicht mehr belagert, sondern etabliert, ja sogar akzeptiert – „Now, at least, [the residents] accept us. They have no choice“. Diese Entwicklung reflektiert eine breitere Dynamik innerhalb der Bewegung: den Versuch, über den reinen Protest hinaus kulturelle Räume zu besetzen und eine gewisse gesellschaftliche Normalität zu beanspruchen. Die Wahl eines Ortes mit gehobenem Anspruch könnte dabei als Versuch einer spezifischen Fraktion innerhalb von MAGA gewertet werden, sich von einem als krude empfundenen Image zu lösen und Anschlussfähigkeit an etabliertere Kreise zu signalisieren, auch wenn dies im Widerspruch zu den populistischen Wurzeln der Bewegung steht. Die Präsenz von Figuren wie Curtis Yarvin, einem Ideologen, der offen für die Abschaffung der Demokratie zugunsten eines CEO-Diktators plädiert, inmitten dieser scheinbar kultivierten Umgebung wirft jedoch Fragen auf. Seine Akzeptanz deutet darauf hin, dass radikale, anti-demokratische Ideen unter der Oberfläche gesellschaftsfähig geworden sind und im Herzen der sozialen Szene der Bewegung zirkulieren.

Mode als Manifest: Von „Make America Hot Again“ zum Anzug-Streit
Mode dient der MAGA-Bewegung als zentrales Instrument zur Identitätsstiftung und Abgrenzung. Die ikonische rote Kappe, patriotische Kleidung wie Flaggenkleider oder Outfits mit Trumps Namen und Gesicht signalisieren unmissverständlich die Zugehörigkeit. Der Slogan „Make America Hot Again“, popularisiert unter anderem durch das Lifestyle-Magazin The Conservateur, entstand als Reaktion auf eine als unattraktiv empfundene „Woke“-Kultur und versucht, eigene ästhetische Normen zu setzen. Die Verbreitung von Varianten wie „Make America Healthy/Gay/Cowboy Again“ zeigt die Adaptivität, aber auch die Beliebigkeit des Slogans. Diese modischen Ausdrucksformen stoßen jedoch auf Kritik: Von außen werden sie oft als „tacky“ oder „cringe“ verspottet, während intern konservative Stimmen warnen, der Fokus auf oberflächliche „Hotness“ sei „hohl“, „vulgär“ und verfehle das Ziel wahrer „Schönheit“.
Melania Trumps Garderobe bei der Amtseinführung 2025 – ein streng geschnittener marineblauer Anzug von Adam Lippes und ein markanter Hut von Eric Javits – signalisiert ebenfalls eine Verschiebung. Im Kontrast zum weicheren, an Jackie Kennedy erinnernden Look von 2017 wirkt der neue Stil „uniformartig“, „zurückhaltend“ und könnte eine diszipliniertere, vielleicht autoritärere Ästhetik widerspiegeln, die mit der Betonung traditioneller Geschlechterrollen durch die Administration korrespondiert. Die veränderte Berichterstattung von Vogue deutet zudem auf eine mögliche Neubewertung oder zumindest pragmatischere Haltung des Mode-Establishments hin. Wie sehr Kleidung zum Politikum wird, zeigte auch die Kontroverse um die Garderobe des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Oval Office im Vergleich zur legeren Kleidung von Elon Musk. Die Vorwürfe des doppelten Standards und die ausweichenden Antworten des Weißen Hauses illustrieren, wie Kleiderordnungen selektiv zur Demonstration von Macht, Loyalität und zur Delegitimierung von Gegnern eingesetzt werden.

Die Erschaffung einer Gegenkultur: Lifestyle-Magazine und Laufstege
Parallel zu politischen Manövern investiert die MAGA-Bewegung gezielt in den Aufbau eigener kultureller Institutionen, um eine „counter-cultural revival“ zu initiieren. Das digitale Magazin The Conservateur, gegründet von ehemaligen Fox News- und GOP-Mitarbeiterinnen, zielt darauf ab, konservativen Frauen, die sich von linken Mainstream-Publikationen entfremdet fühlen, eine Plattform für Mode, Lifestyle und Politik zu bieten. Mit Interviews prominenter konservativer Frauen und dem Verkauf von Merchandise wie „Make America Hot Again“-Kappen positioniert es sich als wichtiger Knotenpunkt im Ökosystem junger konservativer Stimmen. Ebenso zeugt die „America First Warehouse“ Modenschau in Long Island vom Bestreben, eigene Räume zu schaffen – hier als „safe space“ für Pro-Trump-Designer, die sich vom etablierten Modebetrieb ausgeschlossen fühlen. Die dort präsentierten, oft grellen und direkt politischen Designs stießen online jedoch auf breite Ablehnung und Spott.
Diese kulturellen Ambitionen stehen in einem Spannungsverhältnis zur Frage der Regierungsfähigkeit. Die in Kommentaren aufgeworfene Frage „Can MAGA Run the American Empire?“ gewinnt an Brisanz angesichts realpolitischer Entscheidungen wie der umstrittenen Zerschlagung der Entwicklungshilfebehörde USAID. Diese Maßnahme, angetrieben durch ideologische Blaupausen wie Project 2025 und Akteure wie Elon Musk, offenbart eine potenzielle Kluft zwischen dem polierten kulturellen Anspruch und der administrativen Realität. Die Umsetzung solcher radikaler Pläne, die explizit auf die Beseitigung als „woke“ empfundener Elemente wie DEI-Programme oder Klimastrategien abzielen, zeigt, wie der Kulturkampf als Motor für tiefgreifende administrative Veränderungen dient, deren praktische Konsequenzen jedoch Fragen nach der Kompetenz aufwerfen.

Trumps Schatten und die Zukunft der Bewegung
Donald Trump bleibt unangefochten das Zentrum und wichtigste Symbol der MAGA-Bewegung. Seine Anhängerschaft zeigt sich loyal, und Analysen vergleichen seine Basis mit einem Personenkult. Dennoch zeigen sich Anzeichen einer Institutionalisierung: Eigene Treffpunkte, Medien und ideologische Rahmenwerke wie Project 2025 entstehen. Figuren wie Vizepräsident J.D. Vance oder Ideologen wie Yarvin gewinnen an Einfluss. Die Bewegung scheint sich tiefer in der Republikanischen Partei zu verankern. Dies legt eine symbiotische Beziehung nahe: Trump liefert die charismatische Klammer, während die entstehenden Strukturen und Ideologien der Bewegung eine gewisse Resilienz auch über seine Person hinaus verleihen könnten, möglicherweise getragen von anderen Akteuren oder verankerten Agenden.
Konflikt und Koexistenz: MAGA vs. Mainstream
Der Kulturkampf zwischen der MAGA-Bewegung und der als liberal oder etabliert wahrgenommenen Gesellschaft bleibt ein zentrales Merkmal. Er äußert sich in der Ablehnung von Mainstream-Medien und akademischen Institutionen, der Ausgrenzung aus etablierten Kulturveranstaltungen und den oft polarisierten Reaktionen auf MAGA-Symbole im öffentlichen Raum. Die Selbstwahrnehmung der Bewegung als Vorkämpfer gegen korrupte Eliten und Bewahrer „amerikanischer Größe“ steht dabei im scharfen Kontrast zur externen Kritik, die ihr Autoritarismus, Spaltung und eine Bedrohung für demokratische Normen vorwirft. Diese performative Abgrenzung und der Zurschaustellen von Trotz scheinen dabei nicht nur Nebeneffekt, sondern ein konstituierendes Element der MAGA-Kultur selbst zu sein, das den inneren Zusammenhalt stärkt.
Fazit
Die kulturellen Ausdrucksformen der MAGA-Bewegung in Trumps zweiter Amtszeit zeigen ein komplexes Bild: Einerseits der Versuch, durch gehobene soziale Treffpunkte wie Butterworth’s, Lifestyle-Angebote wie The Conservateur und spezifische Modetrends eine eigene, ästhetisch anspruchsvolle Sphäre zu etablieren. Andererseits prägen weiterhin populistische Ressentiments, offene Provokation und eine ideologische Verhärtung, die sich in radikalen Politikentwürfen wie Project 2025 und der Akzeptanz extremer Figuren wie Yarvin manifestiert, das Bild. Die zentrale Spannung zwischen dem Streben nach kultureller Hegemonie und der teils chaotischen oder gar destruktiven Umsetzung politischer Ziele, wie bei der USAID-Demontage, bleibt ungelöst. Während Trump das unbestrittene Gravitationszentrum bildet, deuten die sich entwickelnden Strukturen und Ideologien darauf hin, dass die Bewegung versucht, sich über seine Person hinaus zu verstetigen. Ob dieser kulturelle Überbau jedoch eine tragfähige Basis für effektives Regieren darstellt oder primär der Mobilisierung und Abgrenzung dient, muss die weitere Entwicklung zeigen.