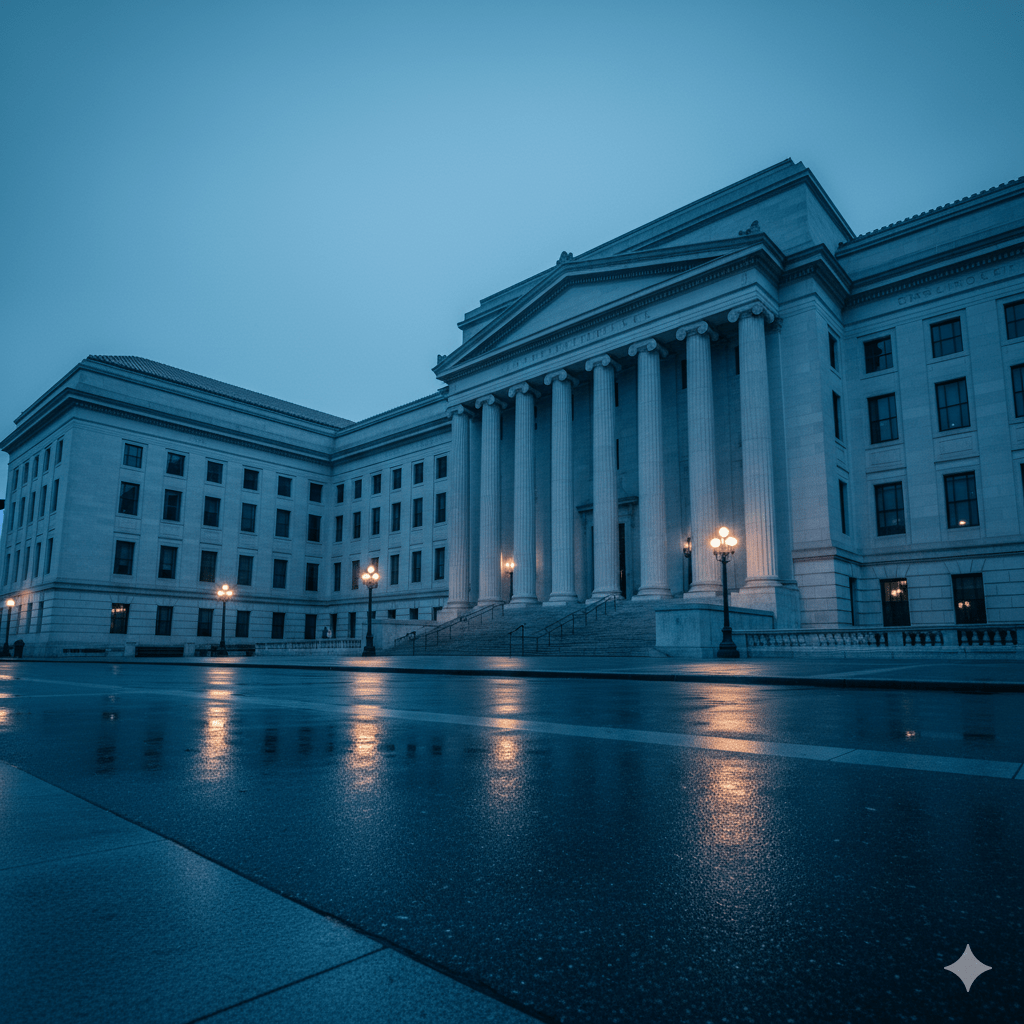Ein neuer ideologischer Grabenkrieg erschüttert die Demokratische Partei der USA. Unter dem Banner der „Abundance Agenda“ – einer Agenda des Überflusses – formiert sich eine Bewegung, die nicht weniger verspricht als die Neuerfindung staatlicher Effizienz und die Sicherung zukünftigen Wohlstands. Doch hinter den verheißungsvollen Zielen verbirgt sich ein fundamentaler Konflikt über Macht, Einfluss und die zukünftige Ausrichtung der Partei. Die Agenda fordert etablierte progressive Aktivistengruppen heraus und stellt deren jahrzehntelang gewachsenen Einfluss auf die Politikgestaltung in Frage, was eine erbitterte Debatte über die wahren Triebfedern und Architekten des Fortschritts entfacht hat. Es ist ein Kampf, der die Partei zu zerreißen droht.
Die Wurzeln der Frustration: Warum „Mehr vom Gleichen“ nicht mehr reicht
Der Nährboden für die „Abundance Agenda“ ist eine tiefsitzende Ernüchterung über die Handlungsfähigkeit des Staates. Deutlich wurde dies nach der Verabschiedung eines Billionen-Dollar-Infrastrukturpakets durch die Biden-Administration. Präsident Biden verkündete vollmundig, man habe bewiesen, dass die Demokratie noch funktioniere. Doch Monate und Jahre später war von den versprochenen sichtbaren Veränderungen wenig zu spüren. Ein Großteil der Gelder floss nur langsam ab, konkrete Ergebnisse ließen auf sich warten. Das landesweite Netz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge umfasste bis zum Ende von Bidens Amtszeit magere 58 neue Stationen, und der Ausbau des Breitbandnetzes in ländlichen Regionen hatte noch keinen einzigen Kunden erreicht. Diese Erfahrung spiegelte auf bittere Weise die Erlebnisse Barack Obamas wider, der bei seinem Versuch, die Rezession mit öffentlichen Bauprojekten zu bekämpfen, feststellen musste, dass es so etwas wie „schaufelfertige Projekte“ kaum gab.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Diese wiederholten Enttäuschungen führten zu einer Phase der Introspektion, insbesondere unter liberalen Politikexperten. Die drängende Frage: Wie konnte eine Regierung, die einst technische Wunderwerke wie den Hoover Dam oder die Golden Gate Bridge termingerecht und im Budgetrahmen realisierte, nun an Routineaufgaben scheitern? Warum dauerte die Implementierung des Affordable Care Act Jahre, während Medicare einst in weniger als einem Jahr verfügbar war? Und besonders beunruhigend: Warum schienen Projekte in von Demokraten regierten Bundesstaaten und Städten oft langsamer, teurer und dysfunktionaler zu sein? Aus diesen Fragen erwuchs die Erkenntnis, dass sich der Staat in einem selbstgestrickten Netz aus Vorschriften verfangen hat und dass eine Entfesselung von Wohlstand durch dessen Entwirrung möglich sein könnte.
Das Drei-Säulen-Modell der „Abundance Agenda“: Ein Frontalangriff auf den Status Quo
Die „Abundance Agenda“, ein Begriff, der maßgeblich vom Journalisten Derek Thompson geprägt wurde, stützt sich im Wesentlichen auf drei Reformbereiche. Erstens, und am bekanntesten, ist die Forderung nach einer massiven Ausweitung des Wohnungsangebots. Dies soll durch die Beseitigung restriktiver Bebauungsvorschriften und anderer legaler Hürden erreicht werden, die seit Jahrzehnten, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, den Neubau in amerikanischen Städten strangulieren. So wären beispielsweise rund 40 Prozent der existierenden Gebäude in Manhattan heute illegal zu errichten. Ähnliche Probleme plagen Metropolen wie San Francisco, Los Angeles oder Boston.
Der zweite Schwerpunkt liegt auf dem radikalen Rückbau jenes Geflechts aus Gesetzen und Regulierungen, das Infrastrukturprojekte zu teuren und langwierigen Alpträumen macht. Die Kosten für den Bau einer Meile Interstate-Highway haben sich innerhalb einer Generation verdreifacht. Das kalifornische Hochgeschwindigkeitszugprojekt zwischen Los Angeles und San Francisco, vor 17 Jahren genehmigt, hat trotz Milliardenausgaben noch keinen Meter nutzbare Strecke vorzuweisen. Genehmigungsverfahren, die insbesondere den Ausbau grüner Energien massiv verlangsamen, stehen hier im Fokus.
Die dritte, oft weniger beachtete Säule, zielt auf die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Staates selbst – ein Konzept, das als „state capacity“ bezeichnet wird. Die Regierung, insbesondere auf Bundesebene, ist durch ein Dickicht an Regeln gelähmt, das proaktives Handeln erschwert und es gleichzeitig einfach macht, staatliche Vorhaben durch Klagen zu blockieren. Die „Abundance Agenda“ strebt hier eine Art „Deregulierung der Regierung“ an, um sie wieder handlungsfähig zu machen. Bezeichnenderweise agiert der Staat dann am schnellsten und effektivsten, wenn er seine eigenen Standardprozeduren umgeht oder ignoriert. Beispiele hierfür sind die schnelle Reaktion von Forschern in Seattle zu Beginn der COVID-Pandemie, die Regeln missachteten, um Tests durchzuführen, die Operation Warp Speed zur Impfstoffentwicklung oder der beschleunigte Wiederaufbau einer Interstate-Brücke in Pennsylvania durch Gouverneur Josh Shapiro, der dafür bürokratische Hürden aussetzte. Die Tatsache, dass wichtige Vorhaben nur durch Regelbruch gelingen, wirft die fundamentale Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Regeln im Normalbetrieb auf.
Der historische Ballast: Wie gut gemeinter Aktivismus zur Fortschrittsbremse wurde
Man könnte meinen, dass solche Vorschläge, die auf Effizienz und Fortschritt abzielen, insbesondere bei den Demokraten auf offene Ohren stoßen würden. Doch die Realität ist komplexer, denn viele der kritisierten Beschränkungen wurden einst von der Linken selbst initiiert und sind tief in der Interessengruppenpolitik verankert, die die Partei seit über einem halben Jahrhundert prägt. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Errungenschaften des New Deal zementiert schienen, richteten viele Liberale ihren Fokus neu aus. Es ging nun darum, die Macht des Staates und seiner Verbündeten in der Großindustrie und den Gewerkschaften zu kontrollieren, um die Bürger vor Übergriffen zu schützen. Visionäre wie Rachel Carson, Jane Jacobs und Ralph Nader prägten diese neue, eher staatskritische Form des Liberalismus.
Diese Bewegung, die der Historiker Paul Sabin als „legalen Angriff von Liberalen auf den Verwaltungsstaat der Nachkriegszeit“ beschreibt, setzte stark auf Anwälte und Klagen. Ralph Nader, der zum Symbol des Verbraucherschutzes und des Misstrauens gegenüber dem Establishment avancierte, propagierte die Rolle des „professionellen Bürgers“, der, juristisch bewandert, staatliches Handeln kritisch hinterfragt und zur Rechenschaft zieht. Parallel dazu entstand ein riesiges Netzwerk von Bürgerinitiativen, die sich einzelnen Sachthemen widmeten, ganz im Sinne des Port Huron Statements von 1962. Diese Gruppen erzielten unbestreitbare Erfolge, etwa im Umwelt- und Verbraucherschutz. Doch ihre Fixierung auf juristische Verfahren und komplexe rechtliche Anforderungen – was der Rechtsprofessor Nicholas Bagley als „Prozedurenfetischismus“ bezeichnet – führte im Laufe der Zeit zu einer Pervertierung der ursprünglichen Ziele. Statt Schaden durch den Staat zu verhindern, wurde oft jegliches staatliches Handeln unmöglich gemacht.
Das National Environmental Policy Act (NEPA) von 1969 ist hierfür ein Paradebeispiel. Ursprünglich gedacht, um Umweltverträglichkeitsprüfungen vor Großprojekten zu erzwingen, wurde es von Aktivistengruppen durch aggressive Klagen zu einer scharfen Waffe gegen jegliche Form von Entwicklung ausgebaut. Umweltverträglichkeitsstudien blähten sich von wenigen Seiten auf hunderte auf, der Prozess dauert heute im Schnitt über vier Jahre. Das Perverse daran: NEPA und ähnliche Gesetze behindern heute massiv den Kampf gegen den Klimawandel. Denn der erfordert den Bau neuer Infrastruktur – von grünen Energiequellen über Stromtrassen bis hin zu verdichtetem Wohnraum in Städten. Viele Umweltgruppen halten jedoch an ihrem grundsätzlichen Widerstand gegen Bauprojekte fest und verteidigen Gesetze, die den Status quo zementieren.
Machtkampf im Progressiven Lager: Wer bestimmt die Zukunft der Demokraten?
Diese tiefgreifenden Differenzen traten deutlich zutage, als nach der Verabschiedung des Inflation Reduction Act, Bidens zentralem Klimagesetz, klar wurde, dass die vorgesehenen Milliarden für grüne Energieinfrastruktur aufgrund rechtlicher Hürden nicht zeitnah fließen würden. Moderate Demokraten versuchten, mit Unterstützung der Biden-Regierung, eine Reform der Genehmigungsverfahren durchzusetzen. Diese sah eine Zweijahresfrist für Umweltprüfungen vor und sollte der Bundesregierung die Planung von Übertragungsleitungen ermöglichen. Doch hunderte Umweltgruppen und viele progressive Politiker stellten sich quer. Sie befürchteten eine Aushöhlung von Umweltprüfungen und eine Schwächung der Mitspracherechte von betroffenen Gemeinden und indigenen Gruppen. Als die Reform im Kongress scheiterte, feierten Progressive dies als Sieg für Klima und Umwelt, während moderate Demokraten ihre Enttäuschung kaum verbargen.
Hier offenbart sich der Kern des Konflikts: Die progressive Aktivistenszene, in der Tradition der Nader-Bewegung, sieht die Stärkung von lokalen Gruppen und deren Klagerechten als Schlüssel zu gesellschaftlicher Veränderung. Christy Goldfuss vom Natural Resources Defense Council erklärte den Widerstand gegen die Genehmigungsreform mit der Notwendigkeit „bedeutsamer lokaler Beteiligung“. Ähnlich argumentieren Wohnungsaktivisten, die in der Blockademacht lokaler Initiativen den Weg zu mehr Wohnungsgerechtigkeit sehen. Die „Abundance Agenda“ steht dem diametral entgegen: Sie argumentiert, dass eben jene organisierten Bürgerinitiativen oft kontraproduktiv wirken und ihre Macht beschnitten werden muss, um Fortschritt zu ermöglichen.
Diese Sichtweise wird von vielen Linken nicht nur als unzureichend, sondern als grundlegend falsch abgelehnt. Anthony Rogers-Wright, damals bei den New York Lawyers for the Public Interest, warnte, eine Genehmigungsreform würde vor allem Minderheiten die Möglichkeit nehmen, sich gerichtlich gegen schädliche Projekte zu wehren. Das progressive Roosevelt Institute schlug sogar vor, Gruppen zu subventionieren, die gegen neue Solaranlagen kämpfen. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Stärkung solcher Aktivistengruppen eine wichtige demokratische Funktion erfüllt und Macht für die Linke aufbaut. Kritiker wie David Dayen vom Magazin The American Prospect sehen in der „Abundance Agenda“ einen Angriff auf demokratische Grundrechte und das Vertrauen in die Bürger. Die harsche Kritik speist sich auch aus dem Vorwurf des Solidaritätsbruchs innerhalb der progressiven Koalition, in der erwartet wird, dass sich die verschiedenen Gruppen gegenseitig in ihren Kernforderungen unterstützen.
Eine neue Vision für die Demokraten – oder der nächste Sprengsatz?
Die „Abundance Agenda“ hat das Potenzial, zur zentralen Programmatik des moderaten Flügels der Demokratischen Partei zu werden, gerade weil sie die Macht der etablierten Interessengruppen herausfordert. Sie könnte moderaten Demokraten eine positive Identität jenseits von „Progressiv light“ verleihen und einen Ausweg aus der Dynamik bieten, bei der Kandidaten sich gezwungen sehen, auch die extremsten und politisch toxischsten Forderungen einzelner Gruppen zu unterstützen, wie es in den Vorwahlen 2020 der Fall war. Erste Anzeichen für diese Entwicklung sind auf nationaler Ebene sichtbar. Politiker wie Pete Buttigieg, die Gouverneure Kathy Hochul und Josh Shapiro sowie Abgeordnete wie Ritchie Torres identifizieren sich zunehmend mit der Agenda. Torres, bekannt für seine kritische Haltung zum linken Parteiflügel in anderen Fragen, nannte die Agenda den „besten Rahmen für eine Neuausrichtung demokratischer Regierungsführung“.
Obwohl die „Abundance Agenda“ nicht als Wahlkampfstrategie entwickelt wurde, sondern aus der Arbeit von Politikexperten stammt, adressiert sie drängende politische Bedürfnisse: das schwindende Vertrauen in öffentliche Dienstleistungen, die Sorge um hohe Lebenshaltungskosten und die Notwendigkeit, den Lebensstandard zu verbessern in Zeiten hoher Inflation und Verschuldung. Sie bietet eine Vision, die sich klar von Donald Trumps Politik des Protektionismus, der Suburbanisierungsideologie, der Wissenschaftsfeindlichkeit und der Lähmung der Bürokratie abhebt. Angesichts von Trumps Behauptung, nur er allein könne das marode System reparieren, stehen die Demokraten vor einer Zerreißprobe: Festhalten an einem legalistischen Prozeduralismus, der oft Fortschritt blockiert, oder den Mut zu Reformen, die den Staat wieder handlungsfähig machen – und damit Trumps Erzählung Lügen strafen. Die Antwort auf diese Frage wird die Zukunft der Partei maßgeblich bestimmen.