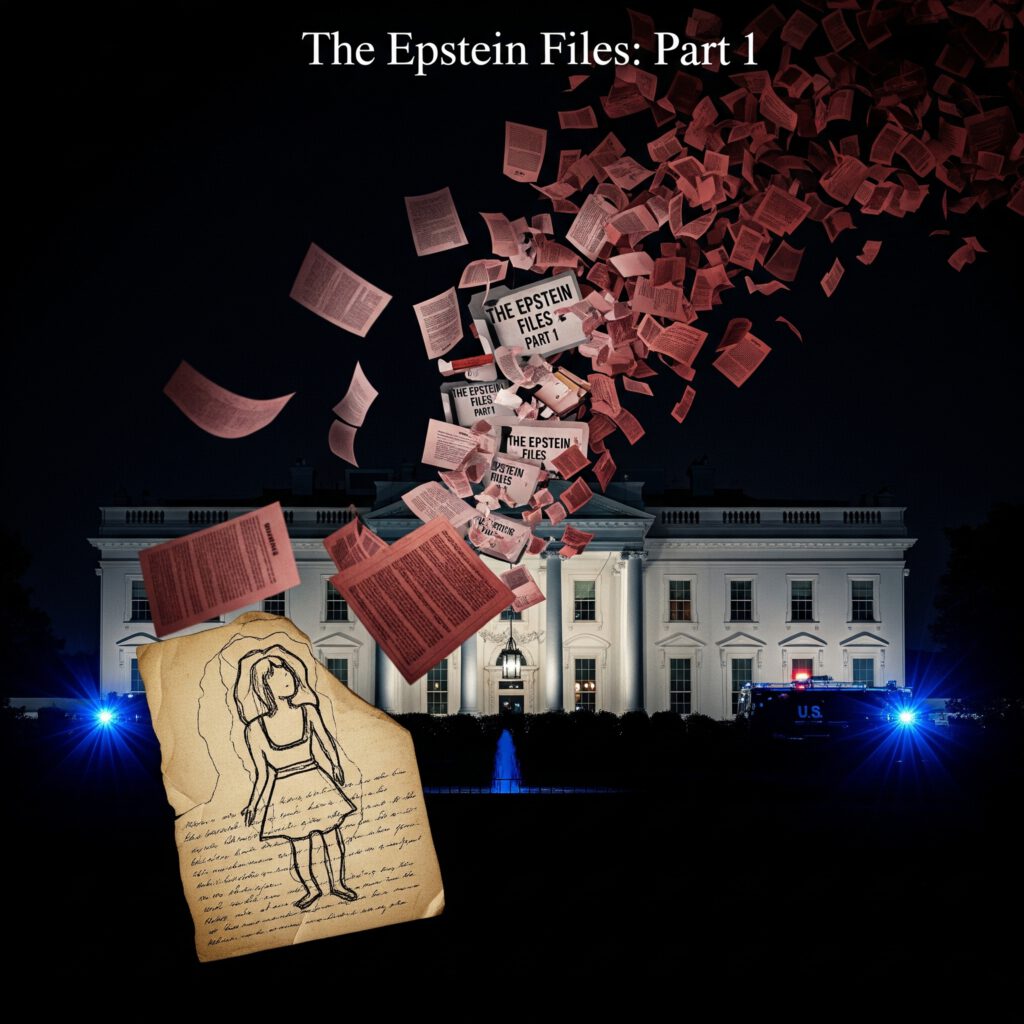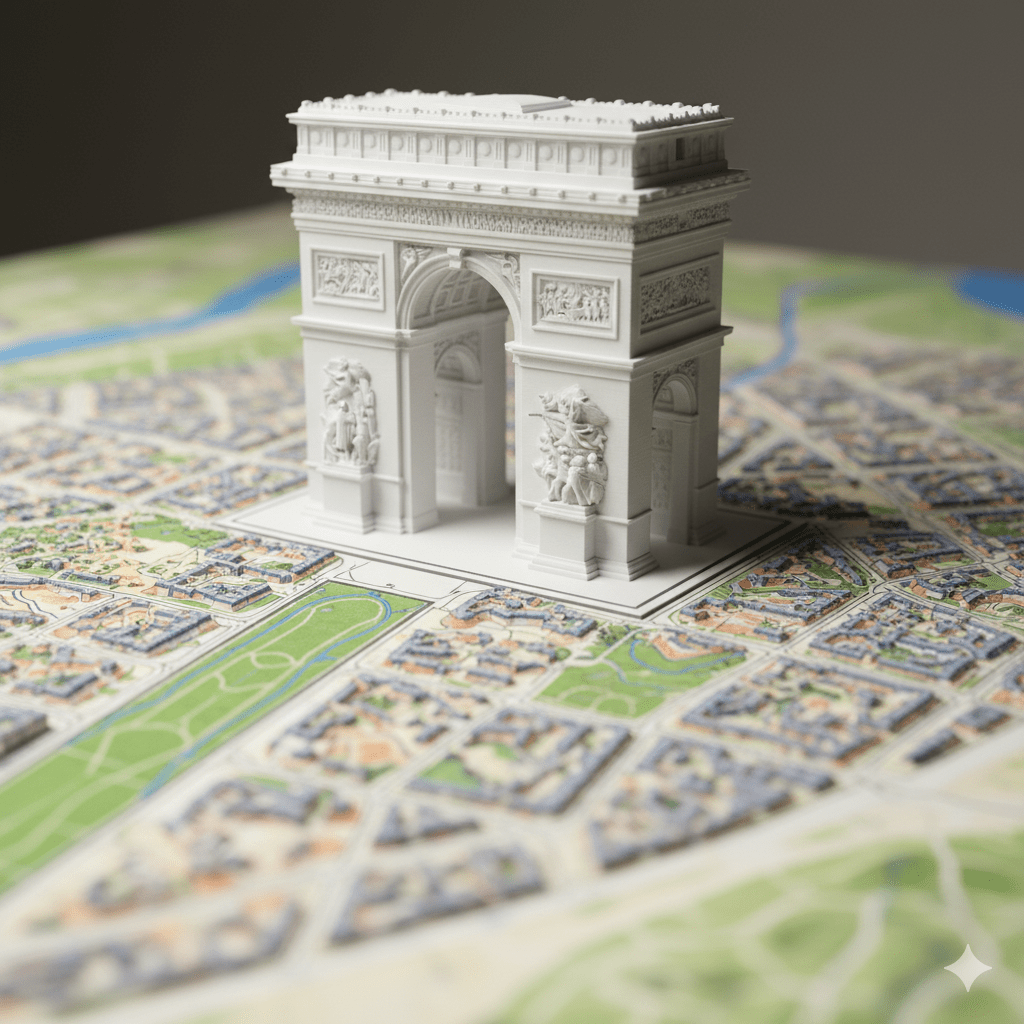Es war ein politisches Desaster mit Ansage, eine Tragödie, deren Drehbuch über Monate und Jahre geschrieben wurde – von den engsten Vertrauten, der eigenen Familie und einem Präsidenten, der seine größte Stärke, seine Fähigkeit, nach Schicksalsschlägen wieder aufzustehen, in seine größte Schwäche verkehrte. Die Präsidentschaft von Joe Biden, angetreten mit dem Versprechen, die Seele der Nation zu heilen und Donald Trump zu stoppen, endete in einem Scherbenhaufen aus Leugnung, Vertuschung und persönlicher Hybris. Sein Festhalten an der Macht, getragen von einem kleinen Zirkel, der die Realität aktiv verbog, führte nicht nur zu einer der verheerendsten Fernsehdebatten der amerikanischen Geschichte, sondern ebnete am Ende genau dem Mann den Weg zurück ins Weiße Haus, den zu verhindern Bidens erklärte Mission gewesen war. Dies ist die Anatomie einer selbstverschuldeten Niederlage, ein Lehrstück über die korrumpierende Kraft der Macht und die fatalen Folgen von Gruppendenken an der Spitze der westlichen Welt.
‘Steh auf!’ – Die Mythologie eines Überlebenskünstlers als politische Falle
Um das Drama um Joe Bidens letzte Amtsjahre zu verstehen, muss man tief in die persönliche Mythologie des Mannes eintauchen. Sein Leben war geprägt von schweren Schicksalsschlägen: dem frühen Tod seiner ersten Frau und Tochter, eigenen lebensbedrohlichen Aneurysmen, dem Scheitern früherer Präsidentschaftskampagnen und dem tragischen Krebstod seines Sohnes Beau. Aus jeder dieser Krisen zog Biden eine zentrale Lehre, ein Mantra, das ihm sein Vater eingeimpft hatte: „Steh auf!“. Diese Fähigkeit, sich nach jedem Niederschlag wieder aufzurappeln, wurde zum Kern seiner politischen Identität. Für ihn und seine Familie wurde dieser Überlebenswille zu einer Art säkularem Glaubenssatz: Joe Biden überwindet alle Widerstände.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Diese zutiefst menschliche und bewundernswerte Resilienz wurde jedoch zur politischen Achillesferse, als sie auf eine unüberwindbare Realität traf: den unaufhaltsamen Prozess des Alterns. Der Glaube, auch diese Hürde meistern zu können, ließ im innersten Zirkel eine fast religiöse Überzeugung entstehen, die keinen Zweifel duldete. Wer Bedenken äußerte, verstand die „Biden-Glaubenslehre“ nicht. Doch genau dieser Glaube an die eigene Unbesiegbarkeit bildete das Fundament für die Entscheidung, mit über 80 Jahren für eine zweite Amtszeit zu kandidieren – eine Entscheidung, die von Beobachtern als narzisstisch und rücksichtslos beschrieben wurde. Die persönliche Mythologie, einst Quelle der Stärke, wurde zur politischen Falle.
Das Politbüro der Leugnung: Wie ein eiserner Kreis die Realität verbog
Im Zentrum dieser politischen Tragödie stand ein kleiner, eingeschworener Kreis, der im Weißen Haus die Fäden zog. Intern als das „Politbüro“ bezeichnet, bestand dieser Zirkel aus langjährigen Weggefährten wie Mike Donilon, Steve Ricchetti und Bruce Reed, die Biden seit Jahrzehnten dienten. Ergänzt wurde diese Gruppe durch mächtige Figuren wie Anita Dunn und ihren Ehemann Bob Bauer sowie einen noch engeren Kreis, zu dem First Lady Jill Biden, Sohn Hunter und die loyalen Mitarbeiter Anthony Bernal und Annie Tomasini zählten. Ihre Loyalität galt weniger dem Amt des Präsidenten oder dem amerikanischen Volk, sondern primär der Familie Biden und deren politischem Überleben.
Dieser innere Zirkel funktionierte wie eine Echokammer, in der die Realität des präsidentialen Verfalls nicht nur ignoriert, sondern aktiv bekämpft wurde. Bedenken, selbst von hochrangigen Beratern wie Anita Dunn, wurden von den Hardlinern wie Donilon und Bernal abgebügelt. Die Devise war klar: Der Präsident hat das Recht zu kandidieren, er hat Trump bereits einmal besiegt, und es gibt keine Alternative. Dieses Narrativ wurde mit einer Vehemenz verteidigt, die keine abweichende Meinung zuließ. Mitarbeiter, die den Verfall beobachteten, wurden isoliert oder zum Schweigen gebracht. Ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter gestand, man habe versucht, den Präsidenten sogar vor dem eigenen Stab abzuschirmen, sodass vielen das volle Ausmaß des Verfalls, der 2023 einsetzte, nicht bewusst war. Diese Abschottung schuf eine alternative Wirklichkeit, in der jede kritische Beobachtung als Angriff von außen oder als Illoyalität interpretiert wurde.
Die schleichende Erosion: Frühe Warnzeichen und der trügerische Corona-Kokon
Der kognitive und physische Verfall Joe Bidens war kein plötzliches Ereignis, das erst mit der Debatte im Juni 2024 für alle sichtbar wurde. Die Risse in der Fassade zeigten sich schon Jahre früher. Bereits während des Vorwahlkampfs 2020 gab es Momente, die sein Team alarmierten: Biden vergaß den Namen seines langjährigen Beraters Mike Donilon oder wirkte in Debatten fahrig und unsicher. Seine Auftritte waren inkonsistent; auf kraftvolle Momente folgten Reden, in denen er den Faden verlor und die seine eigenen Leute als peinlich empfanden.
Ironischerweise wurde die Corona-Pandemie für Bidens Kampagne zum größten Glücksfall. Der Lockdown ermöglichte es, den Kandidaten in einen „Corona-Kokon“ zurückzuziehen. Anstrengende Reisen und unkontrollierte öffentliche Auftritte entfielen; der Wahlkampf wurde aus dem Homeoffice geführt. Öffentliche Termine wurden bevorzugt auf den Nachmittag gelegt, wenn Biden am leistungsfähigsten war. Doch selbst unter diesen kontrollierten Bedingungen traten die Probleme zutage. Bei der Vorbereitung für den virtuellen Parteitag 2020 war das ungeschnittene Videomaterial seiner Gespräche mit Bürgern so alarmierend – ein führender Demokrat beschrieb es als „schrecklich“ –, dass Spezialisten engagiert werden mussten, um wenige vorzeigbare Minuten daraus zu montieren. Ein Beteiligter war so schockiert, dass er sich nicht mehr vorstellen konnte, dass Biden Präsident sein könnte, und bezeichnete das Vorgehen des Teams als „Gaslighting“. Die Pandemie hatte dem Team somit nicht nur eine logistische Erleichterung verschafft, sondern auch eine perfekte Ausrede, die wahren Probleme zu kaschieren und eine frühe, ehrliche Auseinandersetzung mit Bidens Zustand zu verhindern.
Die Festung Weißes Haus: Strategien der systematischen Verschleierung
Nach dem Einzug ins Weiße Haus wurde die Abschirmung des Präsidenten zu einer systematischen Operation. Ein ganzes Arsenal an Strategien wurde entwickelt, um die schwindenden Kräfte Bidens zu managen und vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Der Terminkalender des Präsidenten wurde drastisch eingeschränkt. Öffentliche Auftritte fanden vorwiegend an Wochentagen zwischen 10 und 16 Uhr statt, während Morgen-, Abend- und Wochenendtermine zur Seltenheit wurden. Interviews und Pressekonferenzen wurden auf ein historisches Minimum reduziert, um unkontrollierte Situationen zu vermeiden. Ein Berater gab zu, dass ein Interview, das 2022 noch möglich war, nur ein Jahr später für Biden unmöglich zu bewältigen gewesen wäre.
Intern wurde die Kommunikation bis ins Detail geskriptet. Selbst bei Kabinettssitzungen ohne Presse stützte sich Biden stark auf Notizkarten. Die Fragen wurden im Voraus bei den Ministerien eingeholt, um die Antworten vorzubereiten, was ein Minister als „schrecklich und unangenehm“ beschrieb. Die Redenschreiber passten sich ebenfalls an: Reden, Absätze und sogar Sätze wurden kürzer, das Vokabular schrumpfte. Für Videoaufnahmen wurden zwei Kameras eingesetzt, um Patzer durch einen Schnitt kaschieren zu können; manchmal wurde das Material sogar verlangsamt, um Bidens Bewegungen flüssiger erscheinen zu lassen. Nach dem Sturz über einen Sandsack bei der Air Force Academy im Juni 2023 wurden die Sicherheitsvorkehrungen nochmals verschärft: kürzeste Wege zur Bühne, Handläufe an allen Treppen und das Tragen von bequemen HOKA-Tennisschuhen statt Anzugschuhen wurden zur Regel. Diese Mechanismen waren mehr als nur altersgerechte Anpassungen; sie waren Teil einer konzertierten Aktion, ein Bild von Stärke und Kompetenz aufrechtzuerhalten, das mit der Realität hinter den Kulissen immer weniger zu tun hatte.
Der Faktor Hunter: Eine Familientragödie als ständige Belastung
Die politischen Herausforderungen wurden durch eine zutiefst persönliche und öffentliche Familientragödie permanent überlagert: die Skandale um seinen Sohn Hunter. Dessen Kampf mit der Drogensucht, seine dubiosen Geschäftsbeziehungen und die juristischen Verwicklungen waren nicht nur ein gefundenes Fressen für die politische Opposition, sondern auch eine immense emotionale Belastung für den Präsidenten. Einige Vertraute sehen in den Krisen um Hunter, insbesondere im Platzen seines Deals mit der Staatsanwaltschaft im Juli 2023 und seiner späteren Verurteilung, entscheidende Momente, die Bidens eigenen Verfall beschleunigten.
Die Angst, nach Beau ein weiteres Kind zu verlieren, zermürbte den Präsidenten. Hunter, der sich von seinen politischen Gegnern verfolgt fühlte, übte zusätzlich Druck auf das Weiße Haus aus und forderte mehr Schutz. Diese toxische Familiendynamik, die auf einer tiefen, verständlichen Vaterliebe, aber auch auf einer Leugnung unschöner Wahrheiten basierte, hatte weitreichende Konsequenzen. Die Entscheidung, die Existenz seiner Enkelin Navy Joan Roberts jahrelang zu ignorieren, weil Hunter dies forderte, ist ein beklemmendes Beispiel für dieses Muster. Die schlussendliche, umfassende Begnadigung Hunters und weiterer Familienmitglieder wurde von vielen selbst im eigenen Lager als Akt gesehen, der die Interessen der Familie über die politischen Normen und das Versprechen einer unabhängigen Justiz stellte.
Die „Kamala-Ausrede“: Misstrauen als Rechtfertigung für das Festhalten an der Macht
Innerhalb des Biden-Lagers diente ein Argument als zentrale Rechtfertigung dafür, warum der Präsident trotz allem erneut antreten müsse: die angebliche Schwäche seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. Obwohl Biden sie selbst ausgewählt hatte, herrschte in seinem engsten Kreis ein tiefes Misstrauen gegenüber ihren Fähigkeiten, eine Wahl zu gewinnen. Jede Diskussion über einen möglichen Rückzug Bidens wurde mit der Frage gekontert: „Wer soll es denn sonst machen?“. Die Befürchtung, Harris könne die Nominierung nicht für sich entscheiden oder würde gegen Trump verlieren, wurde zur selbsterfüllenden Prophezeiung und zur ultimativen Ausrede, den angeschlagenen Präsidenten im Rennen zu halten.
Dieses Misstrauen führte zu einer dysfunktionalen Dynamik im Weißen Haus. Harris‘ Team hatte das Gefühl, man würde ihr politisch toxische Aufgaben wie die Einwanderungspolitik zuschieben und ihr gleichzeitig die Unterstützung für einen eigenen Profilierungsprozess verweigern. Harris selbst agierte aus Angst, als illoyal zu gelten, extrem vorsichtig und vermied es, aus dem Schatten Bidens zu treten. So wurde die Vizepräsidentin, die eigentlich als natürliche Nachfolgerin hätte aufgebaut werden müssen, zu einem weiteren Grund, warum das System Biden alternativlos erschien. Die „Kamala-Ausrede“ war somit weniger eine objektive Analyse als vielmehr ein Instrument der Machterhaltung für den inneren Zirkel.
Der Hur-Report: Als die Leugnung auf die juristische Realität traf
Wenn es einen Moment gab, in dem die private Realität von Bidens Zustand mit unabweisbarer Wucht in die öffentliche Sphäre einbrach, dann war es die Veröffentlichung des Berichts von Sonderermittler Robert Hur im Februar 2024. Hur, der Bidens Umgang mit geheimen Dokumenten untersuchte, kam zwar zum Schluss, keine Anklage zu erheben, doch seine Begründung war politisch Sprengstoff. Er beschrieb Biden als einen „sympathischen, freundlichen älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis“. Der Bericht dokumentierte detailliert, dass Biden sich schon 2017 nicht an wichtige Daten erinnern konnte, etwa wann sein Sohn Beau gestorben war oder wann seine eigene Vizepräsidentschaft endete.
Die Reaktion des Weißen Hauses war ein Paradebeispiel für die etablierte Strategie der Leugnung und des Angriffs. Anstatt sich mit den Fakten auseinanderzusetzen, attackierte man Hur persönlich, warf ihm politische Motive vor und bezeichnete seine zutreffenden Beobachtungen als „unnötig“ und „unangebracht“. In einer Pressekonferenz, die die Situation nur verschlimmerte, verwechselte Biden den ägyptischen Präsidenten al-Sisi mit dem mexikanischen Präsidenten und reagierte gereizt auf Fragen zu seinem Gedächtnis. Der Hur-Report und die Reaktion darauf machten die Diskrepanz zwischen der offiziellen Darstellung und der Realität unüberbrückbar. Die Weigerung, einen kognitiven Test durchzuführen, wurde nun für viele zum endgültigen Beweis, dass das Weiße Haus etwas zu verbergen hatte.
Das Schweigen der Partei: Zwischen Loyalität, Angst und strategischem Kalkül
Eine der zentralen Fragen dieses politischen Dramas ist, warum so viele hochrangige Demokraten monatelang schwiegen, obwohl sie hinter vorgehaltener Hand ihre tiefste Besorgnis äußerten. Von Senatoren wie Chuck Schumer und Mark Warner über Gouverneure wie Gretchen Whitmer bis hin zur ehemaligen Sprecherin Nancy Pelosi – sie alle sahen den Verfall, doch kaum jemand wagte den öffentlichen Bruch. Die Gründe dafür waren vielfältig und komplex.
Zum einen spielte die tiefsitzende Angst vor einer zweiten Trump-Präsidentschaft eine entscheidende Rolle. Viele rechtfertigten ihr Schweigen mit dem Argument, eine öffentliche Debatte über Bidens Zustand würde nur Trump in die Hände spielen. Zum anderen verhinderte die Macht des amtierenden Präsidenten und seines loyalen Apparats einen offenen Vorwahlprozess. Potenzielle Herausforderer wie Gavin Newsom oder JB Pritzker wurden abgeschreckt, da sie fürchteten, als Parias gebrandmarkt zu werden, sollte Biden die Wahl doch verlieren. Der Kongressabgeordnete Dean Phillips, der als einer der wenigen den offenen Wettbewerb forderte, wurde von der Parteimaschinerie marginalisiert und als Störenfried behandelt. Das Weiße Haus gestaltete den Vorwahlkalender sogar aktiv um, um Biden einen leichten Sieg in South Carolina zu sichern und potenzielle frühe Niederlagen zu vermeiden. Es war eine Mischung aus strategischem Kalkül, Respekt vor dem Amt, persönlicher Loyalität und schlichter politischer Feigheit, die die Partei in einen Zustand der Lähmung versetzte.
Alarmrufe von außen: Wenn Hollywood die Wahrheit deutlicher sieht
Während die politische Blase in Washington in einem Zustand der strategischen Verleugnung verharrte, kam der schärfste Alarm von außen. Großspender und einflussreiche Persönlichkeiten wie der Hollywood-Mogul Ari Emanuel oder der Schauspieler George Clooney, die Biden nach längerer Zeit wiedertrafen, waren zutiefst schockiert. Ihre Begegnungen waren keine „Frösche im langsam kochenden Wasser“; sie sahen den Verfall mit frischen Augen.
Bei einer Spendenveranstaltung im Juni 2024 erkannte Biden George Clooney, einen Freund und Gastgeber des Abends, zunächst nicht wieder. Der Präsident wirkte fahrig, seine Bewegungen waren kleine Trippelschritte, und sein Blick schien leer. Clooney war so erschüttert, dass er später in einem öffentlichen Meinungsartikel Bidens Rückzug forderte und schrieb, der Mann, den er getroffen habe, sei nicht mehr der Joe Biden von früher gewesen. Ari Emanuel konfrontierte Bidens ehemalige Berater öffentlich und warf dem inneren Zirkel wütend vor, das Land und die Demokratie durch ihre Lügen zu gefährden. Diese Stimmen von außen verliehen den internen Sorgen eine neue Dringlichkeit, doch selbst sie konnten die Mauern des Weißen Hauses zunächst nicht durchbrechen.
Die Debatte: Der unvermeidliche Kollaps einer brüchigen Fassade
Die Fernsehdebatte am 27. Juni 2024 war der Moment, in dem die sorgfältig konstruierte Fassade in sich zusammenbrach – vor den Augen von Millionen von Zuschauern. Es war, wie viele Insider später zugaben, kein plötzlicher Aussetzer, sondern die logische und fast unvermeidliche Konsequenz des monatelangen Verfalls. Biden betrat die Bühne mit einem steifen, schlurfenden Gang, seine Stimme war rau und schwach. Schon in den ersten Minuten verlor er mehrmals den Faden, verstummte, stammelte unverständliche Laute und formulierte Sätze, die kaum Sinn ergaben.
Sein Gegner Donald Trump musste nicht einmal aggressiv sein; er stellte lediglich fest: „Ich weiß wirklich nicht, was er am Ende seines Satzes gesagt hat. Ich glaube, er weiß es selbst nicht“. Dieser Satz fasste den Abend perfekt zusammen. Der geteilte Bildschirm war unbarmherzig: Er zeigte einen blassen, erschöpften Biden mit herabhängendem Kiefer neben einem, wenn auch nur drei Jahre jüngeren, aber deutlich energischeren Trump. Für viele Demokraten, von der ehemaligen Pressesprecherin Jen Psaki bis zu Gouverneuren und Kongressabgeordneten, die bei Debattenpartys zusahen, war in diesem Moment klar: Das Rennen war verloren. Die Debatte war die öffentliche Offenbarung einer Wahrheit, die das Weiße Haus monatelang unterdrückt hatte.
Das Ende: Ein erzwungener Rückzug und ein vergiftetes Erbe
Die drei Wochen nach der Debatte waren ein quälender politischer Todeskampf. Während das „Politbüro“ zunächst versuchte, den Vorfall als „schlechten Abend“ herunterzuspielen und stur an der Kandidatur festhielt, wuchs der Druck aus der Partei und von den Geldgebern ins Unermessliche. Der Geldhahn drohte zu versiegen, und immer mehr Abgeordnete und Senatoren forderten öffentlich oder intern den Rückzug. In Gesprächen mit Gouverneuren und Fraktionsführern wirkte Biden defensiv und uneinsichtig, klammerte sich an vermeintlich positive Umfragen, die seinen eigenen Meinungsforschern unbekannt waren.
Erst als ihm seine engsten Verbündeten wie Chuck Schumer ungeschönt die Daten präsentierten – eine Gewinnchance von nur noch fünf Prozent – und ihm klarmachten, dass er die Partei in eine historische Niederlage führen und sein eigenes politisches Vermächtnis zerstören würde, begann Biden nachzugeben. Am 21. Juli 2024 zog er schließlich seine Kandidatur zurück. Er überließ Kamala Harris ein politisches Schlachtfeld, eine auf 107 Tage verkürzte Kampagne und die schier unlösbare Aufgabe, sich von einem Präsidenten zu distanzieren, dem sie bis zuletzt die Treue gehalten hatte.
Am Ende bleibt das Bild einer Präsidentschaft, die von der Hybris eines Mannes und seines engsten Kreises untergraben wurde. Die Entscheidung, trotz offensichtlicher Schwäche an der Macht festzuhalten, war nicht nur ein Verrat an den Wählern, sondern auch ein Bärendienst an der eigenen Partei und dem Land. Der Fall Biden ist eine eindringliche Warnung davor, wie Loyalität gegenüber einer Person die Verantwortung gegenüber dem Amt ausstechen kann und wie die Angst vor dem politischen Gegner zu einer kollektiven Realitätsverweigerung führen kann, die am Ende genau das herbeiführt, was sie zu verhindern suchte.