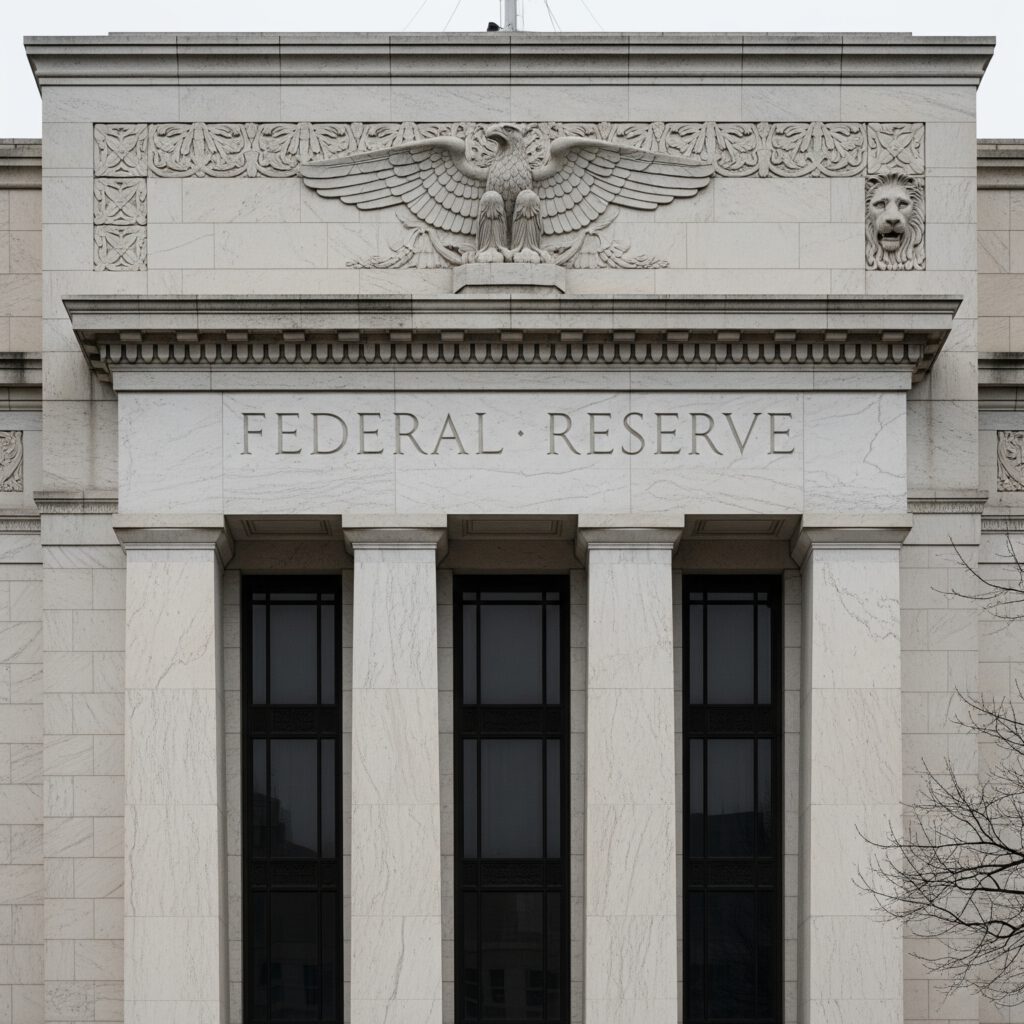Es hätten Bilder der Einigkeit sein sollen, aufgenommen vor der majestätischen Kulisse der kanadischen Rocky Mountains. Doch der G7-Gipfel in Alberta, Kanada, lieferte das genaue Gegenteil. Statt eines harmonischen Treffens der mächtigsten westlichen Demokratien wurde die Welt Zeuge einer tiefen Zerrissenheit, einer offenen Konfrontation, die die Grundfesten der transatlantischen Allianz erschütterte. Im Zentrum des Bebens: US-Präsident Donald Trump, dessen „America First“-Doktrin das Bündnis an den Rand des Zusammenbruchs führte. Der Gipfel wurde zu einer Bühne, auf der nicht mehr über gemeinsame Lösungen für globale Probleme verhandelt wurde, sondern auf der die verbleibenden sechs Mitglieder verzweifelt versuchten, den Schaden zu begrenzen, den ihr mächtigster Partner anrichtete. Was in Kanada geschah, war mehr als nur ein diplomatischer Eklat; es war die Manifestation einer neuen Weltunordnung, in der die USA nicht mehr die Führungsmacht des Westens sind, sondern dessen unberechenbarster Akteur.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Trumps Weltbild gegen den Rest: Eine Allianz am Scheideweg
Schon vor Beginn des Gipfels war die Erwartungshaltung auf einem Tiefpunkt. Die kanadischen Gastgeber unter Premierminister Mark Carney hatten bereits im Vorfeld die Hoffnung aufgegeben, ein traditionelles gemeinsames Kommuniqué zu verabschieden – eine einst unvorstellbare Kapitulation vor der erwarteten Uneinigkeit. Diese Entscheidung entpuppte sich als prophetisch, denn das Treffen legte einen fundamentalen Bruch in den Weltanschauungen offen. Auf der einen Seite standen die G7-Partner, die sich historisch als eine Gemeinschaft gemeinsamer Werte verstehen, die auf Multilateralismus, freiem Handel und internationaler Zusammenarbeit basiert. Auf der anderen Seite stand Donald Trump, dessen Handeln von einem rein transaktionalen, nationalistischen und konfrontativen Ansatz geprägt ist.
Für Trump ist die G7 keine Wertegemeinschaft, sondern eine Verhandlungsmasse, ein Forum, in dem amerikanische Interessen ohne Rücksicht auf traditionelle Bündnislogiken durchgesetzt werden sollen. Diese Kluft wurde vom ersten Moment an spürbar. Während andere Staats- und Regierungschefs versuchten, eine Basis für den Dialog zu finden, schuf Trump Fakten. Seine Haltung, die er selbst als die eines „transformationalen“ Präsidenten bezeichnet sieht, zielt nicht auf Konsens, sondern auf Disruption. Analysten beschrieben die Dynamik treffend als „G6 plus eins“, ein Zustand, in dem der Gipfel primär dazu diente, mit der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten umzugehen, anstatt eine globale Agenda zu gestalten. Die Atmosphäre war von tiefem Misstrauen und Angst geprägt, nicht von der kooperativen Haltung, die einst das Markenzeichen dieser Treffen war.
Eskalation im Nahen Osten: Der Iran-Konflikt als Katalysator
In diese ohnehin angespannte Lage platzte die brandgefährliche Eskalation im Nahen Osten. Die israelischen Luftschläge gegen den Iran und die darauffolgenden Vergeltungsaktionen Teherans wurden zur unerwarteten, aber dominanten Thematik des Gipfels. Und nirgendwo wurden die Differenzen zwischen Trump und seinen europäischen Verbündeten deutlicher als hier. Während die Europäer, allen voran die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf Deeskalation und eine diplomatische Lösung drängten, schlug Trump einen gänzlich anderen Ton an.
Seine Reaktion war eine Mischung aus Drohgebärden und diplomatischem Affront. Zunächst weigerte er sich, eine von den Partnern vorbereitete gemeinsame Erklärung zur Deeskalation zu unterzeichnen. Stattdessen goss er Öl ins Feuer, indem er auf seiner Social-Media-Plattform die sofortige Evakuierung der iranischen Hauptstadt Teheran forderte – eine alarmierende Botschaft an eine Metropole mit fast 10 Millionen Einwohnern. Er rechtfertigte seinen harten Kurs mit der unmissverständlichen Ansage: „IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON“.
Der Höhepunkt dieses Dramas war seine abrupte Entscheidung, den Gipfel einen Tag früher zu verlassen, offiziell begründet mit der Notwendigkeit, sich um die Krise im Nahen Osten zu kümmern. Dieser Schritt war ein Schlag ins Gesicht der Gastgeber und der verbleibenden Staats- und Regierungschefs, die am Folgetag wichtige Gespräche, unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, geplant hatten. In einer für ihn typischen, unvorhersehbaren Wendung unterzeichnete Trump kurz vor seinem Abflug doch noch eine modifizierte Version der Erklärung, nachdem Änderungen am Text vorgenommen worden waren. Dieser Zickzack-Kurs unterstrich nicht nur die tiefen politischen Differenzen, sondern auch Trumps erratischen Stil, der jegliche strategische Planung für seine Partner unmöglich macht und die traditionelle Rolle der USA als verlässlicher Anker und Konsensbildner ad absurdum führt.
„Ich bin ein Zoll-Mensch“: Der Handelskrieg gegen die eigenen Verbündeten
Parallel zur sicherheitspolitischen Krise im Nahen Osten tobte an der Wirtschaftsfront ein von Trump selbst entfachter Konflikt. „Ich bin ein Zoll-Mensch. Ich war schon immer ein Zoll-Mensch“, erklärte er in Kanada und brachte damit seine simple, aber für die Weltwirtschaft brandgefährliche Philosophie auf den Punkt. In seinem zweiten Amtsjahr hatte er diese Haltung mit der Verhängung der höchsten Zölle seit einem Jahrhundert auf eine neue Ebene gehoben und damit einen globalen Handelskrieg riskiert. Die Strafzölle auf Stahl, Aluminium und Automobile trafen die engsten Verbündeten der USA, einschließlich aller G7-Mitglieder, ins Mark.
Die Reaktionen auf diese protektionistische Welle waren eine Mischung aus Besorgnis, strategischer Anpassung und dem Versuch der Schadensbegrenzung. Ursula von der Leyen warnte eindringlich, dass Zölle Unsicherheit schaffen, die Inflation anheizen und vom eigentlichen Problem – Chinas unfairen Handelspraktiken – ablenken. Die anderen Staats- und Regierungschefs waren gezwungen, individuelle Strategien im Umgang mit dem unberechenbaren US-Präsidenten zu entwickeln. Der kanadische Gastgeber Mark Carney versuchte es mit einer Doppelstrategie: Einerseits schmeichelte er Trump, lobte dessen „kühne“ Entscheidungen und sein „persönliches Führungs-“ vermögen. Andererseits positionierte er sich und sein Land als Gegenpol zum „America First“-Isolationismus und trieb die Diversifizierung von Handels- und Verteidigungspartnerschaften voran, um Kanadas Abhängigkeit von den USA zu verringern.
Der britische Premierminister Keir Starmer wählte einen ähnlichen Ansatz und versuchte, Trump mit dem Versprechen eines schnellen bilateralen Handelsabkommens zu umwerben. Dies führte tatsächlich zu einer Rahmenvereinbarung, die am Rande des Gipfels unterzeichnet wurde – einer der wenigen konkreten, pragmatischen Lichtblicke inmitten der Konfrontation. Auch mit Kanada wurde ein 30-tägiges Zeitfenster für eine Einigung vereinbart. Doch diese bilateralen Manöver konnten nicht über die grundlegende Zerrüttung hinwegtäuschen. Trumps Drohung, Kanada zum „51. Bundesstaat“ zu machen, hatte die Beziehungen zu einem historischen Tiefpunkt geführt und zeigte, wie wenig ihm an traditionellen Partnerschaften gelegen war.
Ein Freund für Putin: Trumps Affront in der Russland-Frage
Nichts verdeutlichte Trumps zunehmende Entfremdung von seinen westlichen Verbündeten so sehr wie seine Haltung zu Russland. Wiederholt und mit Nachdruck forderte er, die G7 wieder zur G8 zu machen und Wladimir Putin zurück an den Verhandlungstisch zu holen. Für die anderen G7-Mitglieder war dies ein unverzeihlicher Affront. Russland war 2014 einstimmig aus dem Gremium ausgeschlossen worden, nachdem es die Krim annektiert und damit die internationale Ordnung verletzt hatte. Trumps Argumentation, der Krieg in der Ukraine wäre mit Russland am Tisch vermeidbar gewesen, verkehrte nicht nur Ursache und Wirkung, sondern stellte ihn auch direkt an die Seite des russischen Autokraten und gegen seine demokratischen Partner.
Er ging sogar noch weiter und schlug vor, auch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping einzuladen. Sein fehlendes Verständnis für die G7 als eine Gruppe gleichgesinnter Industriedemokratien war offensichtlich. Diese Haltung hatte direkte Auswirkungen auf die Diskussionen über den Krieg in der Ukraine. Während die europäischen Partner, insbesondere Großbritannien, neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen wollten, um den Druck auf Moskau zu erhöhen, zeigte sich Trump zurückhaltend. Er wolle erst sehen, was Europa tue, und argumentierte, Sanktionen seien auch für die USA kostspielig. Diese Weigerung, gemeinsam und entschlossen gegen die russische Aggression vorzugehen, untergrub die transatlantische Geschlossenheit in einer der zentralen Sicherheitsfragen der Gegenwart und zementierte den Eindruck eines tief gespaltenen Westens.
Die Zukunft der G7: Vom Club der Mächtigen zum Krisenmanagement-Gremium?
Am Ende des Gipfels in Kanada blieb die ernüchternde Erkenntnis: Die G7-Gruppe hat ihre Funktion fundamental verändert. Sie ist nicht länger der Ort, an dem eine gemeinsame globale Agenda geschmiedet wird. Stattdessen ist sie zu einem Forum für Krisenmanagement verkommen, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die durch das Verhalten des amerikanischen Präsidenten verursachten Brände zu löschen. Das von vornherein geplante Ausbleiben eines gemeinsamen Kommuniqués ist das stärkste Symbol für diesen Funktionsverlust. Es zeigt, dass Konsens selbst bei grundlegendsten Fragen nicht mehr erreichbar ist.
Trumps Stil, den ein ehemaliger kanadischer Premierminister als den eines „Rowdys“ beschrieb, und seine Respektlosigkeit gegenüber der Souveränität enger Partner wie Kanada haben das Vertrauen, das Fundament jeder Allianz, nachhaltig zerstört. Der Gipfel von Alberta war somit keine normale politische Auseinandersetzung, sondern ein Wendepunkt. Er markiert den Moment, in dem die von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene und angeführte Ordnung von ihrem eigenen Architekten in Frage gestellt wurde. Die verbleibenden „G6“ stehen nun vor der gewaltigen Herausforderung, eine handlungsfähige westliche Politik ohne oder sogar gegen Washington zu definieren. Der Riss, der in den kanadischen Bergen so deutlich sichtbar wurde, wird nicht leicht zu kitten sein. Er könnte sich als eine dauerhafte Verwerfung in der politischen Landschaft des 21. Jahrhunderts erweisen.