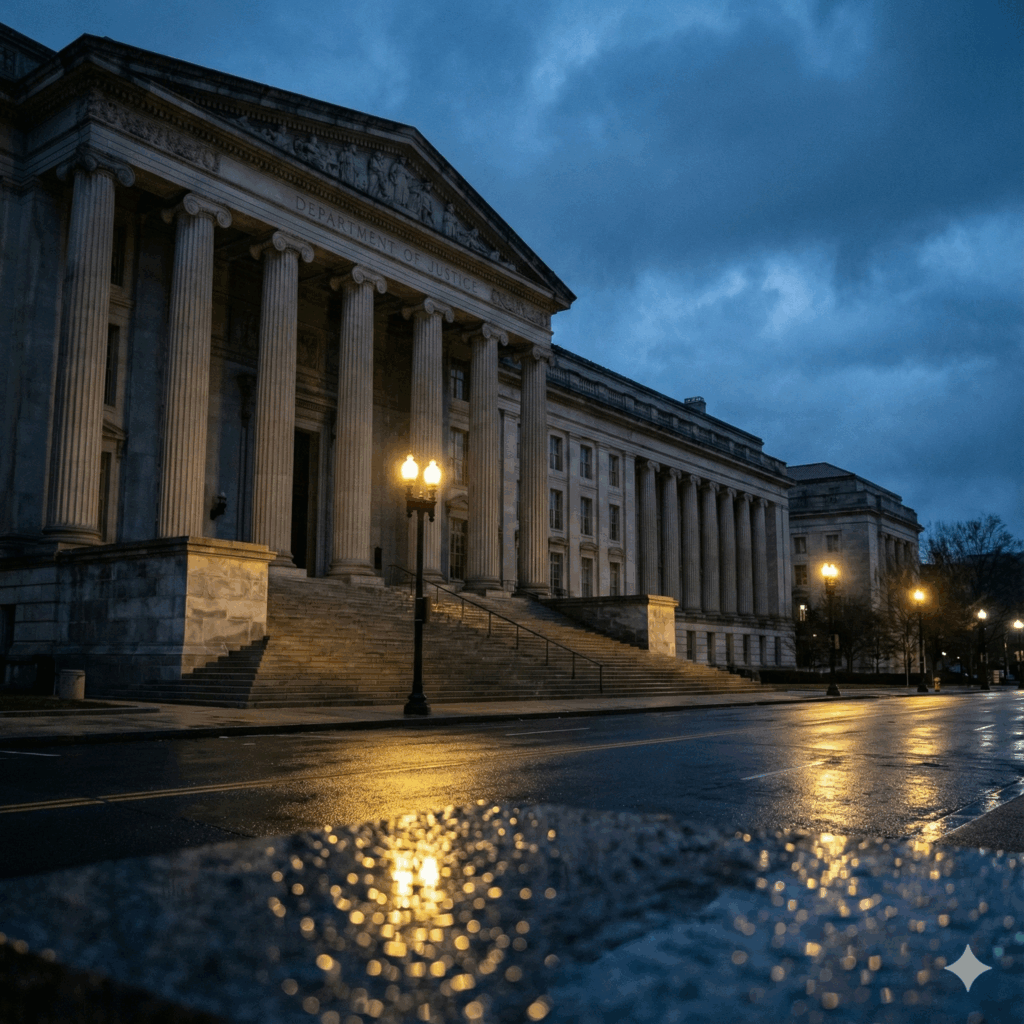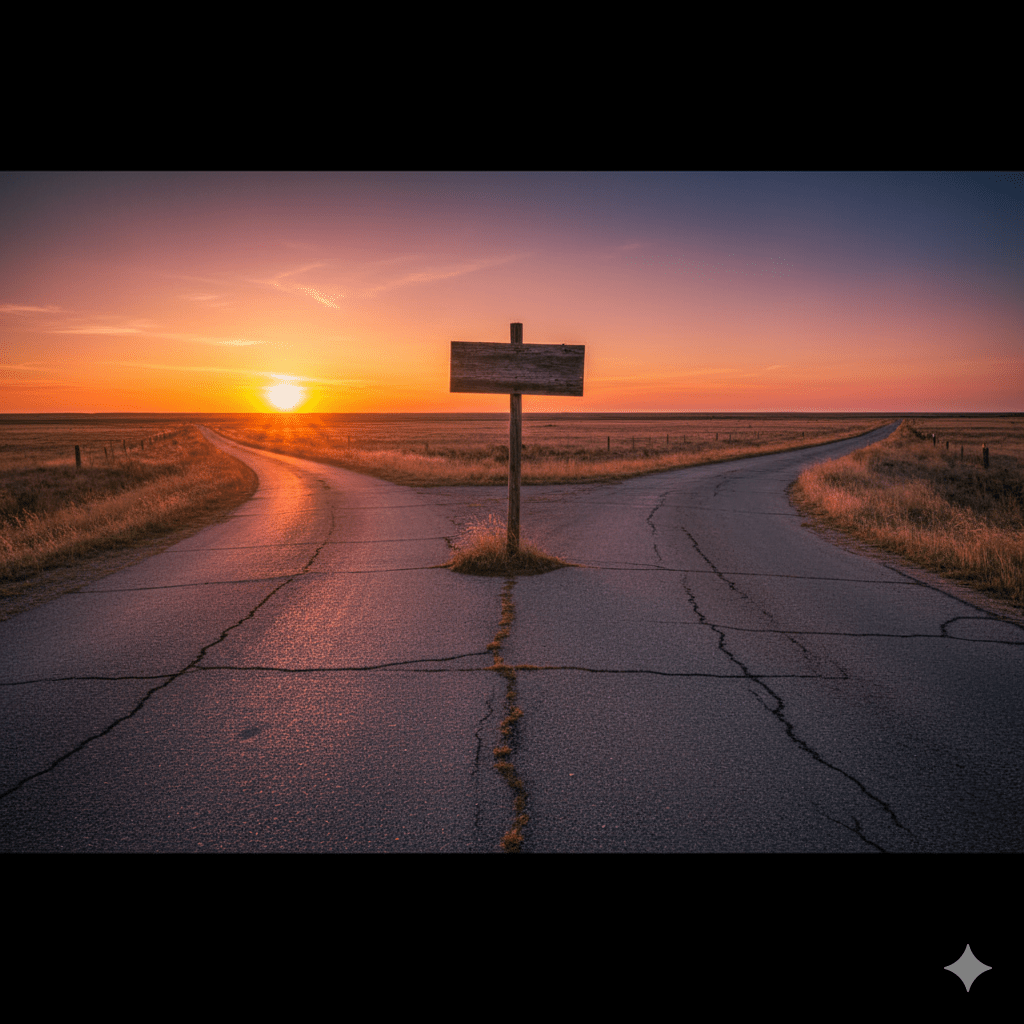Es gibt Momente in der Welt der Diplomatie, die in ihrer Banalität eine fast schon schmerzhafte Symbolkraft entfalten. Ein falsches Händeschütteln, ein vergessener Name, ein unglücklich gewähltes Jackett. Und dann gibt es den 24. September 2025, einen Tag, der in die Annalen der Vereinten Nationen eingehen könnte – nicht wegen einer bahnbrechenden Resolution oder einer historischen Rede, sondern wegen einer Rolltreppe. Einer gewöhnlichen, grauen Rolltreppe im UN-Hauptquartier in New York, die für einen kurzen, folgenschweren Augenblick beschloss, einfach nur eine Treppe zu sein.
Der Vorfall, bei dem die Fahrt von Präsident Donald Trump und der First Lady Melania Trump abrupt stoppte, war mehr als nur eine technische Lappalie. Er war ein Funke, der ein politisches Feuer entfachte. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich eine alltägliche Panne in „Escalatorgate“, eine angebliche „dreifache Sabotage“, eine Staatsaffäre, die den Secret Service auf den Plan rief und die diplomatischen Drähte zum Glühen brachte. Diese Episode ist ein Lehrstück. Sie ist ein Mikrokosmos, der die politische Methode der Trump-Regierung in seiner zweiten Amtszeit in reiner, fast destillierter Form offenbart: die gezielte Konstruktion von Opfererzählungen, die sofortige Umdeutung von Fakten in Verschwörung und die strategische Untergrabung von Institutionen. Die Geschichte dieser Rolltreppe ist die Geschichte, wie in der modernen Politik aus einer Mücke nicht nur ein Elefant, sondern eine ganze Herde wütender, angreifender Elefanten gemacht wird.
Der Vorfall: Mehr als nur ein paar Stufen
Die Szene selbst hätte kaum unaufgeregter sein können. Der Präsident und die First Lady betreten die unterste Stufe der Rolltreppe, die sie in den zweiten Stock zur Generalversammlung bringen soll. Die Kameras laufen. Doch nach wenigen Zentimetern ein Ruck, ein plötzlicher Stillstand. Ein Moment der Verwirrung, ein kurzer Blick zurück, dann beginnt Melania Trump, die Stufen zu Fuß zu nehmen, ihr Mann folgt ihr. Ein alltäglicher Defekt, ärgerlich, aber unbedeutend.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch es blieb nicht dabei. Minuten später, am Rednerpult der Generalversammlung, die nächste Panne: Der Teleprompter streikt. Trump, nie um einen spontanen Kommentar verlegen, scherzt, wer auch immer das Gerät bediene, stecke nun in „großen Schwierigkeiten“. Später wird er noch ein drittes Problem beklagen: Die Akustik im Saal sei so schlecht gewesen, dass seine Frau ihn kaum habe verstehen können. Eine Rolltreppe, ein Teleprompter, ein Mikrofon – eine Verkettung unglücklicher, aber keineswegs außergewöhnlicher technischer Pannen. In den meisten Verwaltungen wäre dies eine interne Notiz an die Haustechnik wert gewesen. Im Kosmos von Donald Trump wurde es zur Grundlage für eine Erzählung von Verrat und internationaler Intrige.
Zwei Welten, eine Rolltreppe: Sabotage oder Sicherheit?
Was folgte, war ein Lehrbuchbeispiel für den Kampf um die Deutungshoheit, ein Ringen zweier fundamental unvereinbarer Realitäten. Auf der einen Seite stand die Erklärung der Vereinten Nationen, eine Darstellung, die man als bürokratisch, technisch und beinahe pedantisch bezeichnen könnte. Der Sprecher der UN, Stéphane Dujarric, erklärte nach einer schnellen Untersuchung, dass die Rolltreppe genau das getan habe, wofür sie konstruiert wurde. Ein Videograf aus der Delegation des Weißen Hauses sei rückwärts die Treppe hochgelaufen, um die Ankunft des Präsidenten zu filmen. Dabei habe er am oberen Ende der Treppe wahrscheinlich einen Sicherheitsmechanismus ausgelöst – einen sogenannten „comb impact switch“. Dieser Schalter ist eine Art letzte Verteidigungslinie, die verhindern soll, dass Gegenstände oder Füße in das Getriebe gezogen werden. Ein unbeabsichtigter Tritt, ein unachtsamer Moment, und das System schaltet sich aus Sicherheitsgründen ab.
Diese Version wurde von externen Experten für Aufzug- und Rolltreppentechnik gestützt. Robert Rauch, ein Inspektor mit jahrzehntelanger Erfahrung, bestätigte, dass solche Mikroschalter genau für solche Fälle da sind und ein plötzlicher Halt ein Zeichen dafür ist, dass das Sicherheitssystem funktioniert, nicht dass es versagt. Die Maschine tat, was sie tun sollte: Sie verhinderte einen potenziellen Unfall. Auch für den defekten Teleprompter fand sich eine prosaische Erklärung: Ein UN-Offizieller stellte klar, dass die Verantwortung für die Bedienung des Geräts bei der Delegation des Weißen Hauses selbst lag. Die UN stellte die Infrastruktur, die US-Seite brachte ihre eigene Technik und ihr Personal mit.
Auf der anderen Seite dieses Faktengebäudes errichtete das Weiße Haus eine völlig andere Erzählung. Hier gab es keine Zufälle, keine technischen Pannen, keine menschlichen Fehler. Hier gab es nur Vorsatz. Trump selbst sprach von einer „absoluten Sabotage“ und einem „sehr finsteren Ereignis“. Er malte das Bild eines gezielten Anschlags, bei dem er und die First Lady nur knapp einer Katastrophe entgangen seien, als sie nicht „mit dem Gesicht voran auf die scharfen Kanten dieser Stahlstufen“ fielen. Diese dramatische Darstellung war der Grundstein für eine Verschwörungstheorie, die von seinem Team umgehend mit institutionellem Gewicht versehen wurde.
Die Eskalations-Maschinerie: Vom Witz zur Staatsaffäre
Die Verwandlung des Vorfalls von einer Anekdote in eine politische Waffe folgte einer präzisen und erprobten Choreografie. Es ist eine Arbeitsteilung, die für die Kommunikation der Trump-Präsidentschaft charakteristisch ist. Stufe eins war Trumps Auftritt selbst. Am Rednerpult und später auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social formulierte er den anfänglichen Verdacht, zunächst noch mit einem Anflug von Humor und Selbstironie. Er scherzte über die Pannen und inszenierte sich als leidgeprüfter Gast, dem die UN nur „eine schlechte Rolltreppe und einen schlechten Teleprompter“ zu bieten hatte.
Doch während Trump die Rolle des humorvollen Opfers spielte, trat seine Pressesprecherin Karoline Leavitt auf den Plan, um die zweite Stufe der Eskalation zu zünden. Ihre Reaktion war alles andere als humorvoll. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) forderte sie unmissverständlich: „Wenn jemand bei der UN die Rolltreppe absichtlich angehalten hat, […] muss er gefeuert und sofort untersucht werden“. Wenig später, in einem Interview auf Fox News, legte sie nach. Nun war nicht mehr nur von einer möglichen Absicht die Rede, sondern von einem gezielten Versuch von UN-Mitarbeitern, den Präsidenten und die First Lady „buchstäblich zu Fall zu bringen“. Sie kündigte an, dass der Secret Service die Sache untersuche, und verlieh damit dem vagen Verdacht den Anstrich einer nationalen Sicherheitsangelegenheit.
Diese zweigleisige Strategie ist brillant in ihrer Effektivität. Trump selbst kann eine gewisse Distanz wahren, während sein Apparat die Anschuldigungen in die Welt setzt und in den Köpfen seiner Anhänger verankert. Die Forderung nach einer Untersuchung durch den Secret Service ist dabei ein besonders geschickter Schachzug. Ob eine solche Untersuchung je ernsthaft stattfindet oder zu einem Ergebnis kommt, ist sekundär. Allein die Ankündigung signalisiert: Der Verdacht ist legitim, die Bedrohung ist real. Die Banalität des Auslösers – eine Rolltreppe – wird durch das Gewicht der Reaktion völlig überdeckt.
Ein Echo in der Echokammer: Medien im Kreuzfeuer
Wie bei so vielen politischen Ereignissen im 21. Jahrhundert wurde auch „Escalatorgate“ zu einem Phänomen, das erst durch sein mediales Echo seine volle Wirkung entfaltete. Der Vorfall wurde zu einem perfekten Futter für einen polarisierten Medienmarkt, der nicht mehr eine gemeinsame Realität abbildet, sondern unterschiedliche, sich gegenseitig ausschließende Wahrheiten für seine jeweilige Zielgruppe produziert.
Auf der einen Seite standen die Late-Night-Shows und liberalen Kommentatoren. Für sie war die Episode eine Steilvorlage für Spott und Satire. Stephen Colbert und Jimmy Kimmel zerlegten die Diskrepanz zwischen dem harmlosen Vorfall und der dramatischen Überreaktion. Kimmels trockener Kommentar, „ein anderes Wort für eine eingefrorene Rolltreppe ist Treppe“, brachte die Absurdität der Situation auf den Punkt. Seth Meyers fragte rhetorisch, ob Trump nun der „stärkste, gesündeste, körperlich stärkste Mann-Bestie“ oder eine „brittle-boned grandma“ sei, und entlarvte damit den Widerspruch in der Selbstinszenierung des Präsidenten.
Auf der anderen Seite des Spektrums wurde die Sabotage-These von konservativen Medien wie Fox News bereitwillig aufgegriffen und verstärkt. Jesse Watters sprach von einem Akt der Sabotage, der die First Lady hätte verletzen können. Hier wurde die Erzählung des Weißen Hauses nicht hinterfragt, sondern als bare Münze genommen und an ein Publikum weitergereicht, das ohnehin von der Feindseligkeit internationaler Organisationen gegenüber Trump überzeugt ist.
So funktionierte der Vorfall als eine Art politischer Rorschachtest: Jeder sah darin das, was er ohnehin schon glaubte. Für die einen war es der Beweis für Trumps Paranoia und seine Neigung, aus Nichtigkeiten Dramen zu konstruieren. Für die anderen war es die Bestätigung, dass ihr Präsident von finsteren, globalistischen Kräften sabotiert wird, die selbst vor dem Stilllegen einer Rolltreppe nicht zurückschrecken. Eine gemeinsame Gesprächsgrundlage, ein gemeinsames Verständnis der Fakten, existierte nicht mehr.
Das größere Spiel: Ein Angriff auf die Institutionen
Um die wahre Bedeutung von „Escalatorgate“ zu verstehen, muss man den Blick heben und das Ereignis in den größeren Kontext der politischen Strategie von Donald Trump stellen. Die Attacke auf die UN wegen einer Rolltreppe war kein Ausrutscher, sondern die konsequente Fortsetzung eines Musters. Es ist ein Angriff, der sich nicht nur gegen diese eine Institution richtet, sondern gegen das Fundament, auf dem die internationale Ordnung und die liberale Demokratie beruhen: Vertrauen in Institutionen, Respekt vor Fakten und die Akzeptanz gemeinsamer Regeln und Protokolle.
Die Vereinten Nationen sind für Trump und seine Bewegung ein ideales Feindbild. Sie verkörpern den Multilateralismus, die globale Kooperation und eine Form der Bürokratie, die im Widerspruch zu seiner „America First“-Doktrin steht. Die technischen Pannen boten ihm eine willkommene Gelegenheit, dieses Feindbild mit Leben zu füllen und die UN vor den Augen der Welt als inkompetent und dysfunktional darzustellen. In seiner Rede vor der Generalversammlung nutzte er die Vorfälle, um genau dieses Bild zu zeichnen. Die Botschaft war klar: Seht her, diese Organisation kann nicht einmal eine Rolltreppe am Laufen halten, wie soll sie die großen Probleme der Welt lösen?
Diese Taktik der Delegitimierung durch die Betonung kleiner Fehler ist hochwirksam. Sie zielt darauf ab, das Vertrauen der Öffentlichkeit systematisch zu erodieren. Wenn eine globale Organisation als feindseliger und unfähiger Akteur dargestellt wird, fällt es leichter, finanzielle Beiträge zu kürzen, internationale Abkommen zu ignorieren und sich aus der gemeinsamen Verantwortung zurückzuziehen.
Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John R. Bolton, selbst ein scharfer Kritiker der UN, merkte in einem Kommentar an, dass defekte Rolltreppen eine passende Metapher für die tatsächliche Dysfunktionalität der Organisation seien. Doch er machte auch deutlich, dass rhetorische Breitseiten und die Inszenierung persönlicher Kränkungen kein Ersatz für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den realen Problemen der UN sind. Trumps Ansatz ist jedoch nicht auf Reform ausgerichtet, sondern auf Destruktion. Er will die Institution nicht verbessern, er will sie als Gegner brandmarken.
Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass es bei diesem Vorfall nie wirklich um eine Rolltreppe ging. Es ging um die Macht der Erzählung. Es ging darum, eine Realität zu schaffen, in der der mächtigste Mann der Welt gleichzeitig das größte Opfer ist. Eine Realität, in der jede technische Panne ein Anschlag und jeder Widerspruch ein Beweis für eine Verschwörung ist. Die langfristigen Risiken dieser Strategie sind immens. Sie vergiftet das politische Klima, macht rationale Debatten unmöglich und untergräbt das Fundament, auf dem Diplomatie und internationale Zusammenarbeit aufgebaut sind.
Die Rolltreppe im UN-Hauptquartier steht längst wieder still oder fährt, wie sie soll. Doch der politische Schaden, den ihr kurzer Stillstand angerichtet hat, wird noch lange nachwirken. Er hat gezeigt, wie fragil die Wahrheit in einer Zeit der alternativen Fakten geworden ist und wie leicht sich die Mechanismen des öffentlichen Diskurses für die Zwecke der politischen Zersetzung instrumentalisieren lassen. Es war, so gesehen, tatsächlich mehr als nur eine Treppe. Es war ein Blick in den Maschinenraum einer Politik, die ihre größte Stärke aus dem Misstrauen zieht, das sie selbst sät.