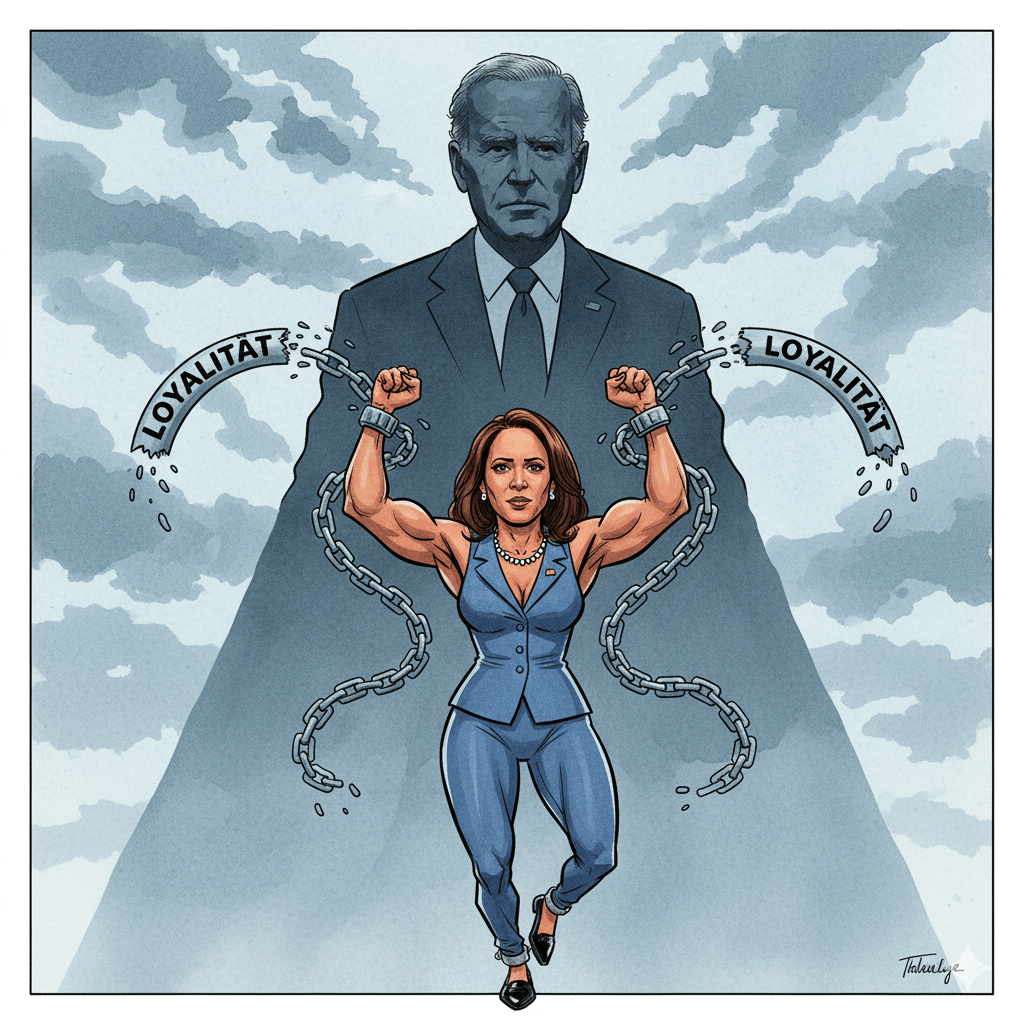Elon Musk, einst gefeierter Visionär und Tech-Milliardär, trat Anfang 2025 mit dem Versprechen an, die US-Regierung unter Donald Trump radikal zu verschlanken. Als Leiter des neu geschaffenen „Department of Government Efficiency“ (DOGE) versprach er Einsparungen von einer Billion Dollar, vielleicht sogar zwei. Doch nach nur wenigen Monaten scheint der Glanz verblasst, der Einfluss geschwunden und Musk kündigt einen teilweisen Rückzug an. Was ist geschehen?
DOGE: Die Kettensäge im Beamtenapparat und ihre Kollateralschäden
Musks DOGE ging mit brachialer Gewalt vor. Behörden wurden über Nacht geschlossen, Mitarbeiter beurlaubt oder mussten wöchentlich ihre Tätigkeiten nachweisen, sonst drohte die Kündigung. Unter Androhung von Polizeigewalt verschafften sich seine Mitarbeiter Zugang zu Gebäuden und Computersystemen. Das Ziel: Effizienzsteigerung um jeden Preis, Identifizierung von Steuerverschwendung. Doch die Methoden waren rechtlich höchst umstritten. Klagen wurden eingereicht, die Musks Befugnisse als nicht vom Senat bestätigter „Special Government Employee“ infrage stellten. Gerichte schränkten die Kompetenzen von DOGE ein, untersagten Behördenschließungen. Das Weiße Haus selbst musste vor Gericht einräumen, dass Musks tatsächliche Macht begrenzt war. Die anfängliche „Kettensägen“-Mentalität, symbolisiert durch ein Geschenk des argentinischen Präsidenten Milei, wich einem Vorgehen mit dem „Skalpell“, nachdem Trump selbst seinen Ministern mehr Autonomie zugestand. Immer mehr Behörden, selbst die National Institutes of Health, ignorierten Musks Anweisungen. Der anfängliche Sturm entpuppte sich zunehmend als laues Lüftchen, die versprochene Billion schrumpfte auf eher bescheidene 150 Milliarden Dollar möglicher Einsparungen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Tesla im Strudel der Politik: Wenn der CEO zur Belastung wird
Musks politische Ambitionen und seine polarisierenden Positionen blieben nicht ohne Folgen für sein Kernunternehmen Tesla. Die Marke, einst Symbol für Fortschritt und Umweltbewusstsein, wurde zunehmend mit Musks rechter politischer Agenda und seiner harschen Rhetorik in Verbindung gebracht. Landesweite „Anti-DOGE“-Proteste, Boykottaufrufe der „Tesla Takedown“-Bewegung und sogar gewalttätige Angriffe auf Autohäuser und Ladestationen prägten das Bild. Die Verkaufszahlen brachen ein, der Aktienkurs fiel drastisch. Im ersten Quartal 2025 meldete Tesla einen Gewinneinbruch von 71 Prozent. Zwar spielten auch die wachsende Konkurrenz aus China und der Modellwechsel beim Model Y eine Rolle, doch Analysten sehen einen signifikanten Imageschaden durch Musks politische Aktivitäten, der die Nachfrage dauerhaft um 15 bis 20 Prozent drücken könnte. Die sinkende Beliebtheit Musks selbst – eine negative Meinung bei 53 Prozent der Amerikaner – schlug voll auf das Unternehmen durch.
Die Trump-Musk-Achse: Zwischen Allianz und Abnutzung
Die Beziehung zwischen Trump und Musk war stets komplex. Musk, einer der größten Wahlkampfspender Trumps 2024, wurde zum engen Berater und Blitzableiter. Trump wiederum instrumentalisierte Musk für seine Zwecke, lobte ihn öffentlich und inszenierte sogar eine Tesla-Werbeveranstaltung vor dem Weißen Haus, um konservative Unterstützung für die angeschlagene Marke zu mobilisieren. Doch es gab auch Spannungen. Musk kritisierte Trumps Zollpolitik öffentlich, was ihm harsche Kritik von Trumps Handelsberater einbrachte. Trump wiederum gestand Fehler Musks ein und dämmte dessen Einfluss im Kabinett ein. Die einstige Omnipräsenz Musks an Trumps Seite wich einer merklich reduzierten Sichtbarkeit. Auch Musks Versuch, sich als Wahlkampfhelfer zu profilieren, scheiterte, wie die Niederlage des von ihm unterstützten Kandidaten in Wisconsin zeigte.
Der Handelskrieg mit China trifft Musk zusätzlich. Trumps Zölle und Chinas Vergeltungsmaßnahmen, wie der Exportstopp für bestimmte Seltenerdmagnete, gefährden nicht nur Teslas Autoproduktion, sondern auch die Entwicklung der humanoiden Optimus-Roboter, die auf diese Magnete angewiesen sind.
Die Plattform X (vormals Twitter) dient Musk dabei als zentrales Instrument seiner politischen Machtausübung. Er nutzt sie zur Verbreitung seiner Ansichten, zur Mobilisierung von Anhängern und zur direkten Auseinandersetzung mit Kritikern. Gleichzeitig gibt es Vorwürfe, Musk manipuliere die Reichweite von Nutzern, die ihn kritisieren, und unterdrücke unliebsame Meinungen, was seinem selbsternannten Status als „Free Speech Absolutist“ widerspricht.
Elon Musks Intermezzo in Washington endet vorerst mit einem angekündigten teilweisen Rückzug, getrieben von wirtschaftlichem Druck bei Tesla und schwindendem politischen Einfluss. Die anfängliche Euphorie ist einer nüchternen Bilanz gewichen: Die radikalen Versprechen blieben unerfüllt, die Kollateralschäden sind erheblich. Ob Musk sich nun wieder erfolgreich auf Tesla konzentrieren kann und die Marke ihren einstigen Glanz zurückgewinnt, bleibt abzuwarten. Sein politisches Abenteuer jedoch hinterlässt tiefe Spuren – in Washington und bei Tesla.