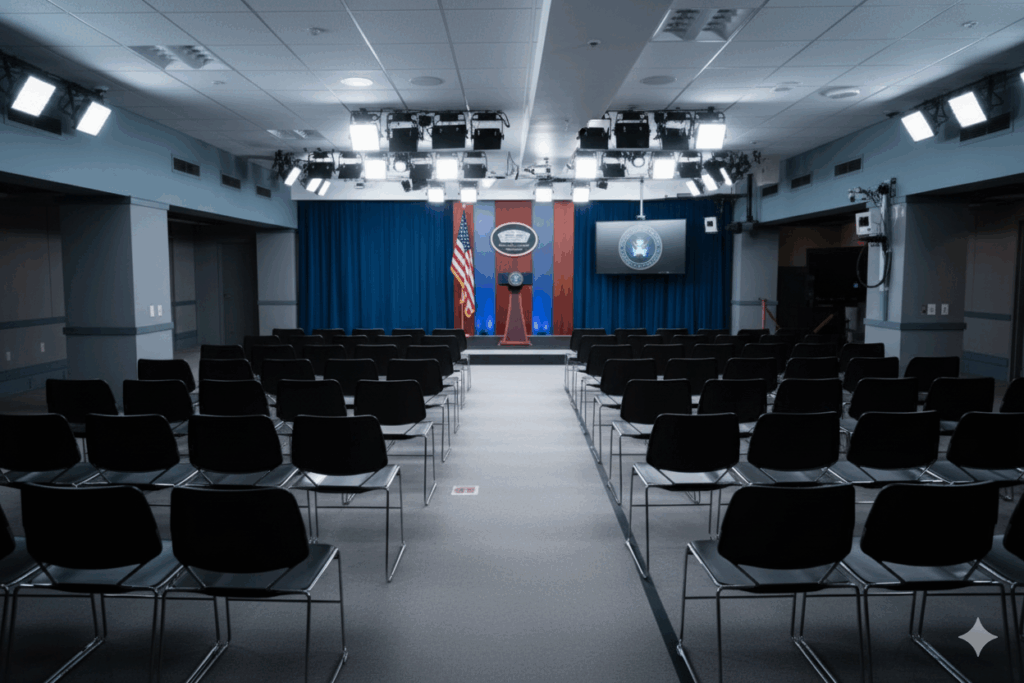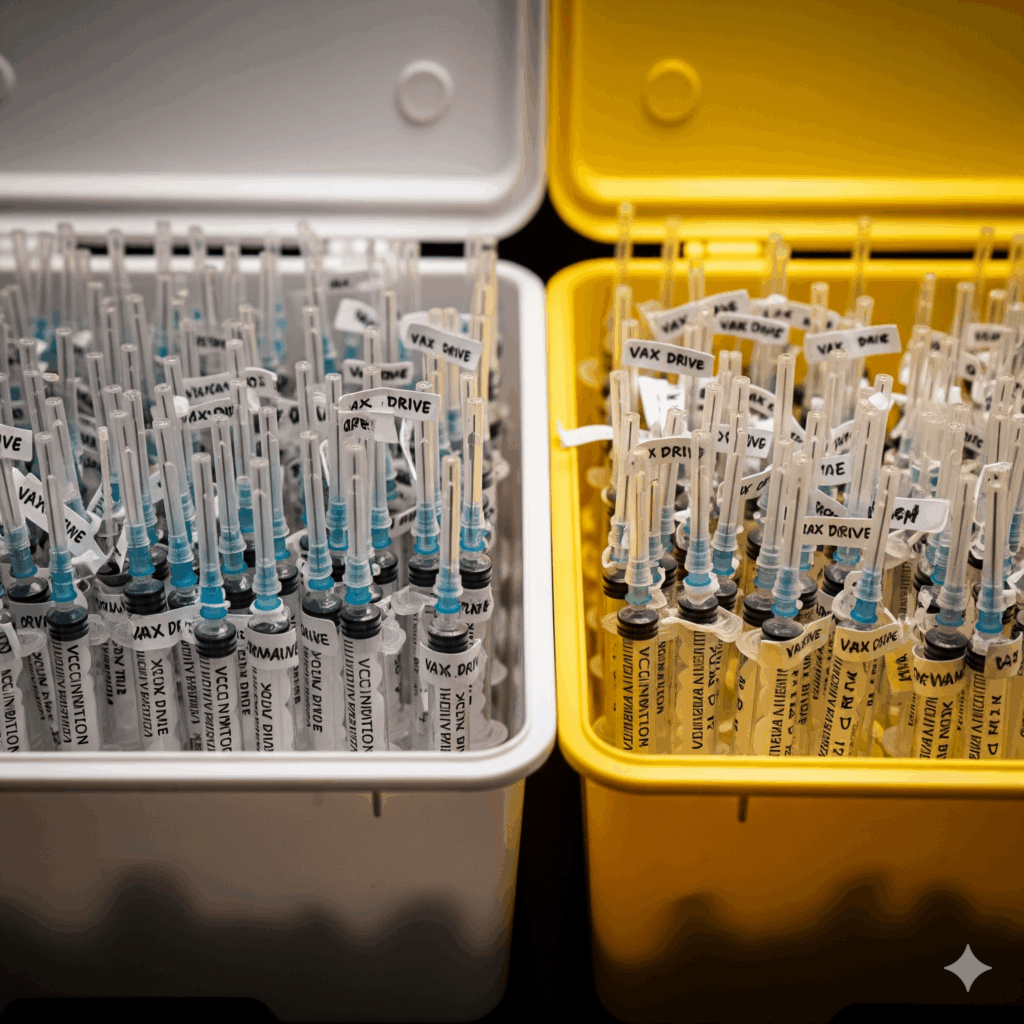Es war eine Szenerie wie für ein Historiendrama inszeniert: Auf dem schottischen Golfplatz von Donald Trump in Turnberry, umgeben von grünen Weiten, trafen die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der amerikanische Präsident zusammen, um das Ende eines wochenlangen Wirtschaftskrimis zu besiegeln. Als nach kaum einer Stunde der weiße Rauch aufstieg und ein Handelsabkommen verkündet wurde, war die Erleichterung auf europäischer Seite fast mit Händen zu greifen. Die angedrohten 30-Prozent-Strafzölle, ein Damoklesschwert, das über der europäischen Wirtschaft schwebte, waren vom Tisch. Doch der Applaus für diesen vermeintlichen Triumph überdeckt nur mühsam das leise, aber unüberhörbare Knirschen im Fundament der transatlantischen Beziehungen.
Denn bei genauerem Hinsehen ist dieser Deal kein Geniestreich europäischer Diplomatie, sondern eine schmerzhafte Kapitulation. Es ist ein Frieden, der mit der Aufgabe von Prinzipien, mit Milliarden an Zugeständnissen und mit der Akzeptanz einer neuen, von Washington diktierten Realität erkauft wurde. Die Vereinbarung von Turnberry ist weniger ein Vertrag unter Gleichen als vielmehr das Zeugnis einer tiefen strategischen Krise Europas – eine Krise der Einheit, des Selbstbewusstseins und der Fähigkeit, dem Druck eines „Zollmannes“, wie Trump sich selbst gerne nennt, standzuhalten. Dieser Tag mag als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem ein Handelskrieg verhindert wurde. Er wird aber auch als der Tag erinnert werden, an dem Europa seine eigene Verhandlungsmacht verzwergte und einen hohen Preis für eine trügerische Sicherheit zahlte.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Preis der Erleichterung: Eine Kapitulation in Zahlen
Um die wahre Natur des Deals zu verstehen, muss man die Rhetorik des Erfolgs abstreifen und die nackten Zahlen betrachten. Die Einigung sieht einen allgemeinen Zollsatz von 15 Prozent auf die meisten europäischen Exporte in die USA vor, darunter Schlüsselprodukte wie Autos und Pharmazeutika. Dies wird als Erfolg verkauft, weil die angedrohte Rate von 30 Prozent vermieden wurde. Doch dieser Vergleich ist irreführend. Er ist, als wäre man dankbar, nur eine Ohrfeige statt zwei zu bekommen, und vergisst dabei, dass man vorher überhaupt nicht geschlagen wurde. Vor Trumps Zoll-Offensive lag der durchschnittliche US-Zoll auf EU-Waren bei etwa 2,2 Prozent. Der neue „Erfolg“ stellt also eine Versechs- oder Versiebenfachung der Belastung für europäische Unternehmen dar und zementiert ein protektionistisches Niveau, das jahrzehntelang undenkbar war.
Noch gravierender wird das Bild, wenn man die Gegenleistungen betrachtet. Während Europa die 15-Prozent-Hürde akzeptiert, werden amerikanische Autos künftig zollfrei in die EU importiert werden können – eine einseitige Begünstigung, die den internationalen Handelsregeln Hohn spricht. Hinzu kommt, dass die von Trump bereits verhängten, massiven Zölle auf Stahl und Aluminium von 50 Prozent weitgehend in Kraft bleiben. Europa hat hier, entgegen anfänglicher Hoffnungen, keine nennenswerte Erleichterung errungen.
Doch damit nicht genug. Die EU hat sich zu einem gigantischen Paket an Zusagen verpflichtet, das die Waage noch weiter zugunsten der USA neigt. Sie will für 750 Milliarden Dollar amerikanische Energie kaufen, darunter Gas und Öl, um sich von Russland zu lösen. Zusätzlich sollen 600 Milliarden Dollar in die amerikanische Wirtschaft investiert werden. Diese Summen, die Japans Zugeständnisse in einem ähnlichen Deal in den Schatten stellen, sind nicht nur ein gewaltiger wirtschaftlicher Transfer, sondern auch ein strategisches Instrument. Trump sichert seiner heimischen Energieindustrie auf Jahre hinaus einen riesigen Absatzmarkt und bindet Europa enger an die USA – zu seinen Konditionen.
Die wirtschaftlichen Folgen für Europa werden unweigerlich schmerzhaft sein. Besonders die exportorientierte deutsche Industrie trifft der Deal ins Mark. Für die so wichtigen Autohersteller, die bereits unter den bisherigen Zöllen litten, bedeutet der Satz von 15 Prozent eine massive und dauerhafte Belastung. Auch die Pharmaindustrie, ein weiterer Eckpfeiler des deutschen Exports, sieht sich mit den neuen Abgaben konfrontiert, wobei hier die Details sogar noch strittig sind und Trump höhere Zölle nicht explizit vom Tisch genommen hat. Ökonomen rechnen mit spürbaren Einbußen für das deutsche Bruttoinlandsprodukt, einer zusätzlichen Bremse für eine ohnehin fragile Konjunktur.
Die Anatomie einer Niederlage: Wie Europas Einheit zerbrach
Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte die EU, der größte Handelsblock der Welt, einen derart unausgewogenen Deal akzeptieren? Die Antwort liegt nicht nur in Trumps aggressivem Vorgehen, sondern vor allem in der inneren Verfasstheit Europas. Die Verhandlungsstrategie der Kommission unter Ursula von der Leyen war von Anfang an darauf ausgelegt, Trump zu besänftigen. Man verzichtete auf jede Provokation, ließ die angedrohten Gegenzölle in der Schublade und setzte alles auf die Karte, dem US-Präsidenten eine Bühne für seinen selbstinszenierten Triumph als „Dealmaker“ zu bieten. Diese Taktik mag einen offenen Handelskrieg verhindert haben, sie signalisierte aber vor allem Schwäche.
Die Wurzel dieser Schwäche ist die mangelnde Geschlossenheit. Hinter der Fassade einer gemeinsamen EU-Position tobten nationale Interessenkonflikte, die Trump meisterhaft auszunutzen wusste. Als der US-Präsident mit Strafzöllen von 200 Prozent auf Champagner drohte, wich selbst das sonst so selbstbewusste Frankreich zurück. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz wiederum setzte alles auf einen schnellen, notfalls auch „schmutzigen“ Deal, um die heimische Wirtschaft vor einer Eskalation zu bewahren, und untergrub durch eigene Gesprächskanäle mit Trump die gemeinsame europäische Front. Die EU agierte nicht wie ein Riese, sondern wie ein „Zusammenschluss von 27 Zwergen“.
Dieser Mangel an Einheit und Drohpotenzial, auch bedingt durch die militärische Abhängigkeit von den USA in Sicherheitsfragen, führte dazu, dass die EU am Verhandlungstisch deutlich schlechter abschnitt als andere. Der Vergleich mit dem Abkommen, das Großbritannien kurz zuvor erzielt hatte und das einen Basiszoll von nur 10 Prozent festschrieb, ist für Brüssel beschämend. Die EU, die stets ihr größeres wirtschaftliches Gewicht als Argument ins Feld geführt hatte, wurde eines Besseren belehrt. Das Ergebnis ist ein diplomatisches Zeugnis, das mehr über die Zerbrechlichkeit der europäischen Einheit als über die Verhandlungskunst Washingtons aussagt.
Ein Frieden auf brüchigem Fundament: Die Tücken des ungeschriebenen Wortes
Die Erleichterung über die Einigung könnte sich zudem als verfrüht erweisen, denn der Deal ist in Wahrheit weniger ein fertiges Vertragswerk als vielmehr ein „Rahmenabkommen“, eine Absichtserklärung voller vager Formulierungen und offener Fragen. Diese Unschärfe birgt erhebliches Konfliktpotenzial für die Zukunft und macht die gewonnene „Planungssicherheit“ zu einem äußerst relativen Gut.
Die Liste der Unklarheiten ist lang. Beim Stahl etwa interpretieren beide Seiten den Deal unterschiedlich: Während Trump darauf besteht, dass die 50-Prozent-Zölle bestehen bleiben, spricht von der Leyen von weiteren Verhandlungen über Quoten, die die Zölle senken könnten. Ähnlich verhält es sich bei Pharmazeutika und bei der Frage, welche Zölle für Wein und Spirituosen gelten sollen. Diese Punkte sind keine Fußnoten; es sind zentrale Streitfragen, die nun auf technischer Ebene weiterverhandelt werden müssen – mit ungewissem Ausgang.
Das Abkommen ist also keine endgültige Lösung, sondern eher eine Verschiebung des Konflikts. Es stabilisiert die Lage kurzfristig an der Oberfläche, während darunter die Gräben bestehen bleiben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rechtmäßigkeit von Trumps Zöllen in den USA selbst infrage steht; fast ein Dutzend Klagen sind anhängig, die das gesamte Konstrukt zum Einsturz bringen könnten. Der Frieden, den Europa zu einem so hohen Preis erkauft hat, steht auf einem juristisch und politisch äußerst brüchigen Fundament.
Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Europas schmerzhafte Suche nach sich selbst
Das Handelsabkommen von Turnberry markiert einen Wendepunkt. Es ist die endgültige Abkehr von der Ära des Multilateralismus und des regelbasierten Handels, die die transatlantischen Beziehungen über Jahrzehnte geprägt hat. An ihre Stelle ist eine Welt getreten, in der bilaterale Deals, Machtpolitik und das Recht des Stärkeren den Ton angeben. Trump hat dieses neue Spiel erzwungen, und Europa hat zähneknirschend zugestimmt, nach seinen Regeln zu spielen.
Was also kann, was muss Europa nun tun? Die Kommentare aus den eigenen Reihen sind eindeutig: Der Blick muss nach innen und zugleich weit nach außen gehen. Anstatt dem Zeitalter der Hyperglobalisierung nachzutrauern, muss die EU dringend ihre eigenen Hausaufgaben machen. Das bedeutet, den Binnenmarkt zu stärken, lähmende bürokratische Fesseln zu lösen und massiv in Innovationen und einen wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt zu investieren, um die eigene wirtschaftliche Resilienz zu erhöhen.
Gleichzeitig muss Europa seine Handelsbeziehungen diversifizieren und sich jenen Partnern zuwenden, die ebenfalls unter Trumps Protektionismus leiden. Der Ruf nach einem schnellen Abschluss des Abkommens mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten wird lauter, und auch ein Pakt mit Indien rückt in den Fokus. In einer Welt, die vom Konflikt zwischen den USA und China geprägt ist, könnte hier eine Chance für Europa liegen: die Chance, eine führende Rolle in einer Art ökonomischer Bewegung der Blockfreien zu übernehmen. Wenn sich die anderen abschotten, so die Devise, muss Europa sich öffnen.
Das Treffen in Schottland war somit mehr als nur eine Verhandlungsrunde. Es war ein Spiegel, der der Europäischen Union vorgehalten wurde. Das Bild, das er zeigte, ist das eines wirtschaftlichen Giganten mit dem politischen Selbstbewusstsein eines Zwerges. Die zentrale Frage für die Zukunft wird sein, ob Europa die Kraft findet, aus dieser schmerzhaften Erfahrung die richtigen Lehren zu ziehen. Ob es die interne Zerrissenheit überwindet und lernt, mit einer Stimme zu sprechen, die in Washington, Peking und dem Rest der Welt nicht mehr zu überhören ist. Der Deal mit Trump war keine Lösung. Er war ein Weckruf. Es liegt an Europa, ob es ihn hört.