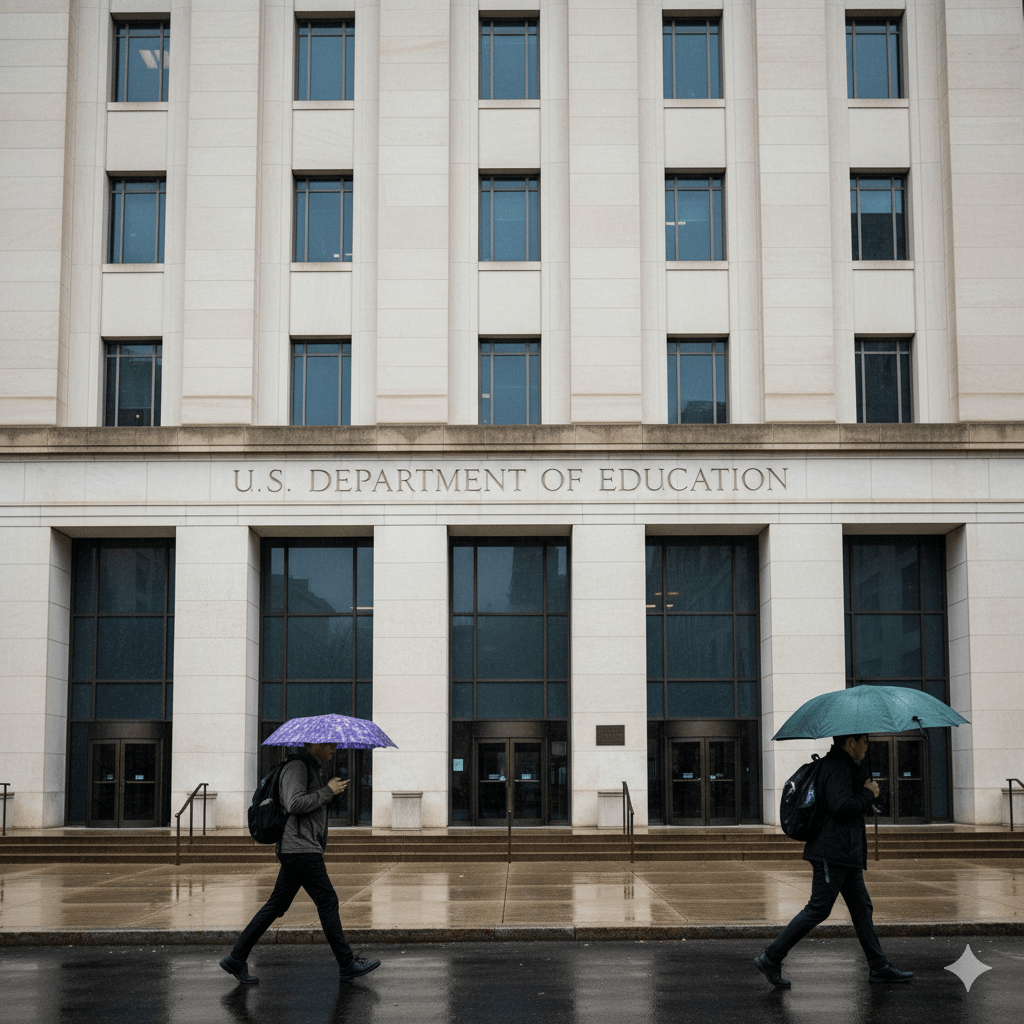Es lag eine seltene, fast greifbare Erleichterung in der Brüsseler Luft an diesem Donnerstagmorgen. Als der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj zum EU-Gipfel eintraf, wirkte er entspannter als seit Langem. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas strahlte, sprach von einem „wichtigen Signal“.
Der Grund für die Euphorie: Nach Monaten des Zögerns, der Blockaden und der erratischen Signale schien der Westen über Nacht seine Entschlossenheit wiedergefunden zu haben. Wie es ein Kommentator ausdrückte, waren gleich zwei „sehr große und sehr sture Kühe vom Eis geholt worden“.
Der eine „Stier“, der slowakische Premier Robert Fico, hatte seinen Widerstand gegen das 19. EU-Sanktionspaket aufgegeben. Der andere, weitaus unberechenbarere „Stier“ stand in Washington und hörte auf den Namen Donald J. Trump. Völlig überraschend hatte der US-Präsident „ungeheuer große“ Sanktionen gegen Russlands Ölgiganten Rosneft und Lukoil verhängt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Es ist ein transatlantischer Doppelschlag, der Moskaus Kriegsmaschinerie empfindlich treffen soll. Doch dieser Moment der synchronisierten Härte, so willkommen er in Kiew und Brüssel sein mag, ist trügerisch. Er markiert zwar einen Wendepunkt im Wirtschaftskrieg, offenbart aber bei genauerem Hinsehen tiefe Risse im westlichen Fundament. Denn die wahre Schlagkraft dieser neuen Sanktionsfront hängt nicht an den Beschlüssen selbst, sondern an drei höchst unsicheren Variablen: der Nachhaltigkeit von Trumps plötzlicher Wut, der realen Folgsamkeit globaler Ölkäufer wie Indien und der Fähigkeit Europas, seine eigene schärfste Finanzwaffe endlich zu entsichern.
Trumps Kehrtwende: Vom Zickzack zum Paukenschlag
Um die Wucht der Washingtoner Entscheidung zu verstehen, muss man sich den Kurs von Donald Trump in den Wochen zuvor vergegenwärtigen. Es war ein Zickzack-Manöver, das Europas Diplomaten zur Verzweiflung trieb.
Erst kokettierte Trump laut mit der Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine, was den Kreml sichtlich nervös machte. Dann, nach einem zweistündigen Telefonat mit Wladimir Putin, schien alles anders. Ein Gipfeltreffen in Budapest wurde aus heiterem Himmel vereinbart, die Tomahawk-Idee kassiert und Selenskyj bei einem frostigen Treffen im Weißen Haus nahegelegt, über Gebietsabtretungen nachzudenken.
Doch Putin, vielleicht im Glauben, Trump bereits im Griff zu haben, überzog sein Blatt. Russlands Außenminister Lawrow ließ den Westen wissen, man werde einem Waffenstillstand an den aktuellen Frontlinien nicht zustimmen. Man müsse erst die „Wurzeln des Konflikts“ lösen – eine Chiffre für die Kapitulation und Entmilitarisierung der Ukraine.
Für Trump war dies offenbar die Demütigung zu viel. Frustriert über Putins mangelnden Friedenswillen und die rüde Absage des Gipfels, ließ er die Diplomatie platzen, weil er „keine Zeit verschwenden“ wollte. Stattdessen griff er zur Keule.
In der Nacht zum Donnerstag, „vollkommen ohne Vorwarnung“ für die Europäer, verhängte das US-Finanzministerium die härtesten Sanktionen gegen den russischen Energiesektor seit Kriegsbeginn. Es ist das erste Mal seit Trumps Amtsantritt, dass er eine derart harte Strafmaßnahme gegen Moskau tatsächlich umsetzt.
Die Dollar-Waffe: Warum diese Sanktionen anders sind
Auf den ersten Blick ähneln die Maßnahmen früheren Paketen: Vermögen in den USA werden eingefroren, US-Bürgern der Handel verboten. Doch die wahre Sprengkraft liegt tiefer. Die USA zielen nicht primär auf Rosneft und Lukoil selbst, sondern auf deren globale Kunden. Der Mechanismus nennt sich Sekundärsanktionen. Jede ausländische Bank, jede Raffinerie, jeder Händler, der weiterhin Geschäfte mit den sanktionierten russischen Firmen macht, riskiert, selbst auf die schwarze Liste der USA zu geraten. Das bedeutet den potenziellen Ausschluss vom US-Dollar-System – ein Todesurteil für jedes international tätige Unternehmen.
Das Ziel ist klar: Man will die Lebensadern der russischen Kriegswirtschaft kappen, die durch den Ölverkauf an Drittstaaten gespeist wird. Die USA machen Russlands wichtigste verbliebene Partner vor die Wahl: Handelt mit Moskau oder handelt mit uns.
Indien im Fadenkreuz, China im Wartestand
Die unmittelbaren Folgen dieser Drohung zeigen sich Tausende Kilometer von Washington entfernt. Während China, Russlands wichtigster politischer Unterstützer, sich kurzfristig wenig beeindruckt zeigen dürfte, gerät der zweitgrößte Abnehmer massiv unter Druck: Indien.
Erste Berichte deuten darauf hin, dass der Schuss sitzt. Indische Raffinerien, darunter der Gigant Reliance Industries, erwägen laut Nachrichtenagenturen bereits, ihre Rohölimporte aus Russland drastisch zu senken oder ganz einzustellen. Auch chinesische Staatsraffinerien sollen Käufe für November ausgesetzt haben.
Die Nervosität ist verständlich. Kein indischer Konzern kann es sich leisten, den Zugang zum US-Markt zu verlieren, nur um weiterhin günstiges russisches Öl zu kaufen. Der globale Ölpreis reagierte prompt auf die drohende Verknappung und sprang um über 5 Prozent auf rund 66 Dollar pro Barrel.
Europas zähes Ringen: Der späte LNG-Bann
Fast zeitgleich mit Trumps Paukenschlag finalisierte die EU in Brüssel ihr 19. Sanktionspaket. Auch hier steht die Energie im Fokus. Erstmals einigte sich die Union darauf, den Import von russischem Flüssigerdgas (LNG) zu verbieten.
Das klingt nach einem Durchbruch. Doch die Details ernüchtern: Das Verbot soll erst ab dem 1. Januar 2027 vollständig greifen. Bis dahin fließt das Geld weiter. Das ist umso erstaunlicher, als die EU in den vergangenen Monaten der wichtigste Kunde für russisches LNG war und Moskau damit Einnahmen von rund 700 Millionen Euro pro Monat bescherte.
Dem Beschluss war ein unwürdiges politisches Tauziehen vorausgegangen. Der slowakische Premier Robert Fico, kein Freund der EU-Ukraine-Politik, hatte seine Zustimmung wochenlang blockiert. Er nutzte sein Veto, um sachfremde Forderungen durchzusetzen – Brüssel sollte sich gefälligst um die Rettung der europäischen Autoindustrie und explodierende Energiepreise kümmern. In Diplomatenkreisen nannte man dies schlicht „Erpressung“. Am Ende gab Fico nach, die Frist verstrich, das Paket war beschlossen.
Neben dem späten LNG-Bann enthält das Paket weitere Maßnahmen: Mehr als 100 Schiffe der russischen „Schattenflotte“ werden auf eine schwarze Liste gesetzt, ebenso Banken, die bei der Sanktionsumgehung helfen – darunter auch chinesische Raffinerien. Zudem wird die Bewegungsfreiheit russischer Diplomaten im Schengen-Raum eingeschränkt, um Spionage einzudämmen.
Die 140-Milliarden-Frage: Belgiens Blockade
Doch während die Staats- und Regierungschefs diese Einigung feierten, blieb die mit Abstand brisanteste Frage auf dem Gipfeltisch ungelöst. Es geht um die „Atombombe“ der Finanzsanktionen: die rund 140 Milliarden Euro an eingefrorenem Vermögen der russischen Zentralbank, die beim Finanzdienstleister Euroclear in Belgien liegen. Selenskyj fordert seit Langem, dieses Geld für die Ukraine nutzbar zu machen. Der Plan: Die Vermögen sollen als Sicherheit für einen gigantischen Kredit dienen, um Kiews Waffenkäufe für die nächsten Jahre zu sichern.
Der Schritt wäre ein Fanal für Putin. Doch das Vorhaben scheitert am Widerstand eines Mannes: Bart De Wever, der belgische Premierminister. De Wevers Bedenken sind nicht politischer, sondern juristischer und finanzieller Natur. Ausländisches Staatsvermögen zu konfiszieren, sei völkerrechtswidrig, argumentiert er. Der Flame hat keine Lust, dass sein kleines Land von Russland irgendwann für diese gigantische Summe in Haftung genommen wird, nachdem der Rest der EU das Geld nach Kiew überwiesen hat. Er fordert eine volle, wasserdichte Risikoübernahme durch alle EU-Partner. Bis zum Abend gelang es nicht, diese Blockade zu lösen. Die metaphorische „Faltohrkatze“ des Premiers blieb auf dem Eis.
Russlands doppelte Krise: Sanktionen und Drohnen
In Moskau reagierte man auf den Doppelschlag aus Washington und Brüssel mit der erwartbaren Mischung aus Verachtung und Drohgebärden. Putins Sprecherin Maria Sacharowa nannte die US-Sanktionen „kontraproduktiv“. Der scharfmachende Ex-Präsident Dmitri Medwedew tobte, Trump habe sich „endgültig auf den Kriegspfad mit Russland begeben“. Putin selbst bezeichnete den Schritt als „unfreundlichen Akt“, warnte vor globalen Preissteigerungen und drohte mit einer „niederschmetternden“ Antwort, sollte die Ukraine Tomahawks erhalten.
Russland werde nicht unter Druck nachgeben, so der Tenor. Doch die Rhetorik kann kaum verbergen, dass die neuen Maßnahmen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommen. Russlands Wirtschaft ist bereits angeschlagen. Die weltweiten Rohölpreise sind seit Längerem im Sinkflug, was die Staatseinnahmen empfindlich schrumpfen lässt. Weit schmerzhafter als jede Sanktion sind jedoch die anhaltenden und immer präziseren ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien tief im Hinterland. Erst in der Nacht zu Donnerstag traf es erneut das Werk bei Rjasan.
Diese Angriffe führen zu wochenlangen Produktionsausfällen, Treibstoffknappheit in Teilen Russlands und treiben die Benzin- und Dieselpreise. Die Inflation, die man mühsam einzudämmen versuchte, steigt wieder auf über acht Prozent. Putins Wirtschaftsteam gerät zunehmend in die Zwickmühle zwischen Inflationsbekämpfung und der Notwendigkeit, die Kriegsökonomie am Laufen zu halten.
Ein Moment der Hoffnung – mehr nicht
Wird dieser koordinierte Druck nun die Wende bringen? Die Skepsis ist groß. Analysten wie Janis Kluge warnen vor überzogenen Hoffnungen. Die unmittelbaren Folgen dürften sich in Grenzen halten.
Russland, so die bittere Erfahrung der letzten Jahre, hat eine beunruhigende „Immunität“ gegen Sanktionen entwickelt. Das Beispiel des Gasprojekts „Arctic LNG 2“ zeigt die Hilflosigkeit des Westens: Obwohl das Projekt seit Jahren auf derselben US-Sanktionsliste steht wie nun Rosneft und Lukoil, finden sich Wege. Nach langem Stillstand läuft seit August der Export – nach China. Mindestens zehn Ladungen wurden entladen, weitere sind unterwegs. Sekundärsanktionen gegen die chinesischen Käufer? Fehlanzeige. Die Wirksamkeit von Sanktionen hängt nicht von ihrer Verkündung ab, sondern von ihrer gnadenlosen Durchsetzung.
Niemand weiß das besser als Wolodimir Selenskyj. Er lobte die neuen Pakete pflichtschuldig, fügte aber eine entscheidende Klarstellung hinzu: „Druck bedeutet Sanktionspakete, Flugabwehr mit großer Reichweite und natürlich finanzielle Unterstützung“. Die Sanktionen sind ein wichtiges Signal, aber sie sind nicht der Schlüssel zum Frieden. Den sieht Kiew in Waffen wie den Tomahawks, die Russland an den Verhandlungstisch zwingen könnten.
Die Erleichterung in Brüssel war echt. Der Westen hat gezeigt, dass er noch handeln kann. Doch ob dieser plötzliche Anfall von Entschlossenheit nachhaltig ist oder nur eine weitere Laune eines unberechenbaren US-Präsidenten, der frustriert ist, weil sein Gipfel geplatzt ist, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.