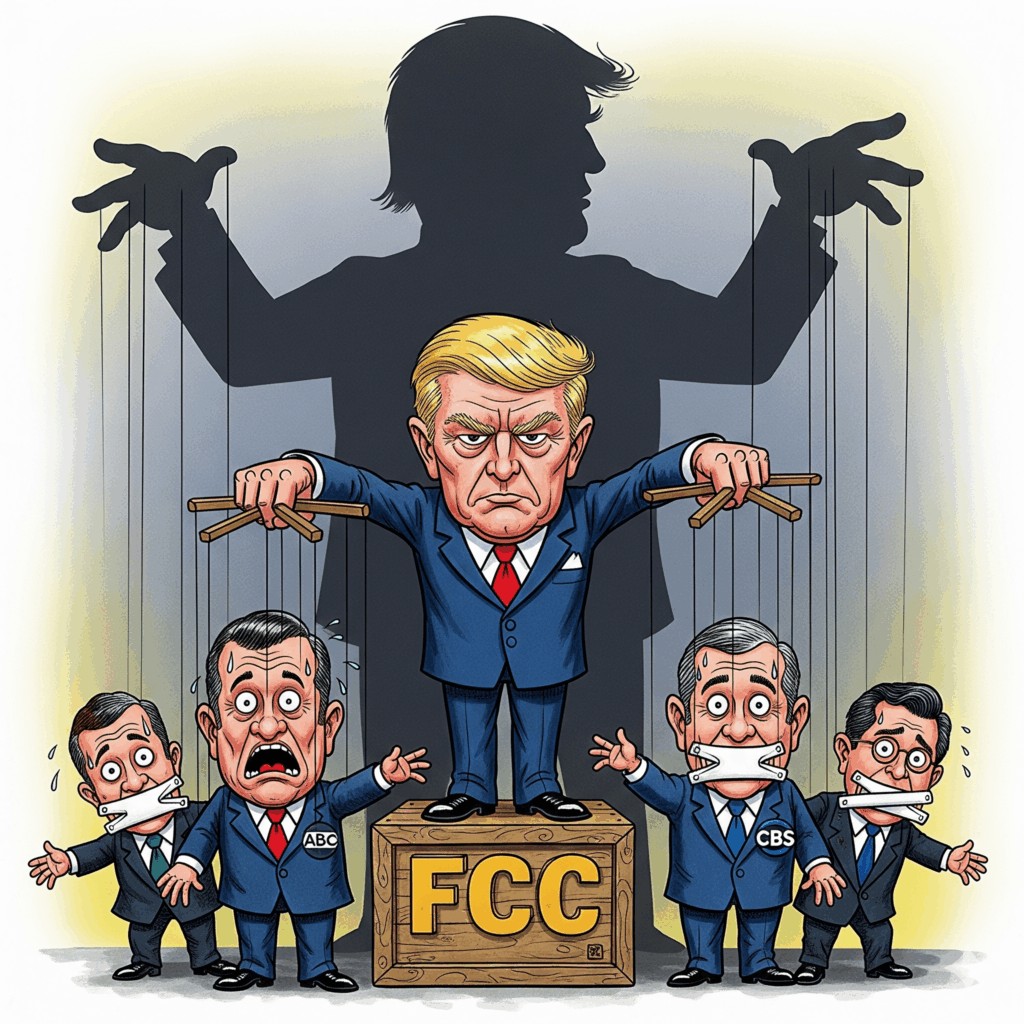Es sollte ein goldenes Zeitalter werden, ein Feuerwerk des Wohlstands, gezündet von einem Präsidenten, der versprach, Amerika wieder groß zu machen. Doch die Realität, die sich in den Spätsommertagen dieser zweiten Amtszeit von Donald Trump abzeichnet, ist kein glänzendes Epos, sondern ein grauer Morgen nach einer zu lauten Nacht. Das Jobwachstum, einst der stolze Motor der Nation, ist ins Stottern geraten. Die Inflation, jenes hartnäckige Gespenst, das man besiegt glaubte, schleicht wieder durch die Supermärkte. Die düstere Ahnung einer Rezession legt sich wie ein feuchter Nebel über das Land.
Im Zentrum dieses ökonomischen Dramas steht eine scheinbar einfache Frage, die jedoch tiefe ideologische Gräben aufreißt: Wer trägt die Schuld? Fragt man das Weiße Haus, ist der Fall klar. Der Sündenbock sitzt in der US-Notenbank Federal Reserve und heißt Jerome Powell. Er sei „Too Late“, zu zögerlich, ein Bremser, der mit seiner Geldpolitik die aufkeimende Konjunktur abwürge. Doch blickt man hinter die Kulissen der Schuldzuweisungen, entfaltet sich eine andere, weitaus beunruhigendere Erzählung. Es ist die Geschichte einer Krise, die nicht vom Himmel fiel, sondern hausgemacht ist – das direkte, fast unausweichliche Resultat jener Politik, die eigentlich den großen Aufschwung bringen sollte.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Anatomie eines selbst geschaffenen Abschwungs
Um die aktuelle Schwäche zu verstehen, muss man die zentralen Säulen der Trump’schen Wirtschaftsdoktrin betrachten: eine aggressive Zollpolitik und eine unerbittliche Einwanderungsstrategie. Beide wurden als Schutzmaßnahmen für den amerikanischen Arbeiter konzipiert. Doch sie wirken zunehmend wie ein Gift, das langsam, aber sicher in den Blutkreislauf der Wirtschaft eindringt.
Die Zölle, einst als Schutzschild für die heimische Industrie gepriesen, erweisen sich als Bumerang. Anstatt eine Renaissance der Manufakturen einzuläuten, haben die ständigen, oft erratischen Ankündigungen von Strafzöllen ein Klima der totalen Verunsicherung geschaffen. Unternehmen, die für Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen Planungssicherheit benötigen, stehen vor einem undurchsichtigen Dickicht aus Handelsregeln. Die Folge ist eine Investitionsstarre. Warum eine neue Fabrikhalle bauen, wenn über Nacht die Kosten für Vorprodukte explodieren oder der Zugang zu wichtigen Absatzmärkten versperrt werden könnte? Die Zahlen sprechen eine brutale Sprache: Anstatt zu wachsen, hat die Fabrikbeschäftigung seit Februar spürbar abgenommen. Die erhoffte Wiedergeburt entpuppt sich als Aderlass.
Gleichzeitig führt die harte Linie in der Migrationspolitik zu einer Verknappung des wichtigsten wirtschaftlichen Rohstoffs: des Menschen. Die massive Reduzierung der ausländischen Bevölkerung, die allein in der ersten Jahreshälfte um über eine Million Menschen geschrumpft ist, reißt tiefe Lücken in den Arbeitsmarkt. Dies betrifft nicht nur die Landwirtschaft oder das Baugewerbe, sondern bremst das potenzielle Wachstum der gesamten Volkswirtschaft. Gekoppelt mit der demografischen Alterung der Gesellschaft entsteht so ein struktureller Mangel an Arbeitskräften, der das monatliche Jobwachstum um eine sechsstellige Zahl drosselt. Der Versuch, die Grenzen zu schließen, schnürt der Wirtschaft langsam die Luft ab.
Verschärft wird dieser doppelte Druck durch eine Politik, die den Staat selbst schwächt. Der Abbau von Stellen im öffentlichen Dienst auf Bundesebene mag ideologisch gewollt sein, entzieht der Konjunktur aber eine wichtige Stütze. Noch dramatischer wirkt sich Trumps „One Big Beautiful Bill“ auf die Bundesstaaten aus. Indem die finanzielle Verantwortung für milliardenschwere Sozialprogramme wie Medicaid auf deren Schultern verlagert wird, geraten ohnehin schon klamme Staatshaushalte unter massiven Druck. Das Ergebnis ist ein Teufelskreis: Die Staaten müssen sparen, kürzen Stellen und Investitionen, was die regionale Wirtschaft weiter schwächt und den Abwärtsdruck auf die Gesamtwirtschaft erhöht.
Das Weiße Haus: Zwischen Realitätsverweigerung und Vertröstung
Angesichts dieser selbst geschaffenen Probleme flüchtet sich die Administration in eine Doppelstrategie aus Schuldzuweisung und Vertröstung. Die öffentliche Attacke auf die Federal Reserve ist dabei mehr als nur ein politisches Ablenkungsmanöver; sie offenbart einen fundamentalen Zielkonflikt. Die Fed ist per Mandat der Preisstabilität verpflichtet und muss die Inflation im Auge behalten, die mit knapp unter drei Prozent immer noch deutlich über dem Zielkorridor von zwei Prozent liegt. Trumps Forderung nach radikalen Zinssenkungen von drei vollen Prozentpunkten ignoriert diese Realität vollständig. Er verlangt von der Notenbank, die Symptome mit billigem Geld zu betäuben, während die Ursachen – seine eigene Politik – unangetastet bleiben. Es ist der Versuch, ein strukturelles Problem mit monetären Schmerzmitteln zu behandeln.
Gleichzeitig appelliert die Regierung an die Geduld der Amerikaner. Wirtschaftsminister Scott Bessent spricht von einer notwendigen „Detox-Periode“, einer Entgiftung von der Abhängigkeit staatlicher Jobs. Man müsse erst durch ein schmerzhaftes Tal schreiten, um das versprochene goldene Zeitalter zu erreichen. Diese Rhetorik ist politisch hochriskant. Sie erinnert fatal an die Kommunikation der Biden-Administration, die die aufkommende Inflation lange als „vorübergehend“ abtat – eine Fehleinschätzung, die bei den Wählern nachhaltig Vertrauen kostete. Den Menschen zu sagen, sie sollen die Zähne zusammenbeißen und auf bessere Zeiten warten, während ihre Jobs wackeln und die Preise steigen, ist ein Spiel mit dem Feuer.
Ein letzter Strohhalm, an den sich die Regierung klammert, ist die Hoffnung auf statistische Gnade. Es ist korrekt, dass die ersten Schätzungen der Arbeitsmarktdaten, insbesondere im urlaubsreichen August, oft nach oben korrigiert werden. Doch sich auf mögliche statistische Ungenauigkeiten zu berufen, während alle fundamentalen Indikatoren nach unten zeigen, wirkt wie der verzweifelte Versuch, das Ticken einer Zeitbombe mit dem Rascheln von Papier zu übertönen. Es mag eine Korrektur geben, aber sie wird den übergeordneten Trend der Abkühlung kaum umkehren können.
Amerikas unsichere Zukunft: Zwei Wege im Nebel
Wie geht es nun weiter? Die amerikanische Wirtschaft steht an einem Scheideweg und der weitere Pfad hängt entscheidend von der Reaktion der Federal Reserve ab. Gibt sie dem massiven politischen Druck aus dem Weißen Haus nach und leitet eine Serie aggressiver Zinssenkungen ein? Dies könnte kurzfristig den Immobilienmarkt beleben und die Konjunktur stützen. Doch das Risiko wäre immens: Eine zu lockere Geldpolitik könnte die Inflation wieder anheizen und die Glaubwürdigkeit der Notenbank als unabhängige Institution nachhaltig beschädigen. Es wäre ein kurzfristiger Sieg für den Präsidenten, aber potenziell ein langfristiger Verlust für die Stabilität der Wirtschaft.
Der alternative Weg wäre, dass die Fed einen vorsichtigeren Kurs fährt, mit moderaten Zinsschritten auf die Abschwächung reagiert, aber ihr Inflationsziel nicht aus den Augen verliert. Dies würde der Wirtschaft zwar weniger künstlichen Rückenwind verleihen, aber ihre strukturellen Probleme deutlicher zutage treten lassen. Der politische Druck auf Trump würde in diesem Szenario weiter wachsen, da er nicht länger auf die Notenbank als Retter in der Not zählen könnte.
Unabhängig vom Kurs der Fed bleibt die fundamentale Erkenntnis bestehen: Die aktuelle wirtschaftliche Malaise ist keine unglückliche Fügung des Schicksals oder das Versagen einer unabhängigen Institution. Sie ist die logische, fast zwangsläufige Konsequenz einer Politik, die auf Abschottung statt auf Offenheit, auf Unsicherheit statt auf Verlässlichkeit setzt. Das versprochene goldene Zeitalter erweist sich als eine Fata Morgana in einer Wüste, die man selbst geschaffen hat. Die entscheidende Frage für die kommenden Monate wird sein, wie lange die Wähler bereit sind, einem Führer durch diese Wüste zu folgen, der ihnen unablässig versichert, dass die Oase gleich hinter der nächsten Düne liegt.