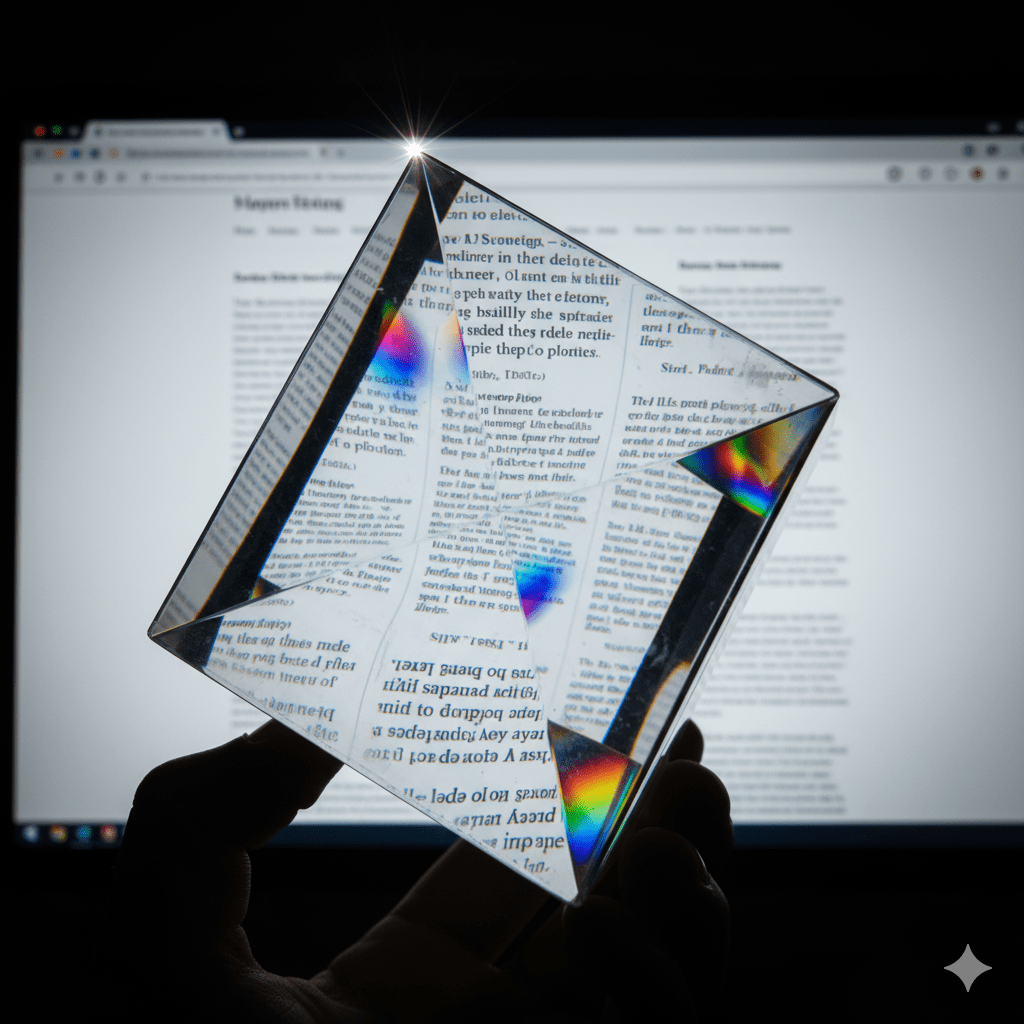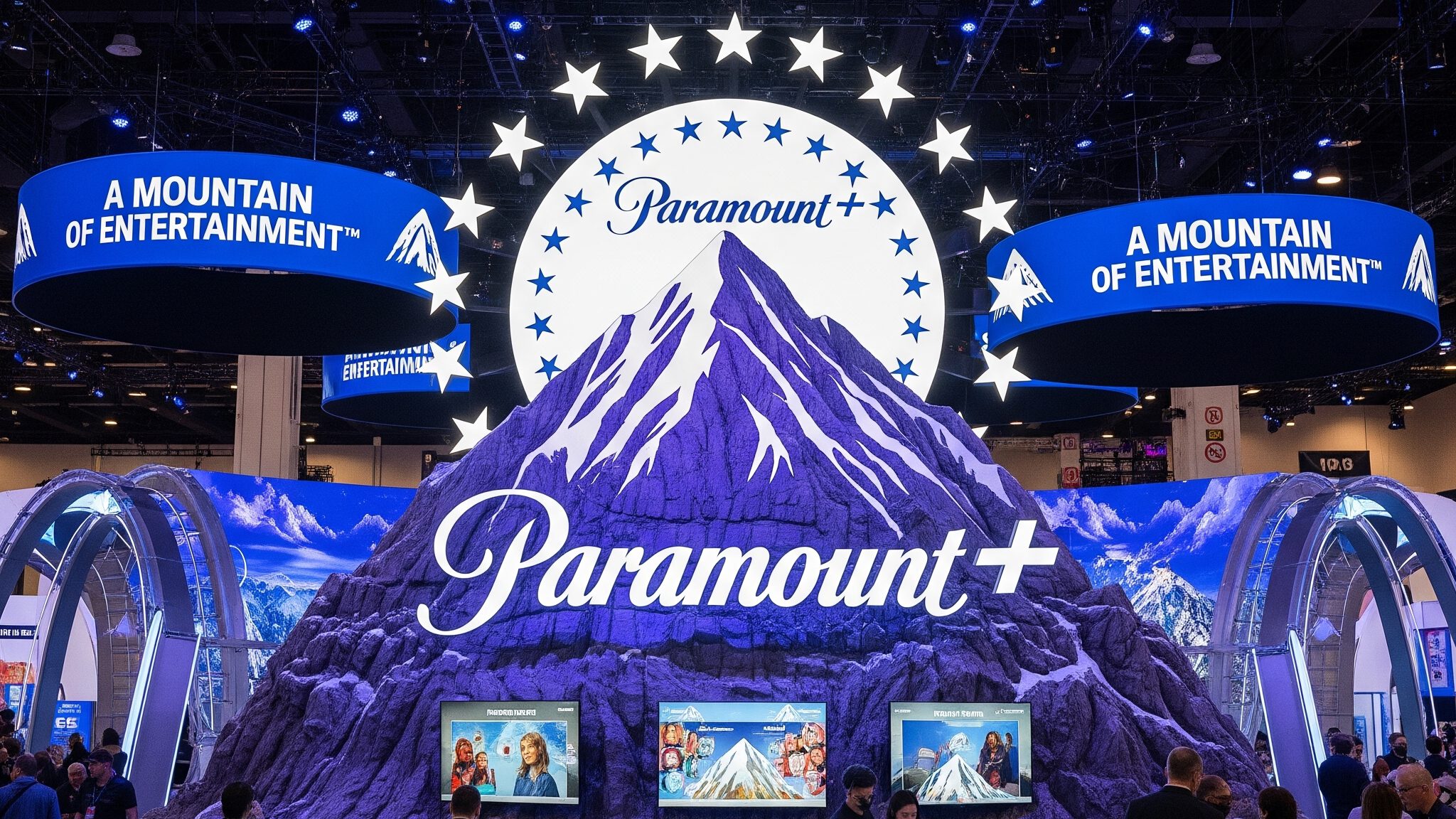
Es ist eine Szene wie aus einem schlechten Drehbuch, und doch entfaltet sie sich auf der größten politischen Bühne der Welt. Ein Medienriese, Erbe einer stolzen journalistischen Tradition, knickt vor dem Druck des mächtigsten Mannes im Staat ein. Es geht um acht Milliarden Dollar, um die Zukunft eines legendären Hollywood-Studios und um weit mehr als das: um die Seele des amerikanischen Journalismus. Die Fusion von Paramount Global und Skydance Media, von der US-Aufsichtsbehörde FCC im Juli 2025 genehmigt, ist keine gewöhnliche Wirtschaftsgeschichte. Sie ist das fast schon erschütternd klare Protokoll einer Unterwerfung, ein Lehrstück darüber, wie in der Ära Trump politische Macht, wirtschaftliche Interessen und die Angst vor Konsequenzen eine toxische Allianz eingehen, die das Fundament der Pressefreiheit erodieren lässt.
Dies ist die Anatomie eines Deals, bei dem der größte Gewinner von Anfang an feststand: Donald Trump. Und die Verlierer, so formulierte es eine mutige Gegenstimme in der zuständigen Behörde, sind die Pressefreiheit und das Recht auf freie Rede – Grundpfeiler, die im ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung verankert sind.
Der Zangengriff: Wie eine Klage und eine Behörde zum politischen Werkzeug wurden
Um die Logik dieser Kapitulation zu verstehen, muss man den kunstvollen, fast schon dreisten Zangengriff begreifen, den die Trump-Administration ansetzte. Auf der einen Seite stand eine Klage, die selbst von juristischen Experten als „hanebüchen und haltlos“ beschrieben wurde. Donald Trump verklagte die Paramount-Tochter CBS auf 20 Milliarden Dollar Schadenersatz. Der Vorwurf: Die renommierte Sendung „60 Minutes“ habe ein Interview mit seiner damaligen Gegenkandidatin Kamala Harris so vorteilhaft geschnitten, dass es den Wahlkampf zu seinen Ungunsten beeinflusst habe. Obwohl CBS die Vorwürfe mit der Veröffentlichung von Transkripten zu entkräften versuchte und juristisch in einer starken Position schien, schwebte die Klage wie ein Damoklesschwert über dem Konzern.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Auf der anderen Seite des Zangengriffs agierte die Federal Communications Commission (FCC), jene Behörde, die den für die Fusion nötigen Transfer von Sendelizenzen genehmigen musste. An ihrer Spitze: Brendan Carr, ein von Trump installierter Loyalist, der seine Nähe zum Präsidenten offen zur Schau stellt – sei es durch einen goldenen Trump-Anstecker am Revers oder Kommentare auf Social Media. Carr, von Kritikern als „Medien-Pitbull von Trump“ bezeichnet, nutzte die Macht der Behörde, um den Druck zu maximieren. Er leitete Untersuchungen gegen Paramount-Töchter ein und drohte, den für die Fusion essenziellen Lizenztransfer zu blockieren – mit der Begründung, es liefen ja Ermittlungen gegen CBS. Jene Ermittlungen, die auf der Klage ihres gemeinsamen Gönners basierten.
In dieser Zwickmühle, mit einem Multi-Milliarden-Dollar-Deal auf dem Spiel, entschied sich Paramount für den Weg des geringsten Widerstands. Anstatt den Rechtsstreit auszufechten, zahlte der Konzern 16 Millionen Dollar, um die Klage aus der Welt zu schaffen. Es war, wie viele Kritiker es sahen, keine juristische Notwendigkeit, sondern ein Akt der „vorauseilenden Furcht“ und des Appeasements – ein teuer erkaufter Frieden, um die Genehmigung der Fusion nicht zu gefährden.
Der Preis des Friedens: Ein Sender im Umbruch
Die Zahlung war jedoch nur der sichtbarste Teil des Preises. Im Inneren des CBS-Gebäudes, einst die journalistische Heimat von Legenden wie Edward R. Murrow, der sich einst dem McCarthyismus widersetzte, hinterließ der Druck tiefe Spuren. Die Monate vor der endgültigen Genehmigung waren von einer Serie von Ereignissen geprägt, die wie die Dominosteine einer sorgfältig geplanten Kapitulation fielen.
Zuerst gingen die Führungskräfte, die offenbar nicht bereit waren, den Kurs der Unterwerfung mitzutragen. Im April trat Bill Owens, der langjährige ausführende Produzent der preisgekrönten Sendung „60 Minutes“, zurück und beklagte, dass er die Show nicht mehr so leiten dürfe, wie er es gewohnt war, ein klarer Hinweis auf Einmischung von oben. Nur einen Monat später folgte Wendy McMahon, die Chefin von CBS News, die ihren Abschied mit unüberbrückbaren Differenzen über den zukünftigen Kurs des Unternehmens begründete.
Der wohl symbolträchtigste Akt war jedoch die angekündigte Absetzung von „The Late Show with Stephen Colbert“. Colbert, einer der schärfsten und prominentesten Satiriker und Kritiker Donald Trumps, hatte die Zahlung seines Senders an Trump als „fette Bestechung“ bezeichnet. Die offizielle Begründung des Senders für das Ende der Show lautete, es sei eine „rein finanzielle Entscheidung“ gewesen, da das Late-Night-Fernsehen wirtschaftlich kollabiere. Doch der Zeitpunkt und der Kontext ließen bei vielen Beobachtern, darunter auch demokratische Abgeordnete, erhebliche Zweifel an dieser Darstellung aufkommen und nährten den Verdacht, dass hier ein kritischer Geist geopfert wurde, um den Deal zu retten.
Die neuen Regeln: Wie „Vielfalt der Ansichten“ zur Chiffre wird
Als die Genehmigung schließlich erteilt wurde, wurde deutlich, welche Gegenleistungen die neuen Eigentümer von Skydance erbringen mussten. In einer Erklärung begrüßte FCC-Chef Carr die Zusage von Skydance, bei CBS „bedeutende Veränderungen“ vorzunehmen. Diese Veränderungen lesen sich wie ein Katalog konservativer Medienkritik. Skydance versprach schriftlich, dass Nachrichten- und Unterhaltungsprogramme eine „Diversität der Ansichten“ zum Ausdruck bringen würden, um „fair, unvoreingenommen und faktenbezogen“ zu berichten. Zudem wurde die Einrichtung einer Ombudsstelle für zwei Jahre zugesagt, die die politische Neutralität überwachen soll.
Am brisantesten ist jedoch die Zusage, im neuen Konzern auf sogenannte DEI-Programme zu verzichten. DEI steht für Diversity, Equity, and Inclusion (Vielfalt, Gleichheit, Inklusion) – Programme, die in der konservativen Agenda seit Langem ein Feindbild sind. Carr hatte die Abschaffung solcher Programme bereits bei früheren Fusionen zur Bedingung gemacht. Was Carr als notwendige Korrektur feierte, um das Vertrauen der Amerikaner in die Medien wiederherzustellen, sahen Kritiker als einen direkten Angriff auf die redaktionelle und unternehmerische Freiheit.
Die FCC-Kommissarin Anna Gomez, die als Einzige gegen den Deal stimmte, fand dafür drastische Worte. Sie warf der Behörde vor, Paramount erpresst zu haben, einen privaten Rechtsstreit beizulegen, und „nie dagewesene Kontrollen über journalistische Entscheidungen und redaktionelle Urteile“ einzuführen – ein direkter Verstoß gegen die Verfassung. Ihre Stimme war die einer Warnerin in der Wüste, die beklagte, dass nach „Monaten der feigen Kapitulation“ nun die amerikanische Öffentlichkeit den Preis zahlen werde.
Satire als letztes Gefecht: Der Widerstand auf dem Bildschirm
Während die Chefetage kapitulierte, formierte sich der Widerstand dort, wo er am wenigsten zu erwarten, aber am schärfsten zu vernehmen war: auf den Bildschirmen der eigenen Sender. In einem bemerkenswerten Akt der Selbstkritik nutzten die Satiriker von Paramount ihre Plattformen, um die Moral ihres eigenen Unternehmens infrage zu stellen. Die Macher der Serie „South Park“ zeigten in einer Episode Jesus, der die Charaktere warnt, den Mund zu halten, da sie sonst wie Colbert enden würden, weil Paramount sich Trump gebeugt habe. Jon Stewart warf seinem Arbeitgeber in „The Daily Show“ vor, sein Flaggschiff-Nachrichtenprogramm verkauft zu haben, um eine „Erpressungsgebühr“ an den Präsidenten zu zahlen. Und Stephen Colbert selbst nutzte seine verbleibende Sendezeit für sardonische Kommentare über die angeblich „rein finanziellen Gründe“ für seine Absetzung. Diese internen Rebellionen zeigten eine tiefe Kluft zwischen der Unternehmensführung und den kreativen Talenten und offenbarten eine Atmosphäre der Fassungslosigkeit über die Vorgänge.
Der Fall Paramount steht dabei nicht isoliert da. Er folgt einem Muster, das sich bereits bei anderen Konzernen wie Disney zeigte, die ebenfalls Millionensummen an Trump-nahe Entitäten zahlten, um juristischen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Es scheint sich eine Strategie etabliert zu haben: die Androhung staatlicher Strafmaßnahmen, sei es durch Klagen oder regulatorischen Druck, um Unternehmen zu finanziellen und ideologischen Zugeständnissen zu zwingen.
Mit dem Abschluss des Deals tritt nun David Ellison, der Sohn des Oracle-Gründers und bekennenden Trump-Freundes Larry Ellison, an die Spitze des neuen Mediengiganten. Diese enge persönliche und finanzielle Verflechtung mit dem Machtzirkel um Trump lässt die Befürchtungen über die zukünftige journalistische Unabhängigkeit von CBS nur noch größer werden. Unter den Mitarbeitern herrscht nun das Gefühl, den Atem anzuhalten, in Erwartung dessen, was die neue Führung bringen wird. Es ist eine Mischung aus Angst und der leisen Hoffnung, die neue Führung möge die Wunden heilen und signalisieren, dass sie in den Journalismus investieren will, anstatt ihn weiter zu demontieren.
Die Geschichte der Paramount-Fusion ist somit mehr als eine Fußnote der Wirtschaftsgeschichte. Sie ist ein Menetekel. Sie zeigt, wie schnell die Mauern zwischen Staat und Presse bröckeln können, wenn wirtschaftliche Interessen über journalistische Prinzipien gestellt werden. Sie wirft die fundamentale Frage auf: Was bleibt von der verfassungsmäßig garantierten Freiheit der Presse, wenn ihre Wächter aus Angst vor den Konsequenzen lieber zahlen und schweigen, als für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen?