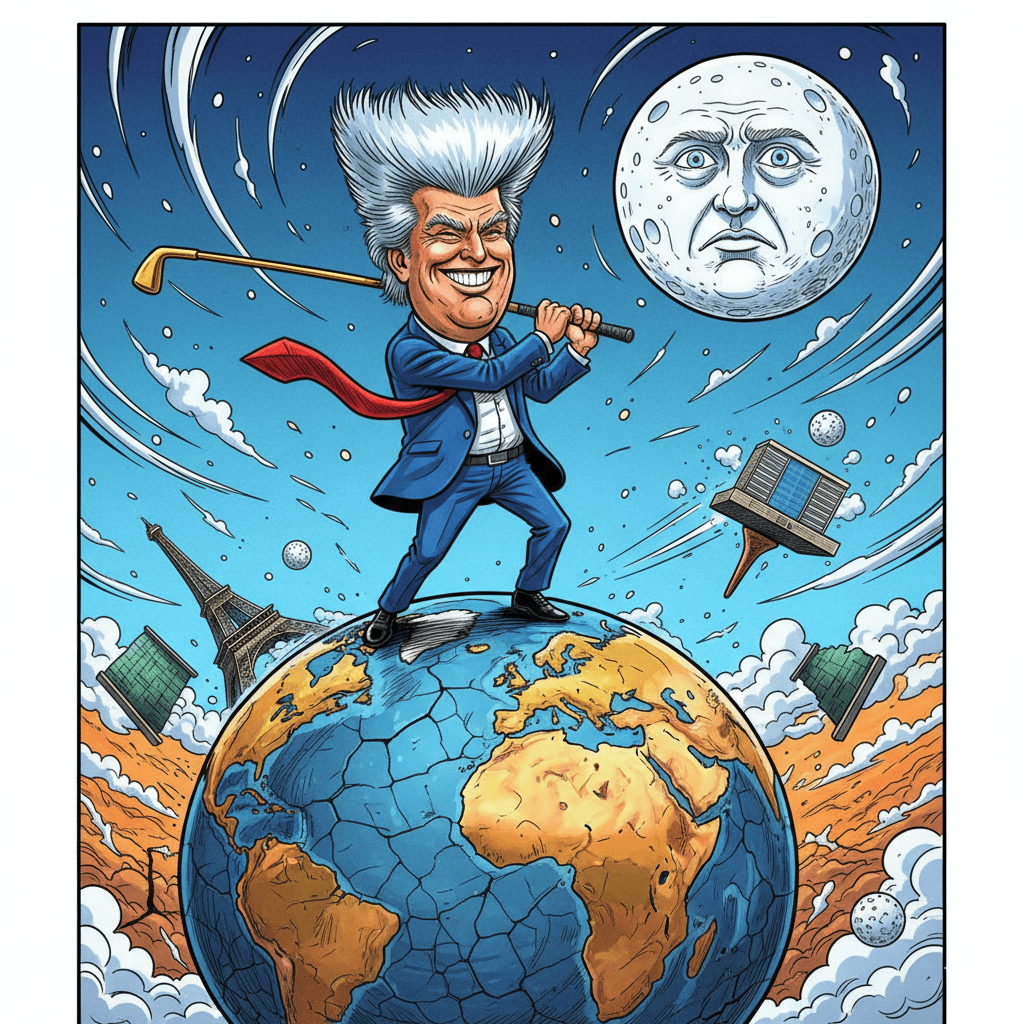Eine junge, erfolgreiche Schauspielerin, ein Paar Jeans und ein Wortspiel, so simpel wie ein Kalauer unter Vätern. Was wie die harmlose Formel für eine Modekampagne klingt, entpuppte sich im Sommer 2025 als Zündfunke an einem gesellschaftlichen Pulverfass. Die Werbung von American Eagle mit Sydney Sweeney und dem Slogan „Sydney Sweeney has great jeans“ wurde zu einem Lehrstück über den Zustand der öffentlichen Debatte in den Vereinigten Staaten. Sie ist weit mehr als eine missglückte Anzeige; sie ist ein präzise für unsere Zeit geschaffenes Produkt, das die tiefen Gräben einer polarisierten Nation nicht nur spiegelt, sondern sie gezielt für kommerziellen Erfolg instrumentalisiert. Die dahinterliegende These ist beunruhigend: Die Kontroverse war kein Zufall, sondern das eigentliche Ziel. Sie offenbart eine Strategie, in der die Mechanismen des Kulturkampfes und die Aufmerksamkeitsökonomie der sozialen Medien zum kalkulierten Teil des Marketings werden – mit einem Erfolg, der ebenso profitabel wie symptomatisch für einen zerbrochenen Diskurs ist.
Das perfekte Rezept: Ein Star als Projektionsfläche
Um die Wucht der Reaktion zu verstehen, muss man zunächst die Hauptdarstellerin betrachten. Sydney Sweeney ist nicht einfach nur eine beliebige Schauspielerin; sie ist eine Figur von außergewöhnlicher formbarer Qualität, eine ideale Projektionsfläche für die widersprüchlichsten Sehnsüchte und Ängste Amerikas. Einerseits gefeiert für ihre anspruchsvollen Rollen in kritischen Hits wie „Euphoria“ und „The White Lotus“, wird sie andererseits von konservativen Kommentatoren als Symbolfigur vereinnahmt. Ihr öffentliches Image – geprägt durch ihre Herkunft aus dem Mountain West, Hobbys wie das Reparieren von Autos und eine frühere Kontroverse um Gäste mit MAGA-ähnlichen Hüten auf einer Familienfeier – hat sie, ob gewollt oder nicht, zu einer Ikone für jene gemacht, die den vermeintlichen „Woke-Wahnsinn“ für beendet erklären wollen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Diese Ambivalenz macht sie für eine Marke wie American Eagle zu einem unschätzbaren Kapital. Ein Marketing-Verantwortlicher, der sich der politischen Aufladung um Sweeneys Person bewusst ist, konnte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass eine Kampagne, die mit ihren „guten Genen“ wirbt, Reaktionen provozieren würde. Hinzu kommt eine oft übersehene wirtschaftliche Realität: In der Ära der Streamingdienste, in der klassische Vergütungsmodelle wie Residualzahlungen wegfallen, sind selbst erfolgreiche Schauspieler wie Sweeney auf eine Vielzahl von Werbedeals angewiesen, um ihren Lebensstil zu finanzieren – eine Tatsache, die sie selbst offen thematisiert hat. Diese Notwendigkeit, für zahlreiche Marken von Hautcreme bis zu Fast-Food-Ketten als Gesicht zu dienen, macht sie allgegenwärtig und verstärkt ihre Wirkung als kulturelles Phänomen. Sie ist die perfekte Figur für eine Kampagne, die auf maximale Sichtbarkeit durch Reibung ausgelegt ist.
Rage Bait als Strategie: Ein alter Trick im neuen Gewand
Die Idee, mit Provokation Aufmerksamkeit zu erregen, ist im Modemarketing keineswegs neu. Viele Beobachter zogen Parallelen zur berühmten Calvin-Klein-Werbung aus dem Jahr 1980, in der eine 15-jährige Brooke Shields dem Publikum die Frage stellte: „Willst du wissen, was zwischen mich und meine Calvins kommt? Nichts.“. Doch die Strategie von American Eagle geht einen entscheidenden Schritt weiter. Sie ist feiner kalibriert, zugeschnitten auf die Funktionsweise des Internets im 21. Jahrhundert. Es geht nicht mehr nur um eine einzelne, suggestive Doppeldeutigkeit, sondern um die gezielte Streuung von „Rage Bait“ – Ködern, die darauf ausgelegt sind, Empörung auszulösen und die algorithmischen Mühlen der sozialen Netzwerke anzutreiben.
Der Chief Marketing Officer von American Eagle gab im Vorfeld offen zu, man wolle mit der Kampagne „Knöpfe drücken“. Das Ergebnis gibt ihm recht. Während online hitzig über die Anzeige gestritten wurde, stieg der Aktienkurs des Unternehmens deutlich an. Die Kontroverse wurde zur kostenlosen, reichweitenstarken Werbung. In einer Zeit, in der Marken um jeden Klick kämpfen, scheint die Lektion für viele Unternehmen klar: Es zahlt sich aus, die Gesellschaft zu spalten. Die Kampagne ist somit weniger ein unglücklicher Ausrutscher als vielmehr ein präzise entwickeltes Produkt für eine Ära, deren Währung Aufmerksamkeit und deren Treibstoff Empörung ist. Ein Lehrstück. Ein Spiegel.
Der politische Kontext: Warum ein Wortspiel anders klingt
Die Kritik an der Werbung entstand nicht im luftleeren Raum. Dass ein scheinbar banales Wortspiel über „genes“ (Gene) und „jeans“ Assoziationen an Eugenik und die Glorifizierung von „Whiteness“ hervorrief, hat mit dem spezifischen kulturellen und politischen Klima zu tun, in das die Kampagne hineinplatzte. Die Ängste vor einem Wiedererstarken eugenischer Ideen sind empirisch begründet und werden durch die öffentliche Unterstützung von Pronatalismus-Bewegungen durch einflussreiche Persönlichkeiten wie Elon Musk oder rassistisch kodierte Rhetorik aus dem Umfeld der Trump-Administration befeuert.
Wenn in einem solchen Klima eine Marke eine blonde, blauäugige Schauspielerin über die Weitergabe ihrer Erbanlagen sinnieren lässt, trifft das auf einen Nerv. Es fügt sich für viele Kritiker nahtlos in einen wahrgenommenen kulturellen Wandel ein – weg von der in den Jahren nach der George-Floyd-Bewegung forcierten Betonung von Diversität und Inklusion und hin zu einer Rückkehr regressiver Schönheitsideale. Beobachter sprechen von einer neuen Welle an Bildern, die „Dünnheit, Weißsein und schamlosen Reichtum“ zelebrieren. Die Kampagne wurde so zum Symbol einer befürchteten kulturellen Restauration, die von der Rechten gefeiert und von Progressiven als gefährlicher Rückschritt gedeutet wird.
Die Maschine der Empörung: Wie der Online-Diskurs funktioniert
Die eigentliche Meisterschaft der Kampagne liegt darin, wie perfekt sie die Mechanismen des modernen Online-Diskurses bespielt. Die Reaktion folgte einem mittlerweile wohlbekannten Drehbuch. Zuerst äußern progressive Stimmen ihre aufrichtige oder performative Empörung über die als problematisch empfundenen Botschaften. Unmittelbar darauf reagieren konservative und rechte Akteure, die diese Empörung sammeln, ausschlachten und als Beweis für die Hysterie und Realitätsferne ihrer politischen Gegner präsentieren. Dazwischen schalten sich unzählige Content-Ersteller, die das trendende Thema nutzen, um auf den algorithmischen Wellen von TikTok und X (ehemals Twitter) zu surfen und eigene Reichweite zu generieren.
Es entsteht ein selbsterhaltender Kreislauf, den ein Kommentator treffend als „Möbiusband der Empörung“ bezeichnete. Das Wort „Diskurs“ ist hierbei selbst irreführend, denn ein wirklicher Austausch findet kaum statt. Statt miteinander zu reden, geben alle Beteiligten öffentliche Erklärungen ab, die wiederum von anderen als Material für die eigene Position genutzt werden. Es ist, als würden alle in einen riesigen, echolosen Raum schreien. Die Medien spielen in diesem System eine ambivalente Rolle. In ihrem Bestreben, die Kontroverse in klickstarken Content zu verwandeln, greifen sie oft unkritisch einzelne Social-Media-Kommentare auf und verleihen ihnen eine Bedeutung, die sie gemessen an ihrer ursprünglichen Reichweite nie hatten. Wenn eine große Nachrichtenseite einen Instagram-Nutzer mit 119 Followern zitiert, um eine breite Empörung zu belegen, wird die öffentliche Meinung aktiv verzerrt und der Konflikt weiter angeheizt.
Die Gegenstimme: Wenn ein Witz nur ein Witz sein soll
Inmitten dieses Lärms gibt es jedoch auch eine deutlich andere Perspektive, die vor allem von dem Linguisten John McWhorter eloquent formuliert wurde. Aus seiner Sicht ist die gesamte Debatte ein Beispiel für eine performative Überempfindlichkeit gegenüber Sprache. Er stellt die Frage nach der „Verjährungsfrist“ für historisch belastete Begriffe und argumentiert, dass ein Wort wie „Gene“ im alltäglichen Gebrauch als Kompliment für gutes Aussehen von seiner düsteren Geschichte im Kontext der Eugenik losgelöst werden kann und sollte.
Für McWhorter und viele Kommentatoren, die ihm zustimmen, ist die Interpretation der Werbung als rassistischer „Dog Whistle“ eine intellektuelle Überdehnung. Die Kampagne sei schlicht ein Wortspiel, ein Pun, und keine geheime Hommage an weiße Vorherrschaft. Diese Sichtweise wirft eine entscheidende Frage auf: Wo verläuft die Grenze zwischen berechtigter Sensibilität für die Macht der Sprache und einer „lexikalischen Etikette“, die das Gespräch durch ein ständig wachsendes Regelwerk erstickt? Diese Perspektive ist ein wichtiger Teil des Gesamtbildes, auch wenn sie im lauten Schlagabtausch der Extreme oft untergeht. Sie zeigt, dass selbst die Definition dessen, worüber gestritten wird, Teil des Konflikts ist.
Was am Ende bleibt: Profitabler Lärm und eine verlorene Debatte
Was ist also das Fazit dieses Kulturkampfes im Miniaturformat? Der unbestreitbare Gewinner ist die Aufmerksamkeitsökonomie selbst. American Eagle erhielt massive mediale Präsenz und verzeichnete einen Aktiengewinn. Sydney Sweeney festigte ihren Status als eine der meistdiskutierten und damit gefragtesten Persönlichkeiten. Die Content-Maschinerie auf allen Seiten lief auf Hochtouren. Die Verliererin ist die öffentliche Debatte. Echte und wichtige gesellschaftliche Ängste – vor Rassismus, vor einem kulturellen Backlash – werden in diesem Prozess zu „algorithmischem Schrot für die Mühlen der Plattformen“ zermahlen, bis sie bedeutungslos erscheinen.
Die große, schweigende Mehrheit der Menschen, die der Werbung passiv begegnet, konsumiert diese Auseinandersetzung womöglich wie Sportnachrichten über Streit in der Umkleidekabine oder wie Klatsch und Tratsch über Prominente. Es ist Content, der für einen kurzen Moment der Langeweile konsumiert wird, bevor die Maschine weiterläuft. Und genau das ist vielleicht die tiefste und beunruhigendste Wahrheit, die die Kampagne „Sydney Sweeney has great jeans“ enthüllt: Sie zeigt eine Welt, in der die Simulation einer Debatte profitabler geworden ist als die Debatte selbst. Der Lärm übertönt die Substanz, und während alle das Gefühl haben, für ihre Seite gekämpft zu haben, dreht sich das Rad einfach weiter – angetrieben von unser aller Energie, aber ohne uns einem wirklichen Verständnis auch nur einen Schritt näherzubringen.