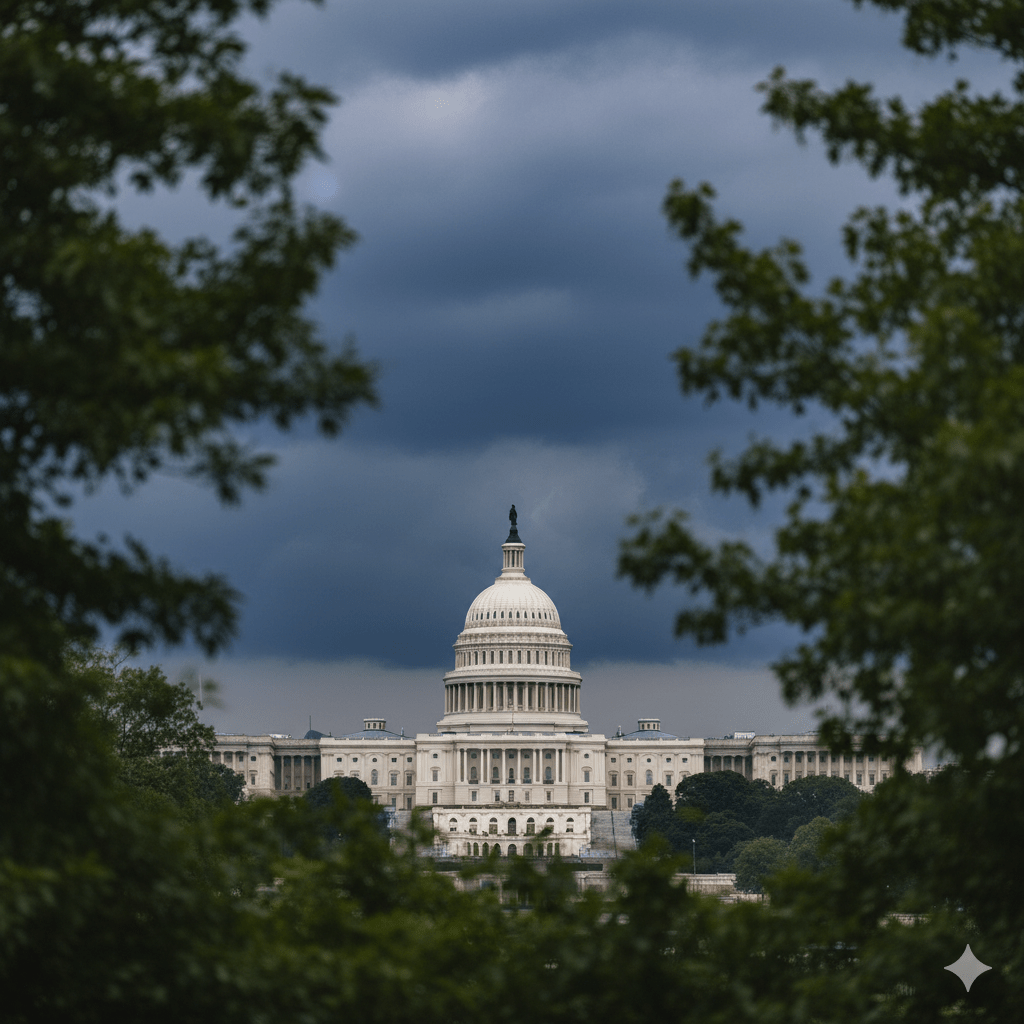Zehntausende – es ist keine abstrakte Zahl, sondern die Summe von Einzelschicksalen, die sich gerade über die amerikanische Unternehmenslandschaft ergießt. Bei General Motors kündigt das Management an, 1.750 Arbeiter unbefristet und weitere 1.670 befristet freizustellen. Bei Paramount, frisch fusioniert, sollen 2.000 Mitarbeiter gehen. Amazon plant den Abbau von 14.000 Konzernstellen. Und an der Spitze dieser Welle steht der Logistikriese UPS, der im laufenden Jahr bereits 48.000 Stellen gestrichen hat.
Diese Zahlen treffen auf einen Arbeitsmarkt, der sich ohnehin in einem Zustand seltsamer Lähmung befindet. Analysten sprechen von einer „No-Hire, No-Fire“-Situation – eine tiefsitzende Unsicherheit, die Unternehmen lähmt, aber bis vor kurzem von Massenentlassungen absah. Diese Lähmung wird gespiegelt von einer Regierung im Stillstand. Weil der „Government Shutdown“ die Veröffentlichung entscheidender Wirtschaftsdaten verhindert, navigieren die Federal Reserve und die Konzerne gleichermaßen im Nebel. Sie müssen Entscheidungen über Zinssenkungen und Investitionen treffen, ohne die wahre Gesundheit des Arbeitsmarktes zu kennen.
Was diese Entlassungswelle von 2025 so fundamental von früheren, wie der Tech-Korrektur 2023, unterscheidet, ist ihre Breite und ihre Begründung. Dies ist kein reines Sektorbeben. Es trifft die Industrie, die Medien, den Handel und die Logistik. Und es wird von einem neuen, fast schon aggressiven Narrativ der Effizienz getragen – einem Narrativ, in dem die Künstliche Intelligenz als mächtiger Vorwand dient.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Nebel der Begründungen: Zwischen Politik und „Synergien“
Fragt man die Unternehmen nach den Gründen, erhält man ein Dickicht aus Erklärungen, das so undurchdringlich wirkt wie der Datennebel in Washington. Es ist ein Gemisch aus externen Schocks und internen Manövern, das eines gemeinsam hat: Es lenkt den Blick auf scheinbar unvermeidbare Zwänge.
Da ist General Motors. Die Erklärung für die Werksschließungen in Michigan, Ohio und Tennessee ist bestechend einfach: Die Politik ist schuld. Der Kongress hat die Bundessubvention von 7.500 Dollar für Elektroautos zum 30. September gestrichen. Die direkte Folge, so das Unternehmen, sei eine langsamere Adaption von E-Fahrzeugen und damit die Notwendigkeit, Kapazitäten „anzupassen“. Der kausale Zusammenhang zwischen einer politischen Entscheidung und dem Verlust von Tausenden Arbeitsplätzen wird als direkt und unvermeidbar dargestellt.
Oder UPS. Auch hier verweist man auf die Politik. Die Schließung eines Zoll-Schlupfloches durch die Trump-Regierung, das massenhafte, zollfreie Kleinsendungen vor allem aus China ermöglichte, habe das Geschäft einbrechen lassen. Das Volumen aus China fiel im dritten Quartal um fast 30 Prozent. Es ist eine Begründung, die man in ähnlicher Form auch von Konsumgüterriesen wie Nestlé oder Procter & Gamble hört, die den Zolldruck als Rechtfertigung für tiefgreifende Restrukturierungen nutzen. Doch bei UPS überlagert die Politik eine viel riskantere, strategische Entscheidung: die bewusste Abkehr vom langjährigen, aber unprofitablen Großkunden Amazon. UPS transportierte im letzten Quartal 21 Prozent weniger Amazon-Pakete als im Vorjahr, ein Schritt, der das Unternehmen agiler machen soll, aber Tausende Arbeitsplätze kostet.
Am klarsten ist das Motiv bei Paramount. Nach der 8-Milliarden-Dollar-Fusion mit Skydance ist der Abbau von 2.000 Stellen die kalte Umsetzung von Wall-Street-Argot: Man sucht „2 Milliarden Dollar an Synergien“. Es ist die klassische Logik der Konsolidierung, bei der Redundanzen – also Menschen – eliminiert werden, um den Deal zu finanzieren.
Politik, Zölle, Synergien – all das sind plausible Gründe. Doch sie verschleiern eine tiefere Strömung, einen fundamentalen Wandel in der Management-Philosophie, der sich quer durch alle Branchen zieht.
Das neue Evangelium: Warum „Schlank“ plötzlich „Vital“ bedeutet
Was wir 2025 erleben, ist ein bemerkenswerter Wandel in der Unternehmenserzählung. Stellenabbau wird nicht mehr als Krisensymptom oder schmerzhaftes Eingeständnis des Scheiterns kommuniziert. Stattdessen wird er als „Zeichen von Vitalität“ verkauft.
Die neuen Schlagworte lauten „flache Hierarchien“ und „Agilität“. Amazons CEO Andy Jassy begründet den Abbau von 14.000 Stellen nicht primär mit Kostendruck, sondern mit dem Ziel, „Bürokratie abzubauen“ und „Schichten zu entfernen“, um „schnell“ zu sein. Walmart, der größte private Arbeitgeber der Nation, pflichtet bei und kündigt an, dass die Zahl der Mitarbeiter in den nächsten drei Jahren „flach“ bleiben wird.
Man könnte dies als überfällige Korrektur der massiven Über-Einstellungen während der Pandemiejahre abtun. Doch die Analyse der Schnitte zeigt ein strategischeres Bild. Es geht nicht nur um ein einfaches „Weniger“. Es geht um ein „Anders“. Bei UPS etwa wurden 14.000 Management-Posten gestrichen, aber gleichzeitig 34.000 operative Stellen. Dies ist kein symmetrisches Abspecken, sondern eine gezielte Neukonfiguration des gesamten Organismus. Der Trend zielt darauf ab, die teuren Management-Ebenen, die in den Boomjahren gewuchert sind, zu kappen und die operative Basis durch Technologie zu ersetzen. Es ist der Wandel von einer personalintensiven zu einer kapital- und technologieintensiven Struktur. Und das Werkzeug, das diesen Wandel nicht nur ermöglicht, sondern ihn auch unaufhaltsam erscheinen lässt, ist die Künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz: Der große Beschleuniger – oder das perfekte Alibi?
In fast jeder Entlassungsmitteilung, von der Tech-Branche bis zur Luftfahrt, taucht das Kürzel „KI“ auf. Es ist der rote Faden, der die ansonsten ungleichen Geschichten von Amazon, Microsoft, Lufthansa und anderen verbindet.
Die Investitionen sind gigantisch. Amazon steckt Dutzende Milliarden in neue Rechenzentren, die als Fundament für KI-Dienste dienen sollen. Microsoft, das Tausende von Stellen streicht – unter anderem im Gaming-Bereich –, investiert gleichzeitig massiv in seine KI-Ambitionen und erklärt, die Gesamtbelegschaft bleibe durch diese Umschichtung „relativ unverändert“. Lufthansa plant den Abbau von 4.000 Stellen bis 2030 und nennt explizit „Digitalisierung und den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz“ als Treiber. Selbst Intel, das im Gegensatz zu Microsoft aus einer Position der Schwäche heraus agiert und im Chip-Rennen hinterherhinkt, nutzt das Argument der Neuausrichtung, um Tausende Stellen zu streichen.
Die Argumentation scheint unanfechtbar: KI automatisiert Prozesse, KI steigert die Effizienz, also werden Arbeitsplätze überflüssig. Doch wie glaubwürdig ist dieses Narrativ? Immer lauter wird der Verdacht, dass KI weniger der eigentliche Treiber als vielmehr das perfekte Alibi ist. In einer unsicheren Wirtschaftslage bietet die „KI-Transformation“ eine überzeugende, zukunftsgewandte Geschichte, um schmerzhafte und längst überfällige Kostensenkungen zu legitimieren, die vielleicht durch Zinsdruck oder Marktsättigung getrieben sind.
Nirgendwo wird dieser Widerspruch deutlicher als bei Amazon. Während CEO Andy Jassy im Juni noch prognostizierte, dass KI die Konzernbelegschaft in den kommenden Jahren reduzieren werde, behauptete er bei der Ankündigung der jüngsten 14.000 Kürzungen das genaue Gegenteil: Die Entlassungen seien „nicht finanziell oder KI-gesteuert“, sondern ein rein kultureller Schritt hin zu mehr Agilität. Diese Dissonanz ist bezeichnend. KI ist das Gespenst, das Unternehmen je nach Bedarf rufen oder leugnen können, um ihre Ziele zu erreichen.
Die „Überflüssigen“: Was passiert, wenn Umschulung an Grenzen stößt?
Die Konsequenzen dieser Entwicklung für die Arbeitnehmer sind tiefgreifend und potenziell brutal. Es zeichnet sich eine Zweiteilung des Arbeitsmarktes ab. Auf der einen Seite stehen Unternehmen wie Walmart. Sie propagieren einen sanften Übergang, sprechen von einer „Entwicklung“ der Rollen und investieren in „KI-Schulungen und Karrierepfade“ für ihre Mitarbeiter. Das Versprechen lautet: Niemand wird zurückgelassen, wir transformieren uns gemeinsam. Auf der anderen Seite steht die kalte Ehrlichkeit von Konzernen wie Accenture. Der Beratungsriese strich 11.000 Stellen mit der unverblümten Begründung, dass die betroffenen Mitarbeiter nicht für eine KI-gesteuerte Zukunft umgeschult werden könnten. Diese Aussage ist ein Dammbruch. Sie etabliert die Idee eines Teils der Belegschaft, der als technologisch „überflüssig“ gilt. Es ist eine Logik, die langfristig verheerende Auswirkungen haben könnte. Wir sehen bereits die „Kannarienvögel im Kohleschacht“: Einstiegsjobs im Software-Engineering und im Kundenservice, die direkt KI-exponiert sind, werden bereits jetzt knapper. Es ist der leise Beginn einer möglicherweise massiven Verdrängung.
Eine riskante Wette: Tötet der Effizienzwahn die Innovation?
Die Ironie dieser Entwicklung ist, dass der fast zwanghafte Fokus auf Effizienz und Kostensenkung genau das untergraben könnte, was die KI eigentlich verspricht: Innovation. Analysten warnen davor, dass Unternehmen, die KI primär als Werkzeug zur Personaleinsparung betrachten, kurzsichtig handeln. Sie optimieren vielleicht ihre Bilanzen, verpassen aber das eigentliche transformative Potenzial der Technologie – nämlich die Schaffung gänzlich neuer Produkte, Dienstleistungen und Märkte, die ohne KI undenkbar wären.
Doch der Druck von Investoren, sofortige Effizienzgewinne vorzuweisen, ist enorm. In diesem Klima wird die Verschiebung von menschlichem Kapital hin zu technologischer Infrastruktur zur dominierenden Strategie. Es ist eine Wette, die von den Märkten kurzfristig belohnt wird, wie die positiven Reaktionen auf die Entlassungsankündigungen zeigen.
Die sozialen und ökonomischen Verwerfungen, die dieser Trend auslöst, werden dabei ignoriert. Wenn Arbeit systematisch als Kostenfaktor definiert wird, der durch Technologie eliminiert werden muss, schreiben wir nicht nur Geschäftsmodelle um, sondern den gesamten Gesellschaftsvertrag. Die Konzerne mögen diese Welle als notwendige „Anpassung“ an eine neue Ära verkaufen. Doch es bleibt die beunruhigende Frage: Was für eine Wirtschaft bauen wir, wenn die Jagd nach Effizienz als Entschuldigung dient, um Millionen von Menschen als Kollateralschaden einer Zukunft abzutun, für die sie angeblich nicht mehr „umschulbar“ sind?