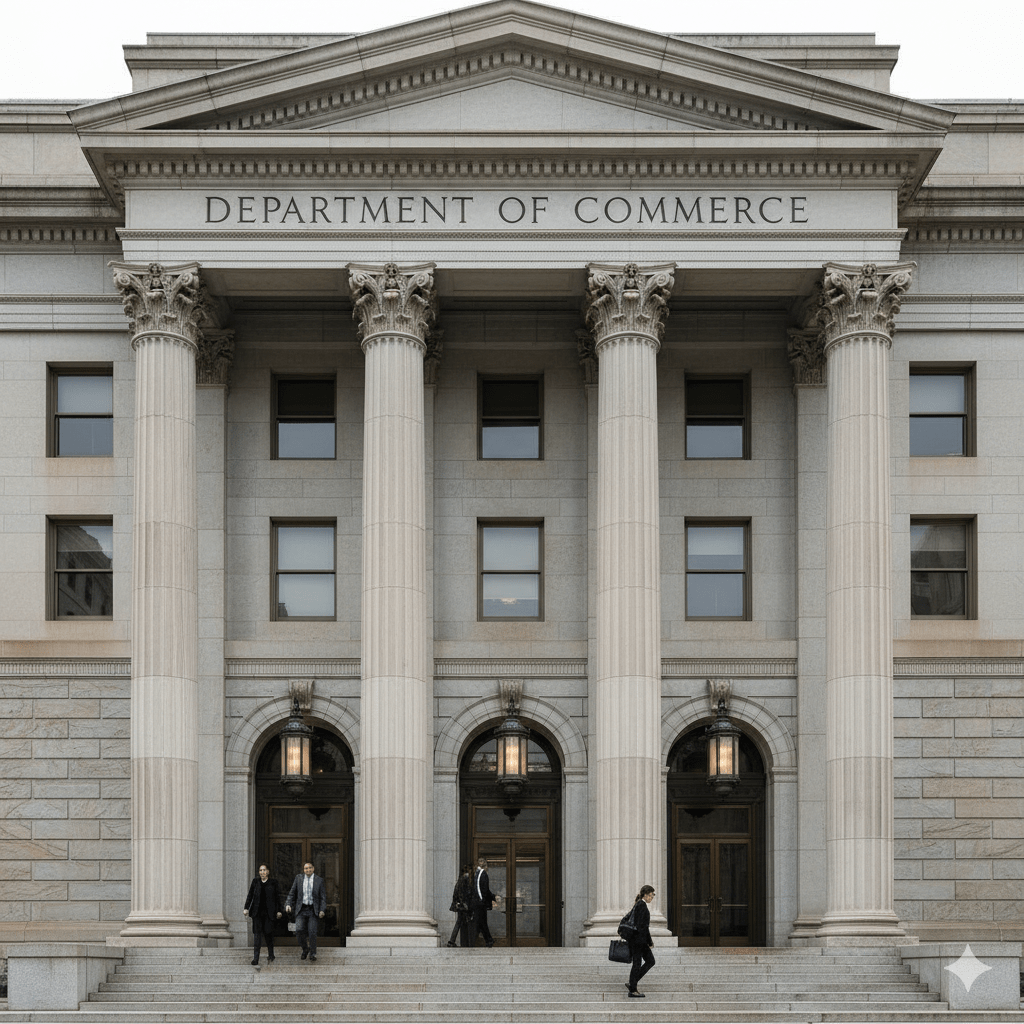In den USA formiert sich massiver Widerstand gegen Donald Trump, doch die Demokratische Partei wirkt wie ein Zuschauer in der eigenen Arena: führungslos, zerstritten und ohne strategischen Kompass. Eine Analyse einer Partei, deren größte Krise nicht der Gegner ist, sondern sie selbst.
Ein seltsames Paradox durchzieht die politische Landschaft der Vereinigten Staaten. Auf den Straßen von Los Angeles bis Portland protestieren Millionen gegen die autoritären Tendenzen von Präsident Donald Trump. Es ist ein eindrucksvolles Zeugnis bürgerschaftlichen Engagements, ein Aufbäumen gegen eine Regierung, die Rechtsstaatlichkeit und demokratische Normen herausfordert. Doch während an der Basis eine Welle des Protests rollt, scheint die Institution, die diesen Widerstand kanalisieren sollte, in einer tiefen Starre verfangen zu sein. Die Demokratische Partei, Amerikas nominelle Opposition, wirkt führungslos, finanziell ausgeblutet und von internen Grabenkämpfen gelähmt. Sie ist eine Partei auf der Suche nach ihrer Seele, gefangen in der Nostalgie für vergangene Triumphe und unfähig, eine kohärente Antwort auf die politische Realität des 21. Jahrhunderts zu formulieren. Die Flut an Ratschlägen, was die Partei alles tun müsse, ist zu einer ohrenbetäubenden Kakofonie angeschwollen, die vor allem eines offenbart: eine fundamentale, gefährliche Orientierungslosigkeit.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Im Schatten Obamas: Die endlose Suche nach einem Retter
Ein untrügliches Symptom für die Misere der Demokraten ist die fast schon schmerzhafte Sehnsucht nach Barack Obama. Fast ein Jahrzehnt nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus bleibt er die Figur, auf die sich die Hoffnungen vieler Demokraten projizieren, ein Symbol für eine Zeit, in der sich die Partei und ihre Wähler gut fühlten. Diese Nostalgie entpuppt sich als potente, aber trügerische Droge. Sie ist nicht nur Ausdruck der Wertschätzung für einen populären Ex-Präsidenten, sondern vor allem ein Eingeständnis des Versagens, eine neue Generation von Führungskräften aufzubauen, die in der Ära Trump bestehen kann.
Der Ruf nach Obama verkennt jedoch zwei entscheidende Realitäten. Zum einen war seine Präsidentschaft, abseits seiner mitreißenden Rhetorik, von einem moderaten, fast schon konservativen Pragmatismus geprägt, der im heutigen politischen Klima kaum als linksradikal gelten würde. Man erinnert sich an die großen Reden, vergisst aber die vorsichtige Amtsführung. Zum anderen hat sich die Medienlandschaft seit 2009 dramatisch verändert. Die Zeit, in der ein Präsident mit einer einzigen Rede eine gemeinsame nationale Realität formen konnte, ist vorbei. In der heutigen fragmentierten Welt aus Algorithmen, Memes und KI-generierten Falschinformationen verhallt selbst die brillanteste Rede wirkungslos, wenn sie nicht auf eine aufnahmefähige Infrastruktur trifft. Die Forderung, Obama möge es richten, ist daher nicht nur unrealistisch, sondern auch ein Zeichen von Schwäche – der Wunsch nach einem charismatischen Prediger, ohne die harte Arbeit eines politischen Glaubensbekenntnisses leisten zu wollen.
Das kaputte Herz der Partei: Das DNC im Chaos
Dieses Führungsvakuum an der Spitze wird durch ein organisatorisches Versagen im Maschinenraum der Partei gespiegelt: dem Democratic National Committee (DNC). Unter dem neuen Vorsitzenden Ken Martin präsentiert sich das DNC als ein Mikrokosmos der parteiinternen Zerrissenheit. Die Finanzen sind so desolat, dass intern bereits über die Aufnahme von Krediten zur Deckung der laufenden Kosten diskutiert wurde. Großspender halten sich zurück, während die Republikaner einen gewaltigen finanziellen Vorsprung haben.
Gleichzeitig wird die Organisation von internen Machtkämpfen und peinlichen öffentlichen Fehden erschüttert. Der Konflikt mit dem jungen Vize-Vorsitzenden David Hogg, der es wagte, etablierte Abgeordnete in Vorwahlen herauszufordern, eskalierte zu einer öffentlichen Schlammschlacht, die mit Hoggs Abgang endete und die Partei führungsschwach und zerstritten aussehen ließ. Zudem verließen einflussreiche Führer zweier großer Gewerkschaften das DNC und stellten die Ausrichtung der Partei unter Martin offen in Frage. Diese Ereignisse senden ein verheerendes Signal an die Basis und potenzielle Verbündete: Eine Partei, die nicht einmal sich selbst regieren kann, verliert die Glaubwürdigkeit, ein Land führen zu wollen.
In alten Narrativen gefangen: Das historische Versäumnis der Demokraten
Doch die Probleme reichen tiefer als Personal und Organisation. Sie sind fundamentaler Natur und betreffen die Identität der Partei selbst. Der Analyst David Brooks argumentiert, dass die Demokraten den Anschluss an eine neue historische Ära verpasst haben. Während die Republikaner sich unter Trump radikal an das Zeitalter des globalen Populismus angepasst und ihre Partei von einer Freihandels- zu einer protektionistischen und von einer internationalistischen zu einer isolationistischen Kraft umgebaut haben, verharren die Demokraten in den Narrativen des 20. Jahrhunderts.
Ihre traditionellen Erzählungen – der Ruf nach einem starken Sozialstaat zur Bekämpfung von Ungleichheit und der Kampf für die Befreiung unterdrückter Gruppen – sind zwar ehrenwert, aber im aktuellen Klima der tiefen Systemverdrossenheit nicht mehr ausreichend. Trump erzählt eine einfache, kraftvolle Geschichte: Die Eliten betrügen euch, und ich bin euer Rächer. Die Demokraten hingegen werden von einem großen Teil der Bevölkerung selbst als ebenjene elitäre Oligarchie wahrgenommen, die sie zu bekämpfen vorgeben. Sie dominieren die Institutionen, die das größte Misstrauen genießen: Universitäten, Medien, Stiftungen und die öffentliche Verwaltung. Dieser wahrgenommene kulturelle Elitismus, so Brooks, wird als drückender empfunden als ökonomische Ungleichheit und nährt eine soziale Ressentiments, die Trump meisterhaft für sich zu nutzen weiß.
Strategische Ratlosigkeit: Kämpfernaturen gegen pragmatische Problemlöser
Aus dieser Identitätskrise erwächst eine tiefgreifende strategische Orientierungslosigkeit. Die Partei ist sich uneins, wie sie dem Phänomen Trump begegnen soll. Diese Spaltung manifestiert sich in den unterschiedlichen Kandidatentypen, die um die Führung ringen. Auf der einen Seite stehen die „Kämpfer“ oder „Pugilisten“, wie sie im New Yorker Bürgermeisterwahlkampf zwischen dem Pragmatiker Andrew Cuomo und dem demokratischen Sozialisten Zohran Mamdani sichtbar wurden. Beide warben mit einer kompromisslosen Haltung, bereit, sich nicht nur mit Trump, sondern auch mit dem eigenen Parteiestablishment anzulegen. Ihr Versprechen ist eine muskulöse, schlagkräftige Antwort auf die autoritäre Bedrohung, eine Art spiegelbildlicher „Tyrann“, der dem Original die Stirn bieten kann.
Auf der anderen Seite steht das Modell der zentristischen „Problemlöser“, oft Frauen mit beeindruckenden Lebensläufen im Bereich der nationalen Sicherheit, wie Abigail Spanberger, Mikie Sherrill und Elissa Slotkin. Sie gewannen 2018 in umkämpften Bezirken, indem sie sich als pragmatisch, lösungsorientiert und überparteilich präsentierten. Ihre Strategie ist es, die Angriffe der Republikaner zu neutralisieren, indem sie Kompetenz und eine unpolitische Diensterfahrung in den Vordergrund stellen und sich von den ideologischen Kämpfen der Parteiflügel distanzieren. Welches dieser Modelle – der ideologische Kämpfer oder der pragmatische Zentrist – die Zukunft der Partei ist, bleibt eine der zentralen, ungelösten Fragen.
Kulturelle Grabenkämpfe: Die Angst vor der eigenen Courage
Die strategische Zerrissenheit zeigt sich besonders deutlich im Umgang mit gesellschaftspolitischen Reizthemen. Die Debatte um die Rechte von Transgender-Personen, insbesondere im Frauensport, hat sich für die Demokraten zu einem Minenfeld entwickelt. Sie befinden sich in einer politischen Zwickmühle: Einerseits wollen und müssen sie die Werte von Gleichberechtigung und Inklusion hochhalten, die den Kern ihrer Basis bilden. Andererseits fürchten sie, mit als radikal empfundenen Positionen Wähler in der Mitte zu verprellen und den Republikanern eine willkommene Angriffsfläche zu bieten.
Die Folge ist oft ein betretenes Schweigen oder der Versuch, das Thema zu umgehen. Während die Republikaner das Thema gezielt nutzen, um die Demokraten als „woke“ und lebensfremd darzustellen, wirken viele demokratische Politiker unsicher und defensiv. Einige, wie der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, haben versucht, einen Mittelweg zu finden, und ernteten dafür umgehend Kritik aus den eigenen Reihen. Diese Episode illustriert beispielhaft die Unfähigkeit der Partei, in den von der Rechten definierten Kulturkämpfen eine selbstbewusste und einheitliche Haltung zu finden, die sowohl prinzipienfest als auch mehrheitsfähig ist.
Der Lärm der Ratgeber: Ein Symptom der Leere
In dieses strategische und ideologische Vakuum hinein dröhnt eine endlose Flut von Ratschlägen. Demokraten „müssen“ und „sollten“ – so beginnt eine schier unüberschaubare Anzahl von Meinungsbeiträgen, Analysen und Kommentaren. Die Ratschläge sind dabei so vielfältig wie widersprüchlich: Die Partei müsse aggressiver und „gemeiner“ werden, aber auch zur Mitte rücken und weniger „toxisch“ sein. Sie müsse ihre Basis energetisieren und zugleich die Unentschlossenen überzeugen. Sie solle aufhören, über Identitätspolitik zu reden, und gleichzeitig ihre Identität festigen.
Diese Kakofonie ist, wie der Kolumnist Dana Milbank aufzeigt, weniger eine konstruktive Debatte als vielmehr ein Symptom der tiefen Verunsicherung. Eine Partei mit einer klaren Vision und einem starken Führungspersonal wäre weniger anfällig für diesen Chor der Besserwisser. Die Tatsache, dass die Demokraten ihre Zukunftsdebatte derart öffentlich und widersprüchlich führen, zeigt, dass es im Kern an einer gemeinsamen Idee fehlt, was die Partei im 21. Jahrhundert sein und wofür sie stehen will. Das ständige öffentliche Sezieren der eigenen Schwächen wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung der Irrelevanz.
Opposition im Fadenkreuz: Zwischen Protest und politischer Falle
Angesichts der aggressiven Taktiken der Trump-Regierung – von der Militarisierung der Innenpolitik bis hin zu Drohungen gegen politische Gegner – stehen die Demokraten vor einer weiteren strategischen Entscheidung: Wie viel Konfrontation ist klug? Die Unterstützung von Massenprotesten bietet die Chance, die Wut der Bevölkerung zu kanalisieren und die autoritären Züge der Regierung anzuprangern. Doch sie birgt auch die Gefahr, dass einzelne Gewalttaten oder radikale Slogans von den Republikanern instrumentalisiert werden, um die Demokraten als Partei der Anarchie und des Chaos darzustellen.
Führende Demokraten versuchen, diesen schmalen Grat zu beschreiten, indem sie zu friedlichem, diszipliniertem Protest aufrufen. Gleichzeitig eskaliert die Konfrontation auf institutioneller Ebene, wie die Auseinandersetzungen um Einwanderungspolitik und die Behandlung von Demonstranten und sogar gewählten Politikern zeigen. Diese Zuspitzung bietet die Möglichkeit, Trump als Gefahr für die Demokratie zu entlarven, kann aber auch von den eigentlichen Sachthemen ablenken, bei denen die Demokraten traditionell stärker sind, wie etwa Sozial- und Wirtschaftspolitik.
Geld, Macht und Ideologie: Der Kampf um die Seele der Partei
Letztlich kulminieren viele dieser Konflikte in der fundamentalen Frage, wem die Partei gehört. Der Vorstoß von Senator Bernie Sanders und seinen Mitstreitern, den Einfluss von Milliardären und „Dark Money“ in den Vorwahlen der Partei zu verbieten, ist mehr als nur eine Debatte über Wahlkampffinanzierung. Es ist ein Kampf um die Seele der Demokratischen Partei. Auf der einen Seite steht der progressive Flügel, der argumentiert, dass die Partei nur dann glaubwürdig gegen die Oligarchie kämpfen kann, wenn sie sich selbst von deren Einfluss befreit. Auf der anderen Seite steht das Establishment, das auf die finanzielle Schlagkraft großer Spender angewiesen ist, um im teuren amerikanischen Wahlkampf zu bestehen. Dieser Konflikt zwischen einer graswurzelbasierten Bewegung und einer von Eliten finanzierten Maschinerie ist die vielleicht tiefste und entscheidendste Bruchlinie. Sie entscheidet darüber, ob die Demokraten eine Partei des Volkes oder eine Partei der Mächtigen sein wollen. Die Antwort auf diese Frage wird ihre Zukunft mehr bestimmen als jeder Wahlslogan oder jede einzelne Wahl. Der Weg aus der Krise ist kein Sprint, sondern, wie ein Analyst es formuliert, „die Arbeit von Jahrzehnten“. Es ist die Herkulesaufgabe, eine Partei für ein neues, unversöhnliches politisches Zeitalter neu zu erfinden.