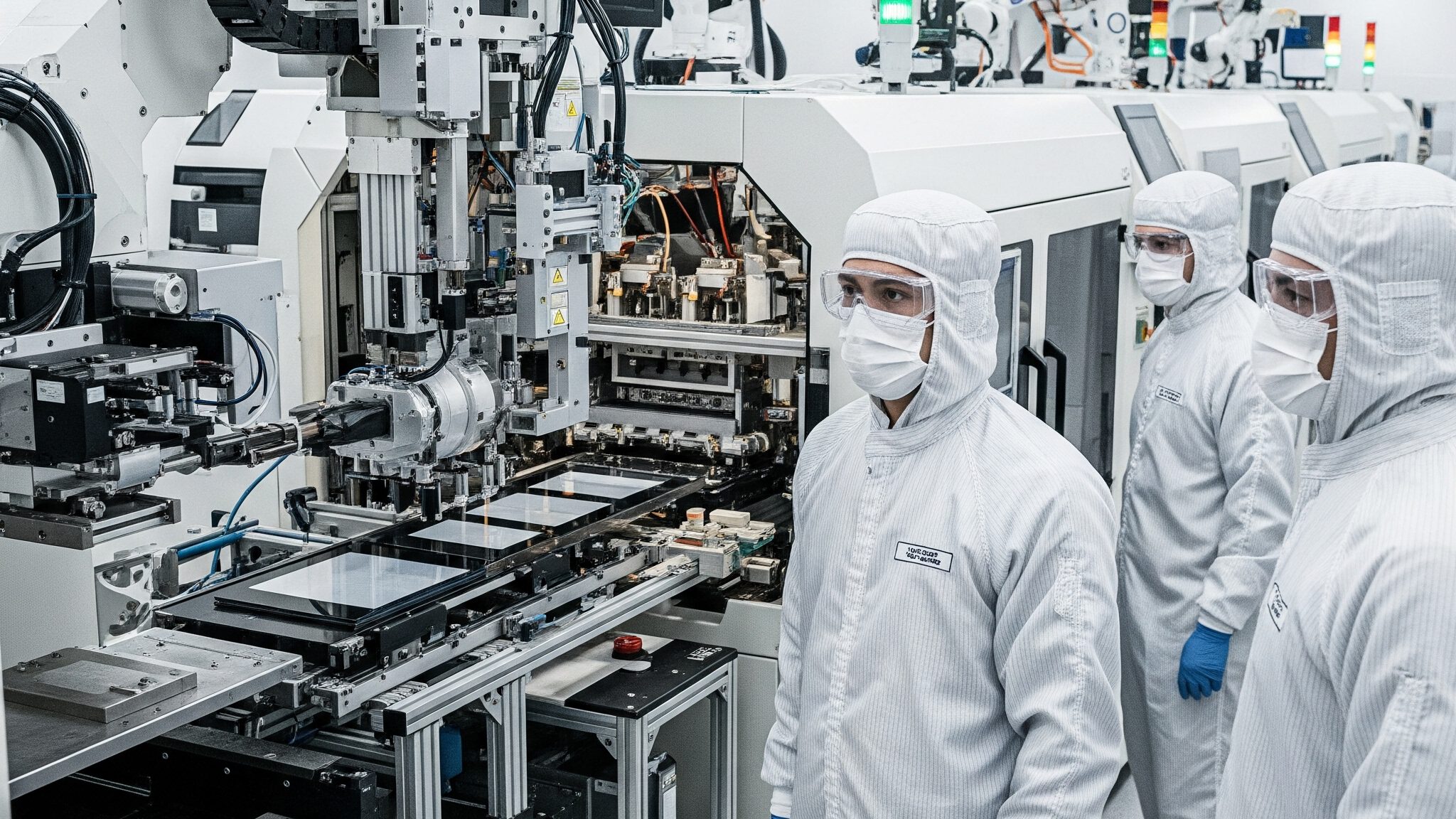
Es gibt in der Weltpolitik unsichtbare Mauern. Eine davon, vielleicht die wichtigste des 21. Jahrhunderts, verläuft digital. Sie wurde errichtet, um den technologischen Vorsprung der westlichen Welt zu schützen, insbesondere im Rennen um die künstliche Intelligenz. Diese Firewall, über Jahre von zwei Administrationen mühsam hochgezogen, sollte sicherstellen, dass die fortschrittlichsten Werkzeuge zur Gestaltung der Zukunft nicht in die Hände strategischer Rivalen wie China fallen. Doch was geschieht, wenn der Wächter dieser Mauer entscheidet, dass sie kein unüberwindbares Bollwerk mehr sein soll, sondern ein Zollhaus? Wenn der Schlüssel zur technologischen Überlegenheit nicht mehr eine Frage der nationalen Sicherheit ist, sondern des Preises?
Genau dieses Schauspiel entfaltet sich derzeit in Washington. In einer beispiellosen Kehrtwende hat die Regierung von Präsident Donald Trump den amerikanischen Tech-Giganten Nvidia und AMD die Erlaubnis erteilt, bestimmte, für den chinesischen Markt entwickelte KI-Chips wieder ins Reich der Mitte zu verkaufen. Der Preis für diese Lizenz ist keine diplomatische Konzession oder eine strategische Neuausrichtung. Es ist kaltes, hartes Geld: 15 Prozent der Einnahmen aus diesen China-Geschäften fließen direkt in die Kassen der US-Regierung.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Dieser Deal ist weit mehr als eine Fußnote in der Geschichte des US-chinesischen Tech-Krieges. Er ist ein Paradigmenwechsel, der das Fundament der amerikanischen Sicherheitspolitik erschüttert. Er ersetzt das eherne Prinzip der nationalen Sicherheit durch die Logik eines Basars und stellt eine unbequeme Frage: Ist alles verhandelbar, selbst die Zukunft? Die Entscheidung, eine Technologie, die als „potent accelerator“ für Chinas KI-Ambitionen gilt, gegen eine Umsatzbeteiligung freizugeben, ist ein gefährliches Spiel. Es ist ein Pakt, dessen wahrer Preis sich erst in den kommenden Jahren zeigen wird – und er wird mit ziemlicher Sicherheit höher sein als die versprochenen 15 Prozent.
Ein Deal mit dem Teufel im Detail
Auf den ersten Blick wirkt die Vereinbarung wie ein pragmatischer Schachzug in Trumps typischem Stil. Nachdem seine eigene Administration den Verkauf der speziell für China konzipierten H20-Chips von Nvidia im April unter Verweis auf Sicherheitsrisiken gestoppt hatte, folgte im Sommer die dramatische Wende. In einem Treffen im Weißen Haus einigten sich Nvidia-Chef Jensen Huang und Präsident Trump auf die finanzielle Abmachung. Kurz darauf, so berichten Insider, wies der Präsident seinen Handelsminister an, die blockierten Lizenzen auszustellen. Auch AMD, Nvidias Hauptkonkurrent, ist Teil dieser Regelung und darf seinen KI-Chip MI308 nun ebenfalls nach China liefern.
Die Logik, die von den Unternehmen und insbesondere vom charismatischen Nvidia-Chef Huang vorgetragen wird, klingt bestechend einfach: Ein vollständiger Bann würde den US-Firmen nur schaden und den chinesischen Markt dem heimischen Konkurrenten Huawei überlassen. Das Geld, das Huawei dort verdiene, würde direkt in die Forschung fließen und den technologischen Abstand zu den USA verringern. Lasst uns also konkurrieren, so die Argumentation, und die Gewinne aus China nutzen, um unseren eigenen Vorsprung zu sichern und auszubauen. Die Trump-Regierung flankiert diese Position mit dem Argument, man verkaufe China ja bei Weitem nicht die beste Technologie – nicht einmal die zweit- oder drittbeste. Das Ziel sei, China technologisch gerade so weit unterlegen zu halten, dass es weiterhin auf amerikanische Produkte angewiesen bleibt. Eine Art goldenes Gängelband.
Doch diese Erzählung vom cleveren Deal zerbricht am Widerspruch erfahrener Sicherheitsexperten. Für sie ist der Vorgang ein „own goal“, ein Eigentor von strategischem Ausmaß. Liza Tobin, die unter Trump und Biden im Nationalen Sicherheitsrat für China zuständig war, warnt davor, dass dieser Schritt Peking nur ermutigen werde, weitere Zugeständnisse zu fordern. Ihre Kritik gipfelt in dem vernichtenden Urteil: „You’re selling our national security for corporate profits.“ Man verkaufe die nationale Sicherheit für Unternehmensgewinne.
Die Logik des Geldes gegen das Prinzip der Sicherheit
Der Kern des Problems liegt in einem fundamentalen Zielkonflikt. Das erklärte Ziel der Exportkontrollen war es, Chinas Aufstieg zu einer KI-Supermacht zu verlangsamen. Der nun geschlossene Deal bewirkt potenziell das genaue Gegenteil. Auch wenn der H20-Chip eine abgespeckte Version für den chinesischen Markt ist, bezeichnen ihn 20 Experten, darunter ehemalige Sicherheitsbeamte der Trump-Regierung, in einem offenen Brief als „potent accelerator of China’s frontier A.I. capabilities“. Die Vorstellung, man könne Chinas Fortschritt mit einer leicht gedrosselten Technologie managen, halten sie für eine gefährliche Illusion.
Diese Entscheidung steht nicht im luftleeren Raum. Sie fügt sich nahtlos in ein Muster von Trumps Politik ein, in der traditionelle Regeln und Prinzipien durch transaktionale, oft unorthodoxe Eingriffe ersetzt werden. Die Zustimmung zur Übernahme von U.S. Steel durch Nippon Steel, bei der sich die Regierung eine „goldene Aktie“ und damit ein Vetorecht sicherte, war ein solches Manöver. Die Drohung mit 100-prozentigen Zöllen auf im Ausland gefertigte Halbleiter, um Investitionen in den USA zu erzwingen, ein anderes.
Doch die Monetarisierung der Exportkontrollen ist eine neue Eskalationsstufe. Bisher galt der ungeschriebene Grundsatz, dass die nationale Sicherheit unverhandelbar ist. Christopher Padilla, ein hoher Beamter für Exportkontrollen unter George W. Bush, bezeichnet das Abkommen als „unprecedented and dangerous“ und vergleicht es mit „bribery or blackmail, or both“. Die Botschaft, die dieser Deal in die Welt sendet, ist verheerend: Amerikas Sicherheitsinteressen haben offenbar einen Preis. Und wer bereit ist, ihn zu zahlen, bekommt Zugang zu strategisch sensibler Technologie.
Ein Riss im Fundament der Verfassung?
Über die strategische Kurzsichtigkeit hinaus wirft der Deal eine tiefgreifende rechtliche Frage auf, die bis an die Grundfesten der amerikanischen Verfassung rührt. Experten wie Peter Harrell, der unter der Biden-Regierung im Weißen Haus für internationale Wirtschaft zuständig war, weisen darauf hin, dass die US-Verfassung explizit Steuern auf Exporte verbietet. Die 15-prozentige Abgabe, die als Voraussetzung für eine Exportlizenz erhoben wird, kommt einer solchen verbotenen Steuer gefährlich nahe.
Es ist ein feiner, aber entscheidender Unterschied, ob eine Gebühr zur Deckung administrativer Kosten erhoben wird oder ob der Staat sich einen prozentualen Anteil am Geschäftserfolg sichert und damit zur Einnahmequelle macht. Letzteres ist der Kern einer Steuer. Sollten Gerichte diese Einschätzung teilen, wäre der gesamte Deal nicht nur politisch fragwürdig, sondern schlicht illegal. Diese verfassungsrechtliche Grauzone ist ein weiteres Symptom für einen Regierungsstil, der sich über etablierte Normen und Verfahren hinwegsetzt und die Grenzen des rechtlich Möglichen austestet. Die mangelnde Transparenz im Vorfeld und die Tatsache, dass die Vereinbarung hinter verschlossenen Türen zwischen einem CEO und dem Präsidenten ausgehandelt wurde, verstärken den Eindruck eines willkürlichen Aktes, der die Glaubwürdigkeit des gesamten Exportkontrollregimes untergräbt.
Ein Pyrrhussieg mit ungewissem Ausgang
Selbst wenn man die Sicherheitsbedenken und die rechtlichen Fallstricke für einen Moment ausblendet und den Deal rein wirtschaftlich betrachtet, bleibt ein hohes Maß an Unsicherheit. Die Prognosen, die der Regierung Einnahmen von über zwei Milliarden Dollar in Aussicht stellen, basieren auf erwarteten Verkäufen von über 15 Milliarden Dollar allein durch Nvidia bis zum Jahresende. Doch ob der chinesische Markt diese Erwartungen erfüllt, ist keineswegs sicher.
In Peking blickt man mit erheblichem Misstrauen auf den Deal. Der chinesische Internet-Regulator hat Nvidia-Chef Huang einbestellt, um über mögliche „backdoor security risks“ in den H20-Chips zu sprechen. Staatliche Medien haben chinesische Unternehmen bereits davor gewarnt, die amerikanischen Chips zu kaufen. Es entfaltet sich eine paradoxe Situation: Während die USA ihre Sicherheit für den Marktzugang aufs Spiel setzen, zögert China, diesen Zugang zu nutzen, weil es seinerseits Sicherheitsrisiken fürchtet. Sollten die chinesischen Tech-Riesen am Ende doch verstärkt auf heimische Alternativen von Huawei setzen, könnte der Deal für die USA zum doppelten Fiasko werden: Der strategische Schaden wäre angerichtet, aber die erwarteten Milliarden blieben aus.
Das wahre Erbe: Der Preis des Misstrauens
Am Ende wird der größte Schaden dieses Abkommens vielleicht nicht in verkauften Chips oder entgangenen Einnahmen zu messen sein. Der wahre Preis ist der Verlust von Vertrauen und Berechenbarkeit. Die amerikanische Exportkontrollpolitik, einst ein mächtiges und respektiertes Instrument der nationalen Sicherheit, wird zu einem unberechenbaren Werkzeug degradiert, dessen Einsatz von kurzfristigen finanziellen Interessen und politischen Launen abzuhängen scheint.
Dieser Präzedenzfall ist eine Einladung an die ganze Welt, die Prinzipien der amerikanischen Politik infrage zu stellen. Wenn Lizenzen für KI-Chips gegen Geld zu haben sind, warum nicht auch für andere sensible Technologien wie Werkzeuge zur Halbleiterfertigung? Was hindert andere Nationen daran, von amerikanischen Unternehmen künftig ähnliche Abgaben für den Zugang zu ihren Märkten zu verlangen?
Die unsichtbare Mauer, die Amerikas technologischen Vorsprung schützen sollte, hat einen Riss bekommen. Und durch diesen Riss strömt nicht nur Geld, sondern vor allem Misstrauen. Die Trump-Regierung mag glauben, einen genialen Deal abgeschlossen zu haben. In Wahrheit könnte sie den Grundstein für eine Zukunft gelegt haben, in der es keine verlässlichen Regeln mehr gibt – nur noch eine endlose Kette von Transaktionen, bei denen am Ende alle verlieren.


