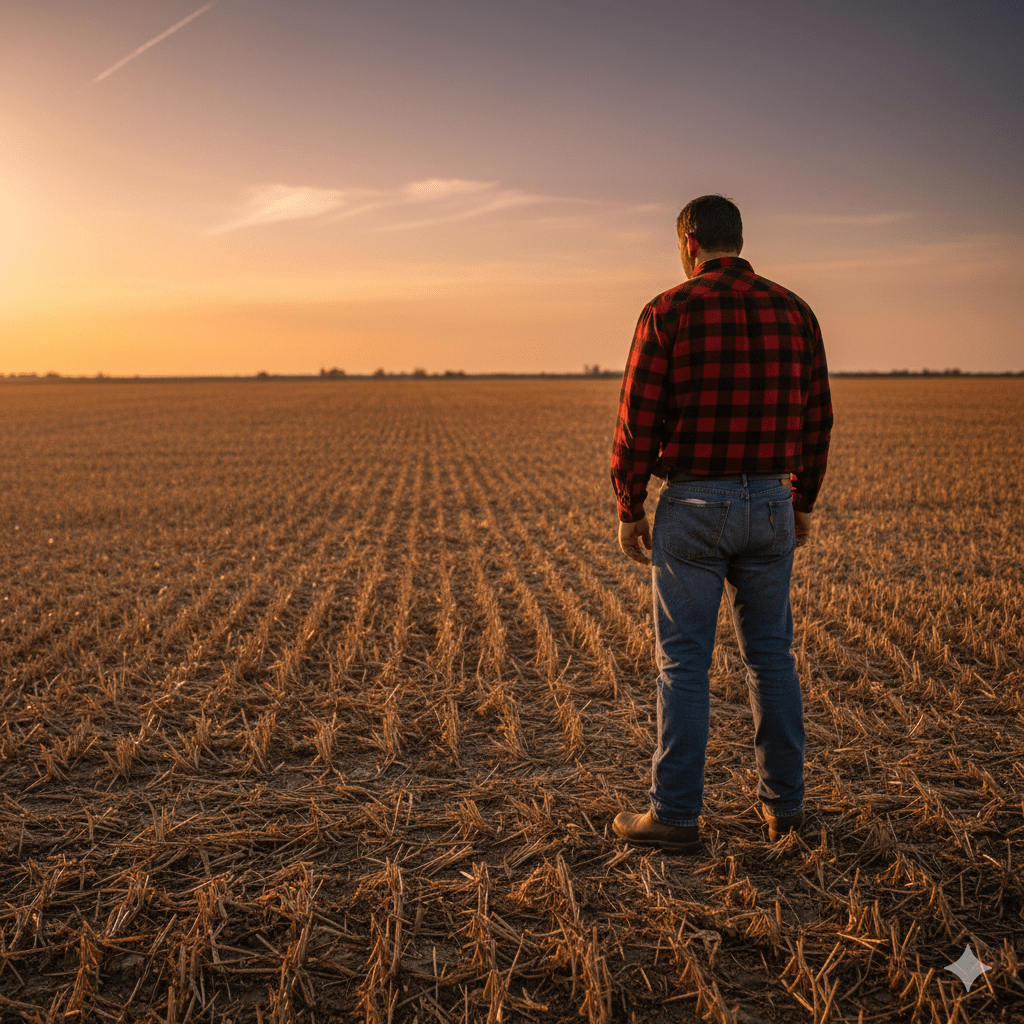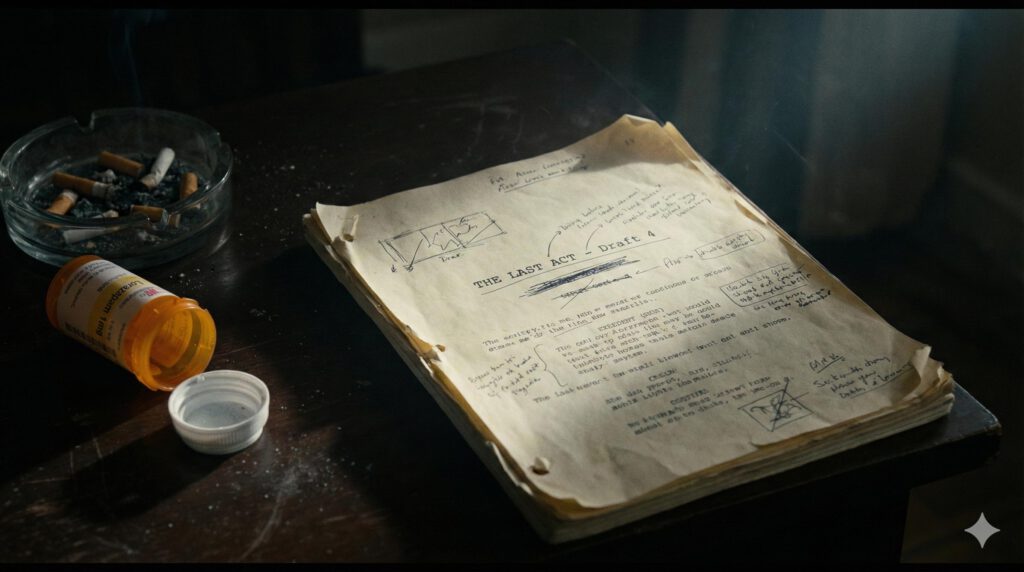Wolodymyr Selenskyj kam nach Washington, um die Instrumente für einen erzwungenen Frieden zu erbitten; er reist mit leeren Händen und einer vagen Vertröstung ab. Das Treffen des ukrainischen Präsidenten mit Donald Trump im Weißen Haus entpuppt sich als Lehrstück über die Asymmetrien moderner Konfliktführung, in dem militärische Realitäten und strategische Notwendigkeiten an der psychologischen Kriegsführung des Kremls zerschellen. Donald Trumps abrupte Kehrtwende in der Frage der Tomahawk-Lieferungen, ausgelöst durch ein einziges, gezieltes Telefonat mit Wladimir Putin, offenbart die gefährliche Leerstelle im Zentrum der amerikanischen Außenpolitik. Die Obsession des Präsidenten mit einem persönlichen „Deal“ – gleich welchen Inhalts – droht, Kiews militärische Optionen zu beschneiden, Russlands Aggression de facto zu legitimieren und die europäische Sicherheitsarchitektur nachhaltig zu destabilisieren.
Das Treffen war für Kiew von existenzieller Bedeutung. Es markierte den Kulminationspunkt einer monatelangen diplomatischen Offensive, die auf ein einziges, klares Ziel ausgerichtet war: die Freigabe von Tomahawk-Marschflugkörpern. In der strategischen Vorstellung Selenskyjs sind diese Waffen nicht bloß ein weiteres Glied in der Kette der Militärhilfe; sie sind der qualitative Sprung, der das narrative und militärische Gleichgewicht des Krieges fundamental verändern soll. Der Unterschied zu bisher gelieferten Systemen, selbst zu den geschätzten ATACMS, ist frappierend. Während ATACMS mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern primär taktische und operative Ziele an der Front oder im unmittelbaren Hinterland bedrohen, operiert der Tomahawk in einer gänzlich anderen Dimension. Mit einer Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern versetzt er die Ukraine in die Lage, strategische Kommandozentralen, Logistikknotenpunkte, Militärbasen und kritische Infrastrukturen tief im russischen Kernland – einschließlich des Moskauer Raums – präzise zu treffen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Selenskyjs Kalkül ist dabei nicht primär die Eskalation um der Eskalation willen. Es ist die kühle, wenngleich riskante Wette, dass Wladimir Putin nur dann zu echten, substanziellen Friedensverhandlungen bereit sein wird, wenn der Krieg für ihn persönlich und für die russische Elite unkalkulierbar teuer wird. Die bisherige Strategie des Westens, die Ukraine gerade so weit auszurüsten, dass sie nicht verliert, hat den Konflikt in einen zermürbenden Abnutzungskrieg verwandelt, den Russland mit seiner schieren Masse an Ressourcen zu gewinnen hofft. Der Tomahawk, so die Kiewer Doktrin, ist der Hebel, um diesen Status quo aufzubrechen und Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen – nicht durch Bitten, sondern durch eine glaubhafte militärische Drohung gegen sein Machtzentrum.
Ein strategischer Dissens und Trumps Eskalations-Scheu
Donald Trump sieht die Welt fundamental anders. Seine Präsidentschaft ist getrieben von der Idee, als der ultimative „Dealmaker“ in die Geschichte einzugehen, der Kriege beendet, die andere nicht beenden konnten. In diesem Weltbild ist die Lieferung einer derart potenten Offensivwaffe wie dem Tomahawk ein Hindernis, kein Katalysator. Trumps Hoffnung, wie er sie im Weißen Haus formulierte, ist es, den Krieg beenden zu können, „ohne über Tomahawks nachdenken zu müssen“. Für diese Haltung artikulierte der Präsident zwei vordergründige Argumente. Erstens die Sorge vor der Eskalation; es handele sich um „sehr gefährliche Waffen“. Zweitens, und vielleicht aufrichtiger, die Sorge um die eigenen Arsenale: Die USA, so Trump, würden keine Waffen abgeben, „die wir selbst benötigen, um unser Land zu schützen“.
Dieses zweite Argument ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen und spiegelt einen tiefen Riss innerhalb der US-Administration wider. Führende Kräfte im Pentagon, namentlich der politische Chef Elbridge Colby, warnen seit langem davor, die strategischen Reserven Amerikas für den europäischen Schauplatz zu erschöpfen. In der Denkschule des Pentagons ist der primäre globale Rivale nicht mehr Russland, sondern China. Tomahawks, so die dortige Logik, sind ein essenzielles Instrument zur Abschreckung im Indo-Pazifik und dürfen nicht in einem europäischen Stellvertreterkrieg verbraucht werden. Dieser strategische Zielkonflikt – die Verteidigung der Ukraine gegen die Vorbereitung auf einen Konflikt im Pazifik – ist real. Er hätte die Grundlage für eine ernsthafte Debatte über Bürdenlastenteilung und die Zukunft der NATO sein können. Doch die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass diese rationale strategische Abwägung nicht der entscheidende Faktor für Trumps plötzliche Kehrtwende war. Der entscheidende Faktor war ein Anruf aus dem Kreml.
Putins psychologischer Sieg
Genau zu dem Zeitpunkt, als Selenskyj auf dem Weg nach Washington war, um seine strategische Wette auf den Tisch zu legen, griff Wladimir Putin zum Telefon. Dieses mehr als zweistündige Gespräch mit Donald Trump war ein Meisterstück psychologischer Manipulation, das perfekt auf das Ego und die außenpolitische Naivität des US-Präsidenten zugeschnitten war.
Putin nutzte ein ganzes Arsenal an Verführungstaktiken, um Trump von der Lieferung der Tomahawks abzubringen. Zunächst die Schmeichelei: Er gratulierte Trump überschwänglich zu dessen angeblichem diplomatischen Durchbruch im Gaza-Konflikt und lobte sogar die humanitären Bemühungen der First Lady Melania Trump. Diese Art der persönlichen Anerkennung ist für Trump bekanntlich unwiderstehlich. Dann die Drohung: Putin warnte unmissverständlich, dass die Lieferung von Tomahawks die bilateralen Beziehungen „substanziell beschädigen“ würde – ein klares Signal, dass ein solcher Schritt Trumps ersehnten „Deal“ torpedieren würde. Und schließlich der Köder: Putin bot Trump genau das an, was dieser hören wollte. Er schlug ein neues, hochrangiges Gipfeltreffen vor, diesmal in Budapest. Er suggerierte damit Verhandlungsbereitschaft und bot Trump jene globale Bühne, die dieser so schätzt. Gleichzeitig reicherte er das Angebot mit vagen Versprechungen über zukünftige Handelsdeals zwischen den USA und Russland an, sobald der Krieg beendet sei.
Das Manöver war ein voller Erfolg. Trump, der sich nur wenige Wochen zuvor noch öffentlich über Putins Hinhaltetaktiken und „Bullshit“ beschwert hatte, schwenkte unmittelbar nach dem Telefonat um. Der Mann, der seine eigene Frustration über den russischen Präsidenten eingestanden hatte, erklärte nun, Putin wolle „einen Deal abschließen“. Die strategische Notwendigkeit der Ukraine wurde in Sekundenschnelle der persönlichen Eitelkeit des US-Präsidenten untergeordnet. Trump scheint unfähig oder unwillig, das Muster zu erkennen. Er verwechselt Putins Angebot von Gesprächen mit der Bereitschaft zu Konzessionen. Er ignoriert, dass Putin durch das Anbieten von Gipfeln wertvolle Zeit kauft, um seine militärischen Positionen zu festigen und den Westen zu spalten. Trump, der von sich selbst glaubt, er sei „pretty good at this stuff“, nachdem er „all my life“ von den Besten ausgetrickst worden sei, beweist einmal mehr, dass er Putins raffiniertestes Werkzeug ist.
Das Déjà-vu von Alaska und die Risiken Budapests
Für die ukrainische Delegation muss sich die Situation wie ein bitteres Déjà-vu anfühlen. Das Muster erinnert fatal an den Trump-Putin-Gipfel in Alaska. Auch damals war die Hoffnung auf einen Durchbruch groß; das Ergebnis war gleich null. Putin wiederholte lediglich seine Maximalforderungen und intensivierte nach dem Gipfel sogar die Angriffe, während Trump das Treffen als Erfolg verkaufte. Das nun in Aussicht gestellte Treffen in Budapest birgt noch größere Risiken. Es soll, so Trumps Vorstellung, ein „doppeltes Treffen“ werden, bei dem er separat mit Putin und Selenskyj spricht, aber die beiden Kriegspräsidenten nicht direkt miteinander. Dieses Format lädt geradezu dazu ein, über die Köpfe Kiews hinweg zu verhandeln. Es evoziert die dunkelsten Kapitel europäischer Geschichte, in denen Großmächte die Sphären kleinerer Nationen unter sich aufteilten. Putin verfolgt exakt diese Strategie: Er will die Zukunft der Ukraine nicht mit Kiew, sondern mit Washington verhandeln, weil er Selenskyj als illegitimen Präsidenten betrachtet und Trump als formbar ansieht.
Selenskyjs Reaktion auf die Abfuhr im Weißen Haus war ein Akt mühsam kontrollierter Schadensbegrenzung. Öffentlich gab er sich „realistisch“. Er wusste, dass ein Eklat wie bei seinem letzten Besuch, als er von Trump und Vizepräsident JD Vance für seine Kleidung und mangelnde Dankbarkeit gemaßregelt wurde, kontraproduktiv wäre. Stattdessen versuchte er, einen Fuß in der Tür zu behalten. Er bot Trump einen Tausch an: Die Ukraine könne Tausende ihrer hochinnovativen Drohnen liefern, an denen die USA Interesse hätten, im Gegenzug für die Tomahawks. Es war ein verzweifelter Versuch, die Dynamik von einer Bitte zu einem Geschäft zu wandeln, um Trumps „Dealmaker“-Instinkt anzusprechen. Doch auch hier blieb Trump vage.
Der Preis des „Friedens“
Die vielleicht alarmierendste Enthüllung dieses Besuchs ist jedoch die zunehmende Konkretisierung dessen, was Trump unter einem „Deal“ versteht. In einem Post auf seiner Social-Media-Plattform formulierte er es unmissverständlich: „They should stop where they are.“ Sie sollen dort aufhören, wo sie sind. Dies ist nichts anderes als die Forderung nach einem Einfrieren des Konflikts entlang der aktuellen Frontlinien. Was Trump als pragmatische Lösung verkauft, bei der „beide den Sieg für sich beanspruchen“ können, wäre für die Ukraine eine katastrophale Niederlage. Es würde den Verlust von rund 20 Prozent ihres Staatsgebiets bedeuten. Es würde die russische Aggression de facto belohnen und einen Präzedenzfall schaffen, der internationales Recht ad absurdum führt. Ein solcher „Friede“ wäre militärisch nicht nachhaltig und wirtschaftlich ein Desaster. Er würde Russland erlauben, sich neu zu formieren, um den Krieg zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen, während die Ukraine als dauerhaft verstümmelter Rumpfstaat zurückbliebe. Trumps Vorschlag ist naiv, aber er trifft auf einen noch perfideren Plan Putins. Berichten zufolge forderte Putin in seinem Telefonat mit Trump die gesamte Region Donezk als Bedingung für einen Deal – also auch Gebiete, die Russland militärisch seit Jahren nicht erobern kann. Im Gegenzug bot er vage an, sich vielleicht aus Teilen von Saporischschja und Cherson zurückzuziehen. Einige im Weißen Haus werteten dies irrtümlicherweise als Fortschritt. In Wahrheit ist es ein klassisches Manöver: eine Maximalforderung aufstellen, um Trumps Vorschlag (das Einfrieren der Front) als vernünftigen „Kompromiss“ erscheinen zu lassen.
Europas Zaudern und Kiews Plan B
Die amerikanische Unentschlossenheit sendet ein verheerendes Signal an die europäischen Verbündeten. Putins jüngste Provokationen – die gezielten Verletzungen des NATO-Luftraums über Polen, Dänemark und Estland – sind offensichtliche Tests. Sie sollen die Entschlossenheit der Allianz prüfen. Wenn die USA, der militärische Anker der NATO, nun signalisieren, dass sie aus Sorge vor Eskalation das entscheidende militärische Druckmittel zurückhalten, lädt dies Putin zu weiteren Aggressionen ein.
Für Kiew bedeutet Trumps Kehrtwende, dass es seine Alternativen forcieren muss. Die Enttäuschung über die ausgebliebene Tomahawk-Zusage wird den Fokus zwangsläufig auf die eigene Rüstungsproduktion lenken. Die Entwicklung eigener Langstreckenwaffen, wie des kürzlich vorgestellten Marschflugkörpers „Flamingo“, wird nun zur strategischen Überlebensfrage. Parallel dazu wird die Ukraine ihre asymmetrische Kampagne fortsetzen: die Drohnenangriffe auf die russische Energieinfrastruktur, die bereits einen signifikanten Teil der Raffineriekapazitäten Russlands lahmgelegt haben. Doch diese alternativen Druckmittel sind ein langsamer, mühsamer Prozess. Sie können den strategischen Schockeffekt von Hunderten Tomahawks nicht ersetzen.
Wolodymyr Selenskyj verließ Washington als Realist. Er hat gelernt, dass im Weißen Haus Donald Trumps Geltungsbedürfnis mehr wiegt als die strategische Logik eines Krieges. Der US-Präsident, geblendet von Putins Schmeicheleien und der Illusion eines bevorstehenden historischen Deals, hat der Ukraine just in dem Moment das Schwert aus der Hand geschlagen, als sie es brauchte, um den Aggressor an den Verhandlungstisch zu zwingen. Der „Dealmaker“ riskiert, zum Architekten einer Niederlage zu werden, die auf Eitelkeit und diplomatischer Täuschung gebaut ist.