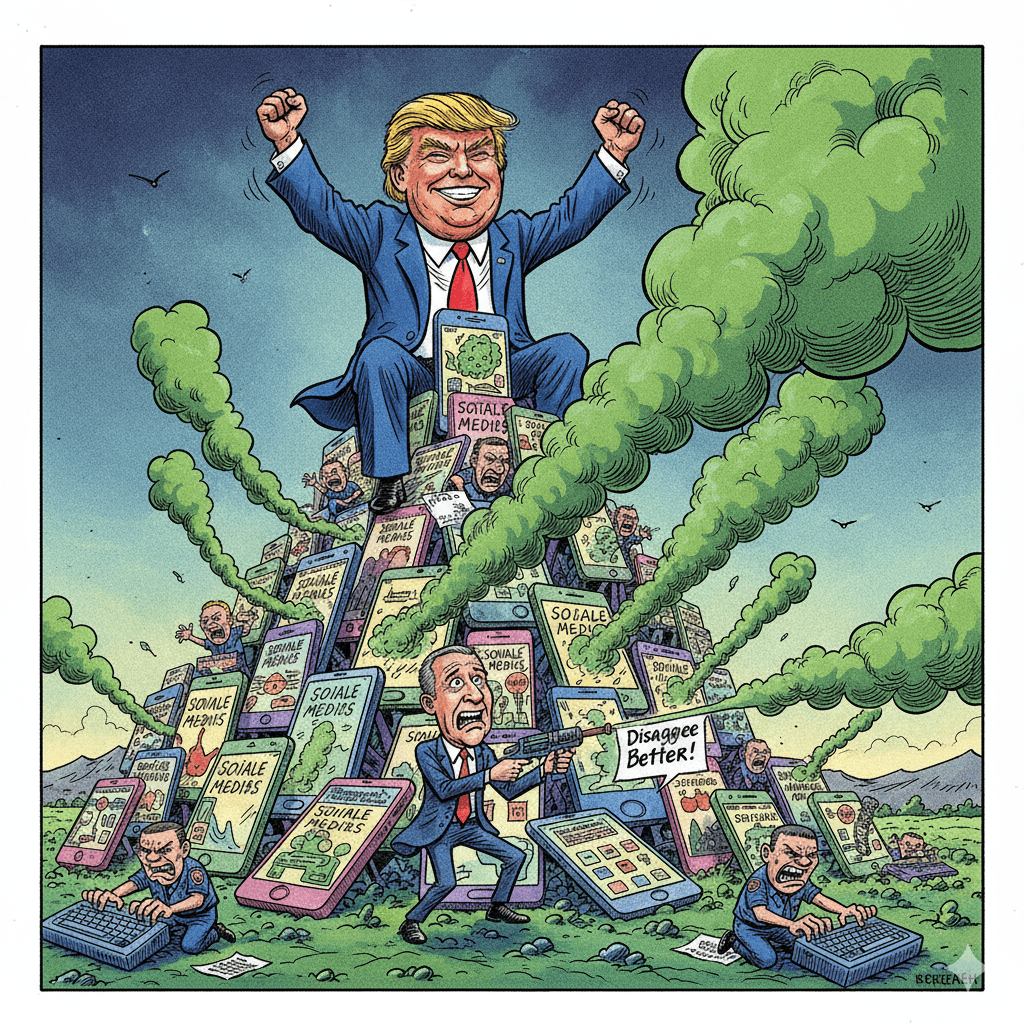Ein Lächeln, eine Geste, ein in die Kameras gehaltener Händedruck zwischen den Führern Chinas, Russlands und Indiens. Auf den ersten Blick ist die Szenerie in der chinesischen Hafenstadt Tianjin nicht mehr als diplomatische Routine, das übliche Ritual globaler Gipfeltreffen. Doch blickt man genauer hin, erkennt man die feinen Fäden einer Inszenierung, deren wahre Botschaft nicht für die Anwesenden im Saal, sondern für einen Adressaten Tausende von Kilometern entfernt bestimmt ist: das Weiße Haus in Washington. Es entfaltet sich das eindringliche Bild einer neuen Allianz, einer pragmatischen Front, die sich gegen die amerikanisch geprägte Weltordnung formiert. Das Paradoxe daran: Der Architekt dieses anti-amerikanischen Bündnisses ist kein anderer als der amerikanische Präsident selbst. Donald Trumps aggressive und unberechenbare Handelspolitik hat wie ein Brandbeschleuniger gewirkt und geopolitische Rivalen in die Arme von Konkurrenten getrieben. Was wir in Tianjin beobachten, ist daher weit mehr als ein Gipfel; es ist das sichtbare Symptom einer tektonischen Plattenverschiebung, der erzwungene Tanz von Akteuren, die aus der Not eine neue, unsichere Gemeinschaft schmieden.
Die Choreografie des Widerstands: Ein Gipfel als globale Botschaft
Wer die Essenz des Gipfels von Tianjin verstehen will, muss die Sprache der Symbole dechiffrieren. Die Bilder, die von dort um die Welt gehen, sind von einer fast theatralischen Präzision. Da ist der indische Premierminister Narendra Modi, der demonstrativ die Hände des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des russischen Präsidenten Wladimir Putin ergreift. Da ist dieselbe Geste, als Modi auf Bitten Putins in dessen Limousine zum Gesprächsort fährt – eine subtile, aber unmissverständliche Anspielung auf den Empfang, den Trump dem russischen Machthaber kürzlich in Alaska bereitet hatte. Jede dieser Gesten ist ein sorgfältig kalibrierter Baustein in einer umfassenden diplomatischen Inszenierung. Ihr Ziel ist es, Einigkeit und eine alternative Machtachse zu projizieren, in einer Welt, die durch Washingtons sprunghafte Politik ins Wanken geraten ist.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
China agiert dabei als der meisterhafte Regisseur dieses Stücks. Präsident Xi Jinping nutzte die Bühne, um die mehr als 20 anwesenden Staats- und Regierungschefs aus Eurasien, dem Nahen Osten und Südostasien auf eine gemeinsame Linie einzuschwören. Seine Rhetorik war ein einziger, kaum verhüllter Angriff auf die Vereinigten Staaten. Er rief dazu auf, sich einer „Mentalität des Kalten Krieges, der Blockkonfrontation und des Mobbings“ zu widersetzen und stattdessen die wirtschaftliche Integration zu suchen, anstatt sich abzukoppeln. Es ist die Sprache eines aufstrebenden Hegemons, der die durch Trumps Politik entstandenen Risse im westlichen Bündnis gezielt nutzt, um einen Keil zwischen Washington und den Rest der Welt zu treiben. Die Botschaft ist klar: Wo Amerika Chaos hinterlässt, bietet China eine Vision von Stabilität und einer „geordneten multipolaren Welt“ an.
Pekings große Vision: Mehr als nur ein Zweckbündnis
Doch Chinas Ambitionen reichen weit über eine bloße Reaktion auf die Politik Trumps hinaus. Der Gipfel in Tianjin markiert den Versuch, eine lose Organisation in das Fundament einer neuen Weltordnung zu verwandeln. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), einst vor einem Vierteljahrhundert zur Klärung zentralasiatischer Grenzfragen gegründet, soll nun „auf die nächste Stufe gehoben werden“. Xi Jinping lässt keinen Zweifel daran, was das bedeutet: die Schaffung einer Alternative zum westlich dominierten globalen System.
Die Werkzeuge für diesen Umbau liegen bereits auf dem Tisch. Xi warb eindringlich für die schnellstmögliche Gründung einer eigenen SCO-Entwicklungsbank. Ein solcher Schritt wäre ein direkter Angriff auf die Vormachtstellung des US-Dollars im globalen Finanz- und Handelssystem. Um diesen Plänen Nachdruck zu verleihen, kündigte China an, den Banken der SCO-Mitgliedsländer Kredite in Höhe von zehn Milliarden Renminbi (1,2 Milliarden Euro) zur Verfügung zu stellen. Diese finanziellen Anreize sind Teil einer umfassenderen Strategie, die wirtschaftliche Macht der SCO-Staaten – eine kombinierte Wirtschaftsleistung von fast 30 Billionen Dollar und ein „riesiger Markt“ – als politisches Druckmittel gegen den Westen zu nutzen.
Gleichzeitig treibt Peking die Expansion der Organisation voran. Ursprünglich ein kleiner Club, ist die SCO zur größten regionalen Organisation der Welt angewachsen und umfasst mittlerweile 27 Mitglieder und Beobachter. Ihre Transformation von einem auf Sicherheitsfragen fokussierten Gremium zu einer Plattform mit globalem wirtschaftlichem und politischem Anspruch ist unübersehbar. Für Länder wie Iran oder Belarus, die unter westlichen Sanktionen stehen, bietet der Gipfel eine willkommene Bühne, um zu demonstrieren, dass sie international nicht isoliert sind. China inszeniert sich so als Schutzmacht und Anführer eines „globalen Südens“, der die Vormachtstellung des Westens nicht länger akzeptieren will.
Indiens Tanz auf dem Vulkan: Zwischen Überleben und Selbstbehauptung
Niemand verkörpert die Zerrissenheit und die existenziellen Zwänge dieser neuen Konstellation so sehr wie Narendra Modi. Für Indien glichen die von Trump verhängten 50-Prozent-Strafzölle einer „wirtschaftlichen Kriegserklärung“. Diese Maßnahme hat die sorgfältig aufgebaute Strategie Indiens, sich als die „China Plus One“-Alternative für globale Konzerne zu positionieren, die ihre Abhängigkeit von chinesischen Fabriken verringern wollen, mit einem Schlag zunichtegemacht. Der Schock in der indischen Wirtschaft sitzt tief; Lieferketten sind unterbrochen, und Unternehmer fühlen sich von Washington verraten.
Dieser amerikanische Druck zwingt Modi zu einem diplomatischen Spagat, der einem Tanz auf einem Vulkan gleicht. Seine Reise nach China, die erste seit sieben Jahren, ist ein Akt der reinen Notwendigkeit. Die Beziehungen zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt waren auf einem Tiefpunkt, nachdem es 2020 zu tödlichen Gefechten zwischen ihren Soldaten im Himalaja gekommen war. Das Misstrauen ist nach wie vor tief. China bleibt für Indien die größte strategische Bedrohung, was durch ein massives Handelsdefizit von 129 Milliarden US-Dollar noch verschärft wird.
Und doch muss Modi nun mit diesem Rivalen kooperieren, um dem Druck des unberechenbaren amerikanischen Partners standzuhalten. Seine Regierung versucht verzweifelt, diesen Balanceakt zu meistern. Vor seiner Ankunft in China besuchte Modi mit Japan einen der engsten Verbündeten der USA im indopazifischen Raum. Kaum in Tianjin gelandet, telefonierte er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um ihm Unterstützung zuzusichern – ein klares Signal an Washington und Moskau zugleich. Zudem lehnte er ein formelles trilaterales Treffen mit Xi und Putin ab. Mit jeder dieser Handlungen versucht Indien, seine „strategische Autonomie“ zu betonen und zu signalisieren, dass es sich nicht in ein anti-westliches Lager zwingen lässt. Doch die Frage bleibt: Wie lange kann man auf einem derart schmalen Grat balancieren, bevor man auf die eine oder andere Seite stürzt?
Russlands verzweifelte Umarmung: Ein Juniorpartner auf Gedeih und Verderb
Während China der Architekt und Indien der widerstrebende Protagonist dieses neuen Bündnisses ist, fällt Wladimir Putin die Rolle des verzweifelten Juniorpartners zu. Für den Kreml ist der Gipfel von Tianjin überlebenswichtig. Es geht darum, der Welt und dem eigenen Volk zu beweisen, dass Russland trotz der westlichen Sanktionen wegen des Krieges in der Ukraine kein internationaler Paria ist. Doch hinter der Fassade des selbstbewussten Auftretens verbirgt sich eine zutiefst prekäre wirtschaftliche Realität.
Die russische Wirtschaft ächzt unter der Last des Krieges. Die Inflation liegt offiziell bei neun Prozent, die Zentralbank versucht mit einem Leitzins von 18 Prozent verzweifelt, die Lage unter Kontrolle zu bringen, erwürgt damit aber die zivile Wirtschaft. Die Staatseinnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sind stark gefallen, während die Militärausgaben weiter steigen. In dieser Lage sind die Ölexporte nach China und Indien zu einer existenziellen Lebensader für den russischen Staatshaushalt geworden. Analysten sind sich einig, dass eine Reduzierung der indischen Ölimporte „erhebliche Auswirkungen“ auf das angespannte russische Budget hätte. Diese ökonomische Abhängigkeit macht Putin zu einem Bittsteller. Seine scharfe Rhetorik gegen die „überholten eurozentrischen Modelle“ kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine Verhandlungsposition schwach ist. Er braucht die Märkte in Peking und Neu-Delhi dringender als diese ihn brauchen.
Ein brüchiges Fundament für eine neue Ordnung
So eindrucksvoll die in Tianjin zur Schau gestellte Einigkeit auch wirken mag, sie steht auf einem zutiefst brüchigen Fundament. Die SCO wird selbst in den Quellen als eine disparate Organisation beschrieben, der es an internationaler Schlagkraft mangelt. Ihre Mitglieder sind weniger durch eine gemeinsame Vision als vielmehr durch einen „gemeinsamen Groll auf die USA“ vereint. Doch Groll allein ist kein stabiler Mörtel, um ein dauerhaftes politisches Gebäude zu errichten.
Die fundamentalen Risse, die dieses Bündnis durchziehen, sind unübersehbar. An vorderster Front steht der ungelöste Grenzkonflikt zwischen Indien und China im Himalaja, eine jederzeit mögliche Zündschnur für eine neue Eskalation. Hinzu kommt die enge militärische und wirtschaftliche Partnerschaft Chinas mit Pakistan, dem Erzfeind Indiens – ein ständiger Stachel im Fleisch der bilateralen Beziehungen. Selbst innerhalb der SCO lähmen die Rivalitäten zwischen Mitgliedsstaaten wie Indien und Pakistan jede tiefere sicherheitspolitische Kooperation.
Was also bleibt von diesem Gipfel? Ist er der Geburtsmoment einer neuen, dauerhaften anti-westlichen Achse? Oder erleben wir lediglich ein flüchtiges Zweckbündnis, das aus der Not geboren wurde und mit der Not wieder vergehen wird? Vieles deutet auf Letzteres hin. Die Koalition von Tianjin ist ein Pakt der Unwilligen, zusammengehalten durch den externen Druck aus Washington. Sollte dieser Druck nachlassen, etwa durch einen Politikwechsel in den USA, könnten die zentrifugalen Kräfte der nationalen Interessen und tiefen Rivalitäten schnell wieder die Oberhand gewinnen. Ein Funke genügt – ein erneuter Zwischenfall an der Grenze, ein neuer Konflikt –, und das mühsam errichtete Gebäude der neuen Freundschaft könnte in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus.