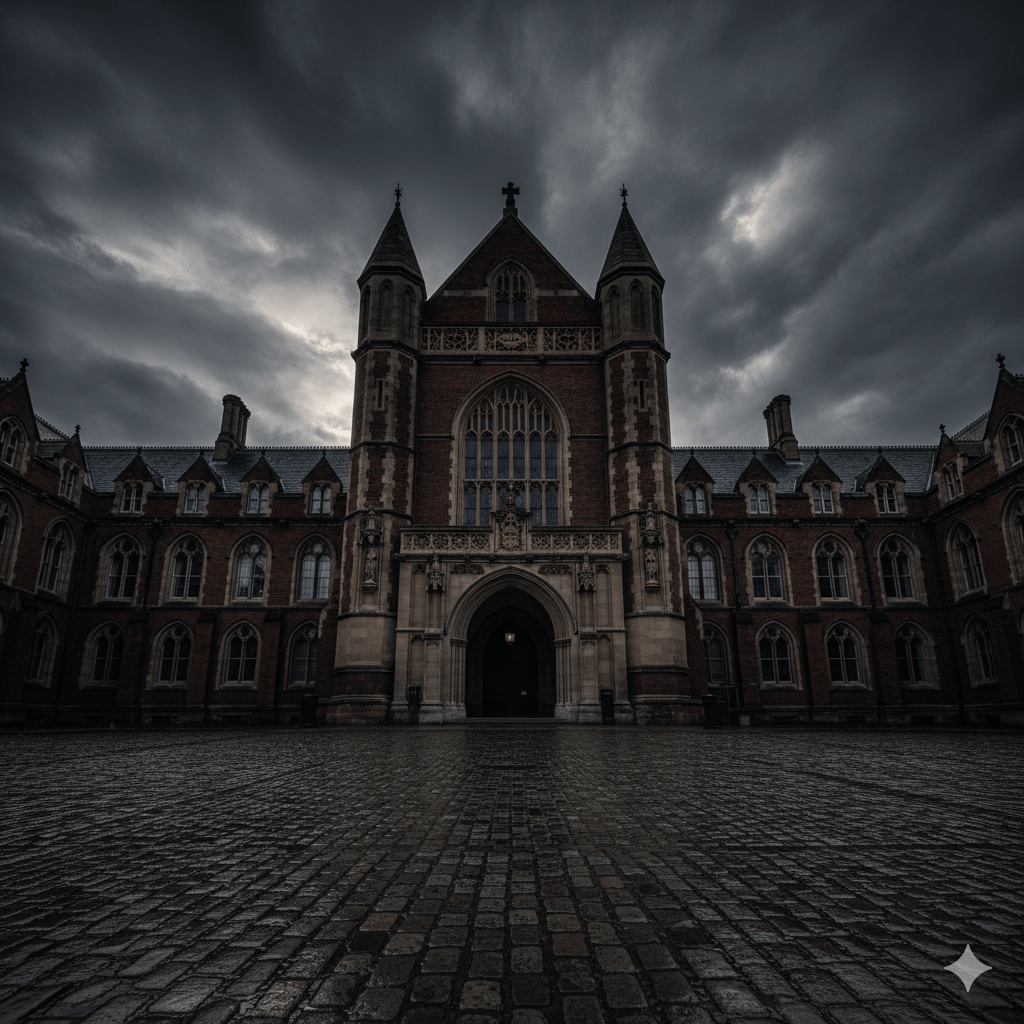Es gibt Momente in der Diplomatie, in denen das Nichtgesagte lauter dröhnt als jede Rede, und in denen die Abwesenheit eines Gastes mehr Raum einnimmt als die Anwesenheit aller anderen. Der G20-Gipfel in Johannesburg war ein solcher Moment. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses elitären Clubs traf sich die Gruppe auf afrikanischem Boden. Doch der historische Meilenstein wurde von einem Schatten verdunkelt, der bis nach Washington reichte: Der Stuhl der Vereinigten Staaten blieb leer. US-Präsident Donald Trump hatte entschieden, dem Treffen fernzubleiben – ein Boykott, begründet mit der behaupteten Verfolgung weißer Minderheiten in Südafrika. Was als Machtdemonstration des America First gedacht war, geriet jedoch zu einem unfreiwilligen Experiment: Kann die Welt auch ohne ihren selbsternannten Anführer weitermachen? Die Antwort aus Johannesburg ist ein vorsichtiges, aber deutliches Ja – auch wenn der Preis dafür eine zunehmende Fragmentierung der globalen Ordnung ist.
Das Vakuum und der Trotz
Die Strategie des Weißen Hauses war offensichtlich nicht nur auf Abwesenheit, sondern auf Sabotage ausgelegt. Nicht nur der Präsident fehlte; es war der Versuch, dem Gipfel durch die Verweigerung jeglicher hochrangiger Teilnahme die Legitimität zu entziehen. Dass am Ende dennoch eine gemeinsame Abschlusserklärung stand, und das sogar früher als üblich, gleicht einer diplomatischen Pirouette. Die verbliebenen Staaten, unterstützt von einer pragmatischen, wenngleich niedrigrangigen russischen Delegation und einem durch seinen Premier vertretenen China, entschieden sich für den kleinsten gemeinsamen Nenner.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Man spürte förmlich den Willen der Akteure, Handlungsfähigkeit zu simulieren, wo eigentlich Ratlosigkeit hätte herrschen müssen. Südafrikas Außenminister Ronald Lamola formulierte es mit einer Mischung aus Realismus und Trotz: Man werde die USA als abwesend markieren und mit den Geschäften fortfahren. Doch diese Geschäftigkeit kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Multilateralismus, wie wir ihn seit 1999 kennen, Risse bekommen hat, die sich kaum mehr kitten lassen. Wenn die größte Volkswirtschaft der Welt den Raum verlässt, wird aus dem G20-Gipfel keine irrelevante Teerunde, aber doch ein Gremium, dem der Hebel für die ganz großen Lasten fehlt.
Die Agenda des Südens: Sieg der Symbolik?
Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa nutzte die Bühne geschickt, um die Themen des Globalen Südens ins Scheinwerferlicht zu rücken: Ungleichheit, Klimafinanzierung, Schuldenkrise. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet in Abwesenheit des reichsten Landes der Erde über die Verteilung von Reichtum debattiert wurde. Die Erklärung liest sich wie ein Wunschzettel der Entwicklungsländer: Mehr Geld für den Klimaschutz, fairere Kreditbedingungen, eine Abkehr vom reinen Rohstoffexport.
Doch hier zeigt sich die Crux der post-amerikanischen Ordnung. Ohne die USA sind Beschlüsse zur Klimafinanzierung oft das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Der ambitionierte Plan, ein globales Gremium zur Überwachung von Ungleichheit zu schaffen – analog zum Weltklimarat –, schaffte es nicht in das finale Dokument. Es blieb bei vagen Bekundungen. Die Realität ist brutal: Man kann den Notstand der Ungleichheit ausrufen, wie es der Bericht von Joseph Stiglitz tat, aber ohne die Zustimmung der US-Finanzmacht bleiben die Gegenmaßnahmen stumpfe Schwerter. Der Inequality Emergency droht, ohne verbindliche globale Mechanismen, die soziale Stabilität vieler Schwellenländer weiter zu erodieren.
Diplomatie auf dem Niveau von Schulhof-Streitereien
Vielleicht noch besorgniserregender als die inhaltlichen Differenzen ist der verrohte Ton, der zwischen Pretoria und Washington herrscht. Die diplomatischen Gepflogenheiten, jenes Schmiermittel der Weltpolitik, sind vollständig aufgebraucht. Dass eine Sprecherin des Weißen Hauses dem südafrikanischen Präsidenten öffentlich vorwirft, er würde sein Maul zerreißen (running his mouth), markiert einen Tiefpunkt des zwischenstaatlichen Umgangs. Es ist eine Sprache der Dominanz und der Verachtung, die nicht mehr auf Ausgleich, sondern auf Unterwerfung setzt.
Dieser Konflikt gipfelte in der gescheiterten Übergabezeremonie. Traditionell reicht der Gastgeber den Hammer an den nächsten Präsidenten weiter. Doch Südafrika weigerte sich, dieses Symbol der Macht einem Junior-Diplomaten – dem amtierenden US-Botschafter – zu übergeben. Die Szene, in der der brasilianische Präsident Lula den Hammer scherzhaft an sich nahm, um ihn ihnen zu bringen, war mehr als eine Anekdote. Sie war ein Sinnbild für das institutionelle Chaos. Das Protokoll, sonst das Korsett, das auch verfeindete Staaten an einen Tisch zwingt, wurde hier zur Waffe umfunktioniert.
Der Schatten der Ukraine und die europäische Emanzipation
Während die USA den Raum physisch verlassen hatten, war ihre Politik im Geiste anwesend – vor allem in Form des 28-Punkte-Friedensplans für die Ukraine, den Trump lanciert hatte. Die Reaktion der europäischen Führungsmächte war bemerkenswert. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wiesen die Forderungen nach Gebietsabtretungen und einer Demilitarisierung der Ukraine geschlossen zurück. Es scheint, als erzwinge der erratische Kurs Washingtons eine Art Zwangsemmanzipation Europas in der Sicherheitspolitik. Kanzler Merz und Präsident Macron machten deutlich: Ein Diktatfrieden über die Köpfe der Ukrainer hinweg ist inakzeptabel.
Dennoch bleibt die Abschlusserklärung in Bezug auf die Ukraine butterweich. Um den Konsens nicht zu gefährden – und wohl auch, um die anwesenden Vertreter Russlands nicht zu verprellen –, vermied man direkte Verurteilungen. Es ist der Preis des Konsenses in einer fragmentierten Welt: Wer alle an Bord halten will, darf den Kurs nicht zu scharf bestimmen. Die Abwesenheit der USA erleichterte paradoxerweise diese Einigung, da der schärfste Kritiker Russlands fehlte, doch die Substanz der Erklärung litt.
Der Spiegel der inneren Zerrissenheit
Während die südafrikanische Regierung auf der Weltbühne als moralische Instanz auftrat, hielt ihr die eigene Bevölkerung einen unbarmherzigen Spiegel vor. Die Straßen Johannesburgs erzählten eine andere Geschichte als die Hochglanzbroschüren im Konferenzzentrum. Auf der einen Seite protestierten Frauenorganisationen mit Sargsymbolen gegen die epidemische Gewalt an Frauen. Auf der anderen Seite nutzten konservative Afrikaner-Gruppen den Moment, um auf Plakaten von einem rassenregulierten Land zu sprechen – eine Botschaft, die sich direkt an das Narrativ Trumps anlehnte.
Diese Diskrepanz zwischen Außenwirkung und Innenansicht ist toxisch. Die Regierung Ramaphosa versuchte, die Proteste als Sabotage abzutun, doch die Bilder bleiben. Trumps Vorwürfe der Verfolgung weißer Farmer mögen von Experten als Desinformation zurückgewiesen werden, doch sie fallen in Südafrika auf den fruchtbaren Boden einer tief gespaltenen Gesellschaft. Die Instrumentalisierung dieser internen Konflikte für geopolitische Ränkespiele ist brandgefährlich und droht, das ohnehin fragile soziale Gefüge am Kap weiter zu destabilisieren.
Blick nach vorn: Das G20-Golfclub-Modell
Was bleibt von Johannesburg? Die Erkenntnis, dass die Weltordnung im Umbruch ist. Die G20 droht, zu einer G19 oder gar zu konkurrierenden Blöcken zu zerfallen. Argentiniens Präsident Milei, der sich als treuer Vasall Trumps gegen die Abschlusserklärung stellte, gab einen Vorgeschmack darauf, wie tief die Risse auch durch den Globalen Süden gehen.
Der Blick auf 2026 verheißt wenig Gutes für den Multilateralismus. Wenn Trump die Staatschefs in seinen Golfclub in Doral lädt und eine verschlankte Agenda ohne woke Themen wie Klimawandel ankündigt, steht das Forum vor einer Zerreißprobe. Johannesburg war der Versuch, die Flamme der Kooperation am Brennen zu halten, während der Wind immer rauer wird. Die Welt hat bewiesen, dass sie sich auch ohne die USA dreht – aber sie dreht sich langsamer, unrunder und mit einer bedrohlichen Unwucht. Der leere Stuhl in Johannesburg war kein Unfall. Er war eine Warnung.